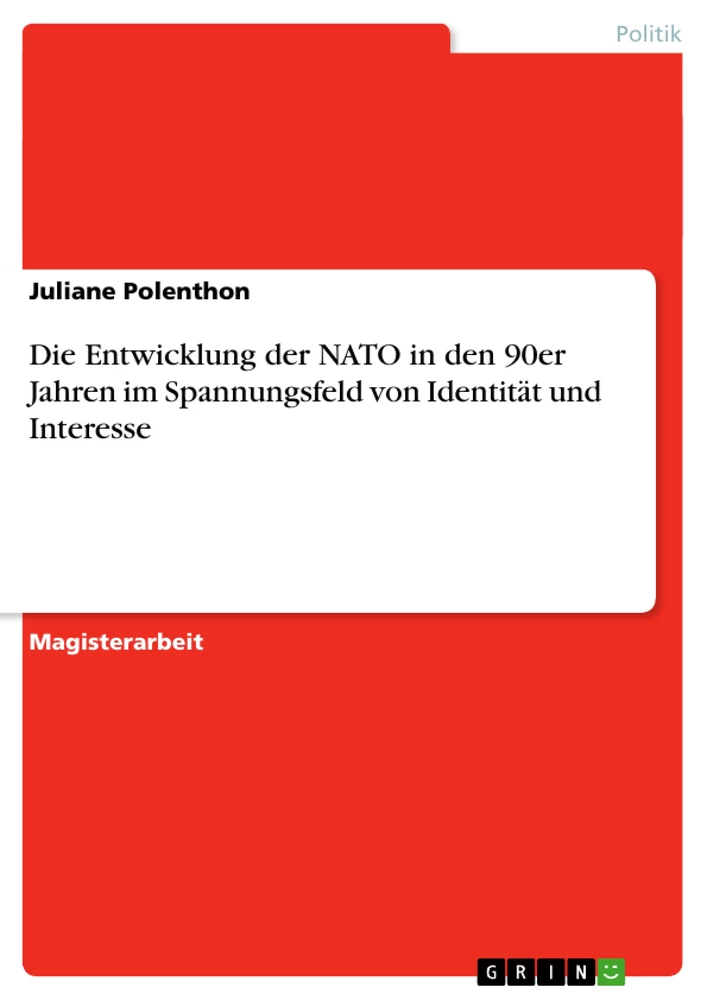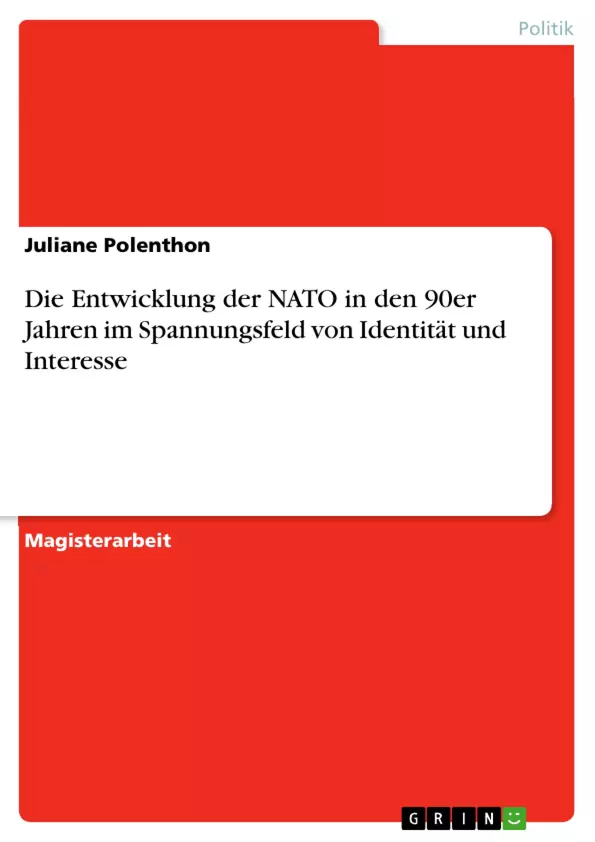Jamie P. Shea brachte die gewandelte Kernfunktion der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) auf eine kurze Formel: „For almost half a century the 1
task of the Western Allies was to prevent a war. Today it is to shape peace.“ Shea kennzeichnete mit diesen prägnanten Worten und schon der semantischen Gegenüberstellung von Krieg und Frieden den veränderten Charakter und mehr noch die Motivation der NATO in einer veränderten Zeit. Sie möchte nicht mehr nur Krieg verhindern, sondern Frieden schaffen, sogar dort aktiv sein, wo Krieg herrscht. Nur welche Mittel sind der Herstellung von Frieden dienlich? Wo sind die Grenzen des friedensschaffenden Handelns? Recht, Interesse, Risiko? Shea würde die Frage bejahen, ob die NATO bisher zurecht Krieg für den Frieden geführt hat.
Der NATO Sprecher stand wie kein anderer Mitarbeiter der Allianz während der Luftschläge gegen das serbische Regime und seine Streitkräfte in der Krisenprovinz Kosovo im Frühjahr 1999 im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Fast drei Monate werden tägliche Pressekonferenzen abgehalten, die Welt hört und sieht mit. Shea informiert, analysiert, spricht Warnungen aus, rechtfertigt, entschuldigt und kämpft - für die Luftoperation der NATO, die die Weltöffentlichkeit in Befürworter und Gegner gespalten hat. Die NATO verfolgte mit ihrer Aktion unanfechtbare Ziele. Der NATO Sprecher wurde in der Zeit der Pressekonferenzen, die ihm neben dem Kosovokrieg wie ein „Krieg der Information“ erschien, nicht müde, zu betonen, dass die NATO Luftschläge im Namen der Menschenrechte gegen ein diktatorisches Regime geführt wurden - der offiziellen NATO Meinung nach offensichtlich Gut gegen Böse kämpfte.
Klar ist aber auch, dass die NATO mit ihrem Eingreifen in die offensichtlich innerstaatliche (serbische) Angelegenheit des Kosovokonflikts mehrere vertragliche Abmachungen missachtete, ja brach. Sie brach das Gewaltverbot, das in der Charta der Vereinten Nationen (VN) festgeschrieben ist. Sie missachtete die Hierarchie der institutionellen Kompetenzen, denn sie erhielt
kein Mandat der VN für ein militärisches Einschreiten gegen Serbien. Sie agierte militärisch, zwar ausgestattet mit einer Konsensentscheidung der souveränen 19 Mitgliedsstaaten der NATO, außerhalb ihres Territoriums, das heißt „out of area“. Sie konterkariert dabei die eigenen vertraglichen Verpflichtungen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Entwicklung der NATO in den 90er Jahren im Spannungsfeld von Identität und Interesse
- Einleitung
- Die NATO als „Wertegemeinschaft”
- Der Nordatlantikvertrag und der „Wert” der NATO
- Strategische Neuausrichtung nach Ende des Kalten Krieges
- Das „Neue Strategische Konzept” von 1991
- Das überarbeitete „Strategische Konzept” von 1999
- Die Strategie der Kooperation und des Dialogs
- Die NATO und Europa
- Die NATO und „out-of-area”-Einsätze
- Krisenmanagement in Bosnien-Herzegowina
- Kriseneinsatz im Kosovo
- Die Dilemmata der Legitimation und Verhältnismäßigkeit
- Die „neue” Identität der NATO
- Die NATO als Interessengemeinschaft
- Interessenkonsens
- Interessendivergenz
- Die Vereinigten Staaten und die Führungsrolle in der NATO
- Frankreich und die unteilbare Staatssouveränität
- Deutschland und der „Sonderweg”
- Die Bedeutung der NATO im nationalen Interesse
- Das Spannungsfeld von Identität und Interesse
- Werte als Handlungsmotiv der NATO?
- Gemeinschaft ungleicher Interessen oder Was hält die NATO zusammen?
- Schlussbemerkungen oder Die Zukunft der NATO
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der NATO in den 1990er Jahren, indem sie das Spannungsfeld zwischen der Identität der NATO als Wertegemeinschaft und ihren nationalen Interessen der Mitgliedsstaaten untersucht. Sie hinterfragt die Motive und Beweggründe des Handelns und Nicht-Handelns der NATO im Kontext des Wandels von einer kriegsverhindernden zu einer friedenserhaltenden Organisation. Die Arbeit untersucht, inwieweit die NATO ihre Rolle in der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur bewahren kann.
- Die Transformation der NATO nach dem Ende des Kalten Krieges
- Die Entwicklung der NATO-Identität als Wertegemeinschaft
- Die Rolle nationaler Interessen innerhalb der NATO
- Die "out-of-area"-Einsätze der NATO und deren Legitimität
- Die zukünftige Rolle der NATO in der europäischen Sicherheitsarchitektur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Entwicklung der NATO in den 90er Jahren im Spannungsfeld von Identität und Interesse: Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der NATO in den 1990er Jahren vor dem Hintergrund des Wandels der internationalen Sicherheitslage nach dem Ende des Kalten Krieges. Sie analysiert die Transformation der NATO von einer vorwiegend verteidigungsorientierten Organisation zu einer Akteurin im Bereich des Krisenmanagements und der Friedenssicherung. Ein zentrales Thema ist das Spannungsverhältnis zwischen der selbstverstandenen Rolle der NATO als Wertegemeinschaft und den divergierenden nationalen Interessen ihrer Mitgliedsstaaten. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die sich aus diesem Spannungsverhältnis ergeben und fragt nach der zukünftigen Rolle der NATO in der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Entwicklung und der zukünftigen Rolle der NATO in den 1990er Jahren. Sie beleuchtet den Wandel der NATO-Funktion von der Kriegsverhinderung zur Friedensschaffung und thematisiert die damit verbundenen Herausforderungen und Dilemmata. Der Kosovo-Einsatz wird als exemplarischer Fall für die komplexen Herausforderungen der NATO in der neuen Sicherheitslandschaft angeführt. Die Arbeit kündigt eine kritische Analyse der NATO-Entwicklung an, die die Aspekte der Identität und der nationalen Interessen berücksichtigt.
Die NATO als „Wertegemeinschaft”: Dieses Kapitel untersucht die Selbstwahrnehmung der NATO als Wertegemeinschaft. Es analysiert den Nordatlantikvertrag und die strategischen Konzepte von 1991 und 1999, um die Entwicklung der NATO-Identität zu beleuchten. Die Kapitel befasst sich mit der Ausweitung des NATO-Engagements auf „out-of-area“-Einsätze, insbesondere in Bosnien und im Kosovo. Die damit verbundenen Herausforderungen der Legitimation und Verhältnismäßigkeit werden kritisch diskutiert.
Die NATO als Interessengemeinschaft: Dieses Kapitel analysiert die NATO als Interessengemeinschaft, wobei die Übereinstimmungen und Divergenzen der nationalen Interessen der Mitgliedsstaaten im Fokus stehen. Es beleuchtet die unterschiedlichen Positionen von beispielsweise den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland in Bezug auf die Führungsrolle innerhalb der Allianz und deren Rolle im internationalen Kontext. Das Kapitel beleuchtet, wie sich nationale Interessen auf die Entscheidungen und das Handeln der NATO auswirken.
Das Spannungsfeld von Identität und Interesse: Das Kapitel untersucht das Spannungsfeld zwischen der Identität der NATO als Wertegemeinschaft und den divergierenden nationalen Interessen ihrer Mitgliedsstaaten. Es analysiert, inwieweit die Werte der NATO als Handlungsmotive dienen und wie die Allianz trotz unterschiedlicher Interessen zusammenhält. Die Herausforderungen und Spannungen zwischen den unterschiedlichen nationalen Interessen der Mitgliedstaaten, und wie die NATO diese überwindet, werden hier beleuchtet.
Schlüsselwörter
NATO, Transformation, Identität, Interessen, Sicherheitsarchitektur, Kosovo, Bosnien, Krisenmanagement, Friedenssicherung, nationale Interessen, Wertegemeinschaft, Strategische Konzepte, out-of-area-Einsätze, Legitimität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Entwicklung der NATO in den 90er Jahren im Spannungsfeld von Identität und Interesse"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Entwicklung der NATO in den 1990er Jahren. Im Mittelpunkt steht das Spannungsverhältnis zwischen der NATO als Wertegemeinschaft und den divergierenden nationalen Interessen ihrer Mitgliedsstaaten. Die Arbeit untersucht die Motive und Beweggründe des Handelns der NATO im Kontext des Wandels von einer kriegsverhindernden zu einer friedenserhaltenden Organisation und die Bewahrung ihrer Rolle in der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Transformation der NATO nach dem Ende des Kalten Krieges, der Entwicklung ihrer Identität als Wertegemeinschaft, der Rolle nationaler Interessen, den "out-of-area"-Einsätzen (z.B. Bosnien, Kosovo) und deren Legitimität, sowie der zukünftigen Rolle der NATO in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Sie analysiert die strategischen Konzepte von 1991 und 1999 und untersucht die Positionen verschiedener Mitgliedsstaaten wie den USA, Frankreich und Deutschland.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur NATO als Wertegemeinschaft und Interessengemeinschaft, ein Kapitel zum Spannungsfeld zwischen Identität und Interesse, Schlussbemerkungen und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte. Ein Inhaltsverzeichnis gibt einen umfassenden Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitelzusammenfassungen, die die Kernaussagen und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen erleichtern den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Inhalte der einzelnen Kapitel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: NATO, Transformation, Identität, Interessen, Sicherheitsarchitektur, Kosovo, Bosnien, Krisenmanagement, Friedenssicherung, nationale Interessen, Wertegemeinschaft, Strategische Konzepte, out-of-area-Einsätze, Legitimität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der NATO in den 1990er Jahren im Kontext des Wandels der internationalen Sicherheitslage zu analysieren und das Spannungsverhältnis zwischen ihren Werten und den nationalen Interessen ihrer Mitglieder zu untersuchen. Sie möchte die Motive und Herausforderungen des Handelns und Nicht-Handelns der NATO beleuchten.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit verwendet den Kosovo-Einsatz als exemplarischen Fall für die komplexen Herausforderungen der NATO in der neuen Sicherheitslandschaft. Die Einsätze in Bosnien und Kosovo dienen als Beispiele für "out-of-area"-Operationen der NATO und die damit verbundenen Herausforderungen der Legitimation und Verhältnismäßigkeit.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Geschichte und Entwicklung der NATO, internationalen Beziehungen und europäischer Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Der Fokus liegt auf einer akademischen Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Juliane Polenthon (Author), 2003, Die Entwicklung der NATO in den 90er Jahren im Spannungsfeld von Identität und Interesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23869