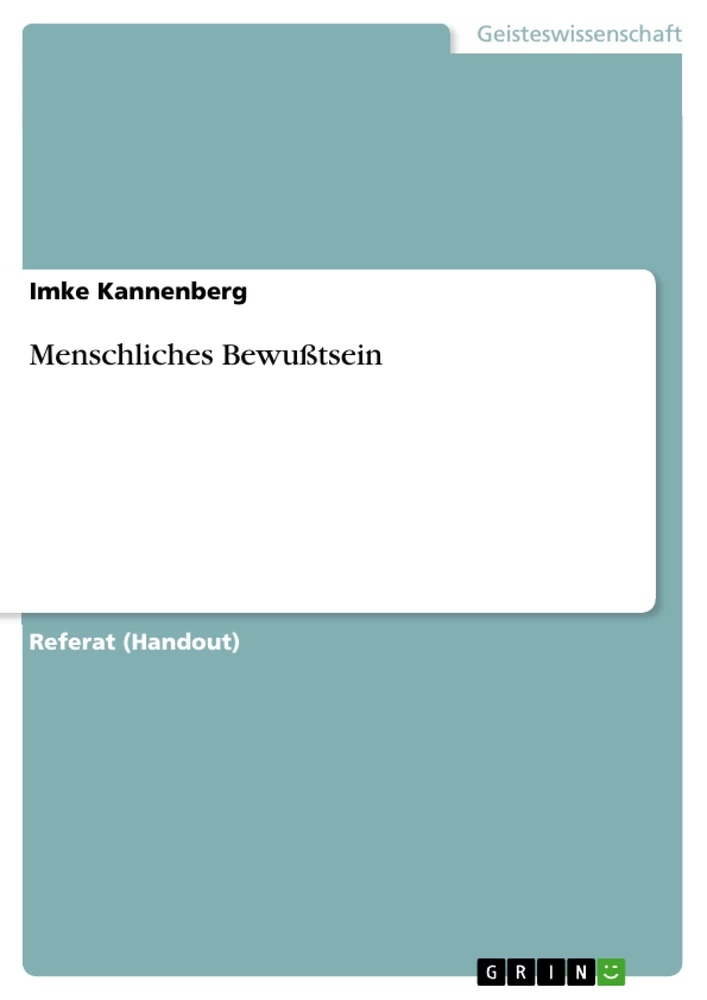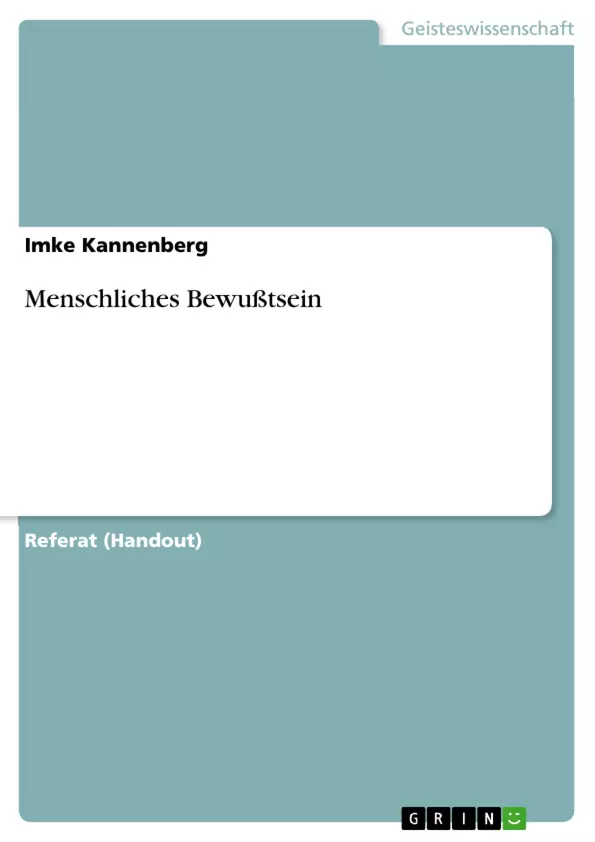Menschliches Bewußtsein
Bei den griechischen Philosophen Platon (ca.428/27-348/47 v. Chr.) und Aristoteles (384-322 v. Chr.) war die Seele eine mit dem Körper interagierende nichtmaterielle Entität. Für Hippokrates (um 470-370 v. Chr.), den ersten bedeutenden Arzt, war das Gehirn der Interpret des und gleichzeitig der Bote zum Bewußtsein. Die Auffassung
eines Leib-Seele-Dualismus gab es also schon seit der griechischen Antike, die Interaktion von Seele und Leib stellte damals jedoch noch kein Problem dar. Eine Diskussion um den Bewußtseinsbegriff entstand erst in der neuzeitlichen Philosophie (also ab Mitte des 15.Jh.). René Descartes (1596-1650) stellte als erster eine These
darüber auf, wie ein nichtmaterieller Geist (res cogitans) mit dem materiellen Körper (res extensa) interagieren könnte. Er siedelte den Ort der Vermittlung im Gehirn an.
In der heutigen Philosphie und Psychologie wird überwiegend die Gegenposition zum Dualismus, der Monismus, akzeptiert. Er besagt, dass der Geist und geistige Zustände sich im Prinzip immer auf Hirnzustände zurückführen lassen, also dass alles Denken und Handeln eine physisch-materielle Basis habe.(1)
[...]
_____
1 Philip G. Zimbardo und Richard J. Gerrig, Psychologie (Berlin: Springer, 7.Auflage 1999) 173
Inhaltsverzeichnis
- Menschliches Bewußtsein
- Der Bewußtseinsbegriff
- Selbstbewußtsein
- Merkmale des Bewußtseins
- Subjektivität
- Qualia
- Der Sinn des Erlebens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht den Begriff des menschlichen Bewußtseins, ausgehend von historischen philosophischen Positionen bis hin zu aktuellen neurophysiologischen Ansätzen. Es beleuchtet die verschiedenen Bedeutungsfacetten des Bewußtseinsbegriffs und analysiert zentrale Merkmale wie Subjektivität und Qualia.
- Historische Entwicklung des Bewußtseinsbegriffs
- Der Dualismus vs. Monismus
- Die Merkmale Subjektivität und Qualia
- Das Problem der physikalistischen Erklärung von Bewußtsein
- Der Sinn des Erlebens und das Qualia-Problem
Zusammenfassung der Kapitel
Menschliches Bewußtsein: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die historischen Perspektiven auf das Bewußtsein, beginnend mit den griechischen Philosophen Platon und Aristoteles bis hin zu René Descartes und seinem Leib-Seele-Dualismus. Es wird die Entwicklung des Bewußtseinsbegriffs in der neuzeitlichen Philosophie skizziert und der Übergang zum Monismus in der heutigen Philosophie und Psychologie beschrieben, wobei der Geist und geistige Zustände auf Hirnzustände zurückgeführt werden.
Der Bewußtseinsbegriff: Hier werden die drei Hauptbedeutungen des Wortes „Bewußtsein“ differenziert: 1. als Sammelbegriff für Erlebnisformen; 2. als Bezeichnung für die Meinungen eines bewußten Wesens; und 3. im Sinne von Selbstbewußtsein. Das Kapitel betont die unterschiedlichen Ebenen des Bewußtseins und legt den Fokus auf die erste Bedeutung, die für den weiteren Verlauf des Referates zentral ist.
Selbstbewußtsein: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Selbstbewußtsein als der höchsten mentalen Erfahrung, dem Wissen um die eigenen mentalen Zustände. Es werden unterschiedliche Auffassungen zum Selbstbewußtsein diskutiert, insbesondere die Frage, ob Tiere und Kleinkinder, die keine Gedanken höherer Ordnung bilden können, kein Bewußtsein haben können. Die Bedeutung und evolutionäre Rolle des Selbstbewußtseins werden angedeutet.
Merkmale des Bewußtseins: Dieses Kapitel behandelt zwei wesentliche Merkmale des Bewußtseins: Subjektivität und Qualia. Die Subjektivität wird als unmittelbares Wissen von eigenen bewußten Zuständen beschrieben, während Qualia die phänomenalen Qualitäten mentaler Ereignisse bezeichnen. Das Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten, Qualia physikalistisch zu erklären und stellt die Frage nach einem spezifischen qualitativen Merkmal bei bewußten mentalen Zuständen.
Subjektivität: Die Subjektivität bewußter Zustände wird als ein unmittelbares, nicht auf Beobachtung beruhendes Wissen definiert. Die „erste-Person-Autorität“ wird als ein zentrales Merkmal hervorgehoben, das eine Asymmetrie zwischen erster und dritter Person Perspektive aufzeigt. Die These der Descartesschen „vollständigen Transparenz“ des Geistes wird kritisch beleuchtet.
Qualia: Der Abschnitt behandelt Qualia als eigentümliche phänomenale Qualitäten mentaler Ereignisse (z.B. das Sehen einer roten Tomate). Die Problematik der physikalistischen Erklärung von Qualia und die Frage nach deren evolutionärer Begründung werden diskutiert, insbesondere anhand von Gedankenexperimenten mit Zombies. Die Unterscheidung zwischen „seelischen“ und „geistigen“ mentalen Zuständen wird eingeführt.
Der Sinn des Erlebens: Dieser Abschnitt widmet sich der Frage nach dem Sinn des Erlebens und dem „Qualia-Problem“. Anhand eines Gedankenexperiments wird die Schwierigkeit, Qualia physikalistisch zu erklären und evolutionär zu begründen, verdeutlicht. Die Vorstellung von Zombies und die Möglichkeit von Qualia-Umkehrungen werden als Argumente gegen das Supervenieren von Qualia auf Physikalischem angeführt.
Schlüsselwörter
Bewußtsein, Selbstbewußtsein, Dualismus, Monismus, Subjektivität, Qualia, Physikalismus, Qualia-Problem, Zombies, Gedankenexperimente, Neurophysiologie, Binding.
Häufig gestellte Fragen zum Referat: Menschliches Bewusstsein
Was ist der Inhalt dieses Referats?
Das Referat befasst sich umfassend mit dem menschlichen Bewusstsein. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Text untersucht den Bewusstseinsbegriff von historischen philosophischen Perspektiven bis hin zu aktuellen neurophysiologischen Ansätzen. Zentrale Themen sind der Dualismus vs. Monismus, Subjektivität, Qualia und das Qualia-Problem.
Welche Kapitel umfasst das Referat?
Das Referat gliedert sich in die folgenden Kapitel: Menschliches Bewusstsein, Der Bewusstseinsbegriff, Selbstbewusstsein, Merkmale des Bewusstseins, Subjektivität, Qualia und Der Sinn des Erlebens. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt das Referat?
Das Referat untersucht den Begriff des menschlichen Bewusstseins und beleuchtet dessen verschiedene Bedeutungsfacetten. Es analysiert zentrale Merkmale wie Subjektivität und Qualia und betrachtet die Problematik der physikalistischen Erklärung von Bewusstsein.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themenschwerpunkte sind die historische Entwicklung des Bewusstseinsbegriffs, der Dualismus vs. Monismus, die Merkmale Subjektivität und Qualia, das Problem der physikalistischen Erklärung von Bewusstsein und der Sinn des Erlebens sowie das Qualia-Problem.
Was sind Subjektivität und Qualia im Kontext des Referats?
Subjektivität wird als unmittelbares Wissen von eigenen bewussten Zuständen beschrieben. Qualia bezeichnen die phänomenalen Qualitäten mentaler Ereignisse (z.B. das Erlebnis, eine rote Tomate zu sehen). Das Referat diskutiert die Schwierigkeiten, Qualia physikalistisch zu erklären.
Was ist das Qualia-Problem?
Das Qualia-Problem befasst sich mit der Schwierigkeit, die phänomenalen Qualitäten mentaler Ereignisse (Qualia) physikalistisch zu erklären und evolutionär zu begründen. Das Referat verwendet Gedankenexperimente wie das Zombie-Argument, um diese Problematik zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt der Dualismus und Monismus im Referat?
Das Referat vergleicht den Dualismus (Trennung von Geist und Körper) und den Monismus (Einheit von Geist und Körper) in Bezug auf das Bewusstsein. Es skizziert die historische Entwicklung und den Übergang vom Dualismus zum Monismus in der Philosophie und Psychologie.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Referats wichtig?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Dualismus, Monismus, Subjektivität, Qualia, Physikalismus, Qualia-Problem, Zombies, Gedankenexperimente, Neurophysiologie und Binding.
Welche Philosophen werden im Referat erwähnt?
Das Referat erwähnt Platon, Aristoteles und René Descartes in Bezug auf die historische Entwicklung des Bewusstseinsbegriffs und dessen unterschiedlichen philosophischen Deutungen.
Für wen ist dieses Referat gedacht?
Dieses Referat ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im Bereich des menschlichen Bewusstseins auf strukturierte und professionelle Weise.
- Quote paper
- Imke Kannenberg (Author), 2002, Menschliches Bewußtsein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2389