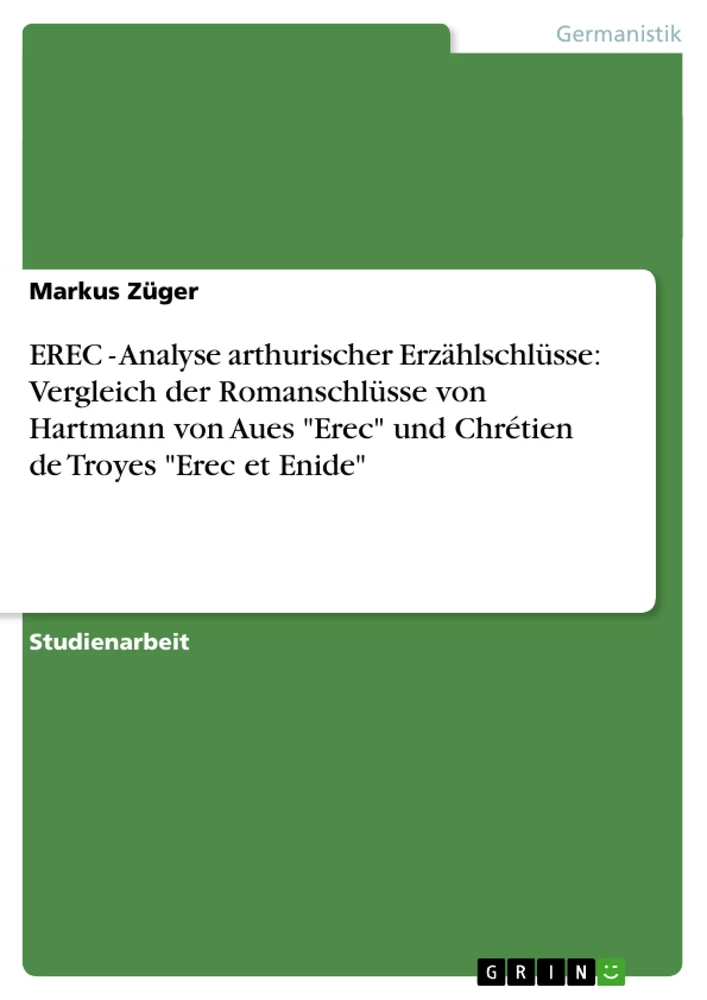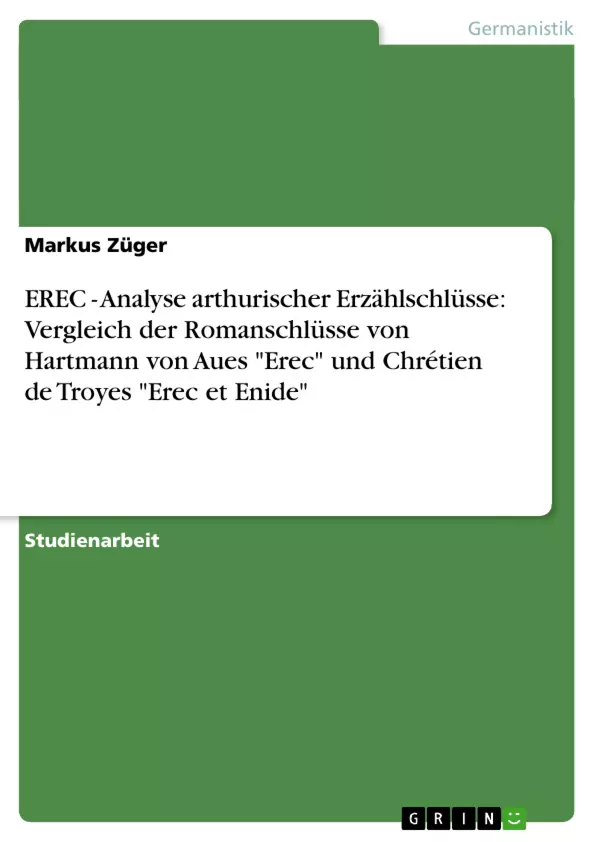[...] Mit Chrétiens „Erec et Enide“ (ca. 1170) hat alles
begonnen, einige Jahre später hat Hartmann seinen deutschen „Erec“ (zwischen 1180 und
1190) geschrieben. Auch wenn die Story dieselbe ist, ging Hartmann über die reine Adaption
der Vorlage hinaus. Die Gattung des Romans stand mitten in ihrer Entwicklung.
Darin sehe ich die Stärken einer komparatistischen Arbeit, wie ich sie hier schreibe: Gerade
der Vergleich verwandter Texte aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Kulturkreisen
öffnet Einblicke in die Evolution der Literatur. Zudem ist es spannend Phänomene dieser
Entwicklung dann zu beobachten, wenn literarische Strukturen noch neu und ungefestigt,
gattungsspezifische Normen noch nicht vorhanden oder recht biegsam sind. Wo scheint
diese Gelegenheit besser, als im Vergleich von Chrétiens und Hartmanns Arbeiten, die im
Begriffe sind, die neuen Massstäbe des Romans zu setzen?
In meiner Arbeit richte ich meine Sinne auf die Schlüsse der beiden Romane. In
Übereinstimmung mit Ruberg scheint mir, dass die beiden Schlusspartien, wenn auch nicht
die „hWichtigkeit letzter DingeV“, so doch „analog zum Werkeingang - einen besonders
komplexen Part [bilden] , da sie zu verdeutlichen haben, hwohin ein Werk führtV“1. So
auch in den beiden Erec-Dichtungen: Bildet der Schluss doch zweifellos das Finale für
vorhergegangene „aventiuren“. Belohnung für überstandene Mühen und vollführte
Bewährung stehen dabei im Vordergrund. Das abschliessende Happy-End nach erfolgreicher
Bewährung gehört unweigerlich dazu, wollen die beiden Autoren ihre didaktischen
Anschauungen dem höfischen Publikum weiterhin erfolgreich vermitteln. Unter dieser
Betrachtung scheint es, als hätten Hartmann und Chrétien nicht nur den Roman geschaffen,
sondern zudem Ansätze zur wichtigen Form des Entwicklungsromans geliefert.
Vorgehen werde ich hauptsächlich textanalytisch. Im Umfang dieser Arbeit masse ich es mir
nicht an, dahinter steckende Ideologie und Geschichte aufzuarbeiten, geschweige denn,
sprachwissenschaftliche Exkursionen zu führen. Schwerpunkt der Arbeit bilden die drei
Figuren Erec, Enite/Enide und Artus. Wie sie dargestellt sind, wie sie handeln und in
welcher Beziehung sie zueinander stehen, auf diese Fragen versuche ich Antworten zu
finden. Dabei wird eines jedoch schnell klar: Dass Chrétien und Hartmann ihren Figuren
recht verschiedene Konzeptionen zugrunde legen.
1 Ruberg (1995), S. 69.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Hartmanns und Chrétiens Romanschlüsse als Textgegenstand
- 2. Zur Struktur der Schlüsse
- 3. Hartmanns Didaktik versus Chrétiens Authentizität
- 4. Die Krönung des Helden Erec
- 5. König Artus - ein vergängliches Ideal
- 6. Enide oder Enite - über die Darstellung des höfischen Frauenbildes
- 7. Abschliessende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Schlusssequenzen von Hartmanns "Erec" und Chrétiens "Erec et Enide", um die Entwicklung des höfischen Romans zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse der strukturellen und inhaltlichen Unterschiede, insbesondere in der Darstellung der Hauptfiguren Erec, Enide/Enite und Artus. Die Arbeit untersucht, wie die Autoren ihre didaktischen Absichten in den Schlusssequenzen umsetzen und wie sich dies auf die Gesamtinterpretation der Romane auswirkt.
- Vergleich der Romanschlüsse von Hartmann von Aue und Chrétien de Troyes
- Analyse der strukturellen Unterschiede in den Schlusssequenzen
- Untersuchung der unterschiedlichen didaktischen Ansätze der Autoren
- Darstellung der Hauptfiguren Erec, Enide/Enite und Artus
- Entwicklung des höfischen Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden Autoren, Hartmann von Aue und Chrétien de Troyes, als Pioniere des höfischen Romans vor. Sie begründet den Vergleich der Schlusssequenzen beider "Erec"-Versionen als Zugang zur Erforschung der literarischen Entwicklung und der gattungsspezifischen Normen des frühen Romans. Der Fokus der Arbeit liegt auf der textanalytischen Untersuchung der Figuren Erec, Enide/Enite und Artus und deren Interaktionen. Die Autorin kündigt einen vergleichenden Ansatz an, der die unterschiedlichen Konzeptionen der Figuren bei beiden Autoren herausstellen wird.
1. Hartmanns und Chrétiens Romanschlüsse als Textgegenstand: Dieses Kapitel beginnt die Komparation der Schlusssequenzen beider Romane, beginnend mit Erecs Rückkehr an den Hof König Artus. Es werden die quantitativen und qualitativen Unterschiede in der Länge und der erzählten Zeit beider Schlusspartien hervorgehoben. Die Autorin argumentiert, dass selbst scheinbar erzählökonomische Variationen bei Hartmann eine neue Deutung des Sinngehalts ermöglichen. Sie bezieht sich dabei auf die Forschung, die bereits die stärkere Diskrepanz im Schlussteil beider Romane festgestellt hat, und auf die unterschiedliche Rolle, die Artus in beiden Versionen spielt.
2. Zur Struktur der Schlüsse: Dieses Kapitel analysiert die strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Schlusssequenzen. Obwohl der grundlegende Plot gleich bleibt – Erecs Rückkehr zum Hof, sein Empfang und seine Krönung – werden Unterschiede in der Erzählstruktur und der moralischen Bewertung des Ereignisses herausgearbeitet. Hartmann hält sich stärker an konforme Erzählstrukturen und betont die moralische Apotheose des Endes, im Gegensatz zu Chrétien, der auf eine explizite Glorifizierung verzichtet und den Schluss eher als Impuls zu neuer Handlung versteht.
Schlüsselwörter
Höfischer Roman, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, Erec, Enide, Artus, Romanschluss, Textvergleich, Didaktik, höfisches Frauenbild, Erzählstruktur, Entwicklungsroman.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Romanschlüsse von Hartmanns "Erec" und Chrétiens "Erec et Enide"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit vergleicht die Schlusssequenzen der "Erec"-Versionen von Hartmann von Aue und Chrétien de Troyes. Der Fokus liegt auf der Analyse der strukturellen und inhaltlichen Unterschiede, insbesondere in der Darstellung der Hauptfiguren Erec, Enide/Enite und Artus, um die Entwicklung des höfischen Romans zu beleuchten und die didaktischen Absichten der Autoren zu untersuchen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Vergleich der Romanschlüsse, die Analyse der strukturellen Unterschiede in den Schlusssequenzen, die unterschiedlichen didaktischen Ansätze der Autoren, die Darstellung der Hauptfiguren Erec, Enide/Enite und Artus sowie die Entwicklung des höfischen Romans. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle König Artus und der unterschiedlichen Konzeptionen des höfischen Frauenbildes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich der Romanschlüsse als Textgegenstand, ein Kapitel zur Struktur der Schlüsse, ein Kapitel zum Vergleich der Didaktik Hartmanns und der Authentizität Chrétiens, ein Kapitel zur Krönung Erecs, ein Kapitel zu König Artus, ein Kapitel zur Darstellung Enides/Enites und abschließende Bemerkungen.
Wie werden die Schlusssequenzen verglichen?
Der Vergleich der Schlusssequenzen erfolgt sowohl quantitativ (Länge und erzählte Zeit) als auch qualitativ (Erzählstruktur, moralische Bewertung, Rolle der Figuren). Die Arbeit hebt die Unterschiede in der Erzählökonomie und der moralischen Apotheose des Endes bei Hartmann im Gegensatz zu Chrétien hervor.
Welche Rolle spielen Erec, Enide/Enite und Artus?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Erec, Enide/Enite und Artus in beiden Romanversionen und untersucht, wie die Autoren diese Figuren konzipieren und in die Handlung integrieren. Die unterschiedlichen Rollen, die Artus in beiden Versionen spielt, werden besonders hervorgehoben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, durch den Vergleich der Schlusssequenzen von Hartmanns und Chrétiens "Erec" ein besseres Verständnis der Entwicklung des höfischen Romans und der gattungsspezifischen Normen zu erlangen. Sie untersucht, wie die Autoren ihre didaktischen Intentionen in den Schlusssequenzen umsetzen und wie dies die Gesamtinterpretation der Romane beeinflusst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Höfischer Roman, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, Erec, Enide, Artus, Romanschluss, Textvergleich, Didaktik, höfisches Frauenbild, Erzählstruktur, Entwicklungsroman.
- Quote paper
- Markus Züger (Author), 1999, EREC - Analyse arthurischer Erzählschlüsse: Vergleich der Romanschlüsse von Hartmann von Aues "Erec" und Chrétien de Troyes "Erec et Enide", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23941