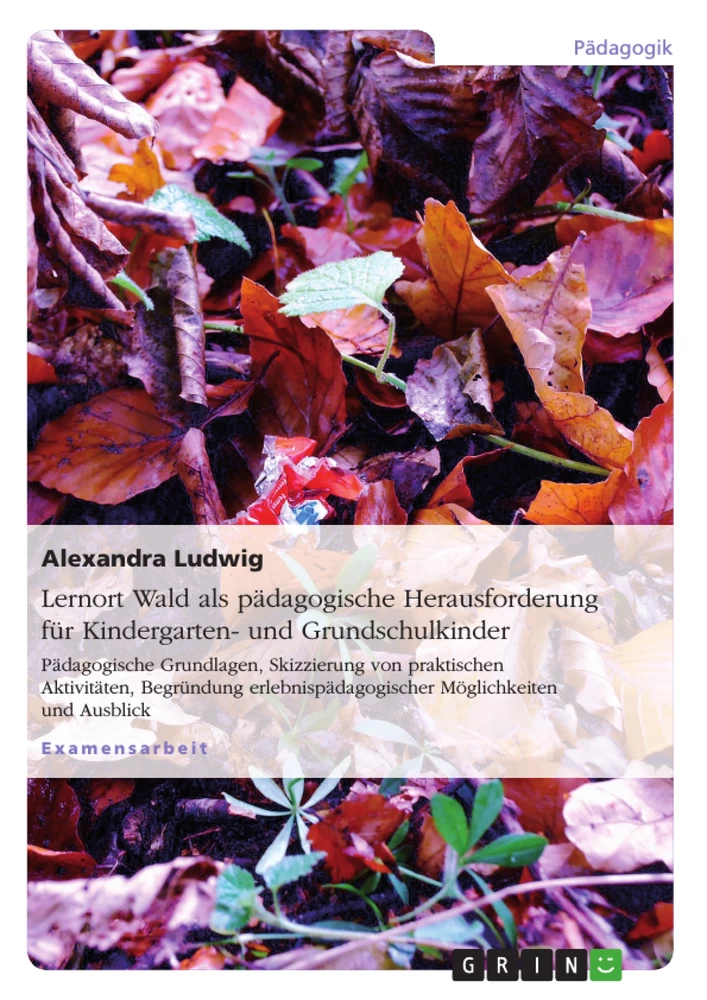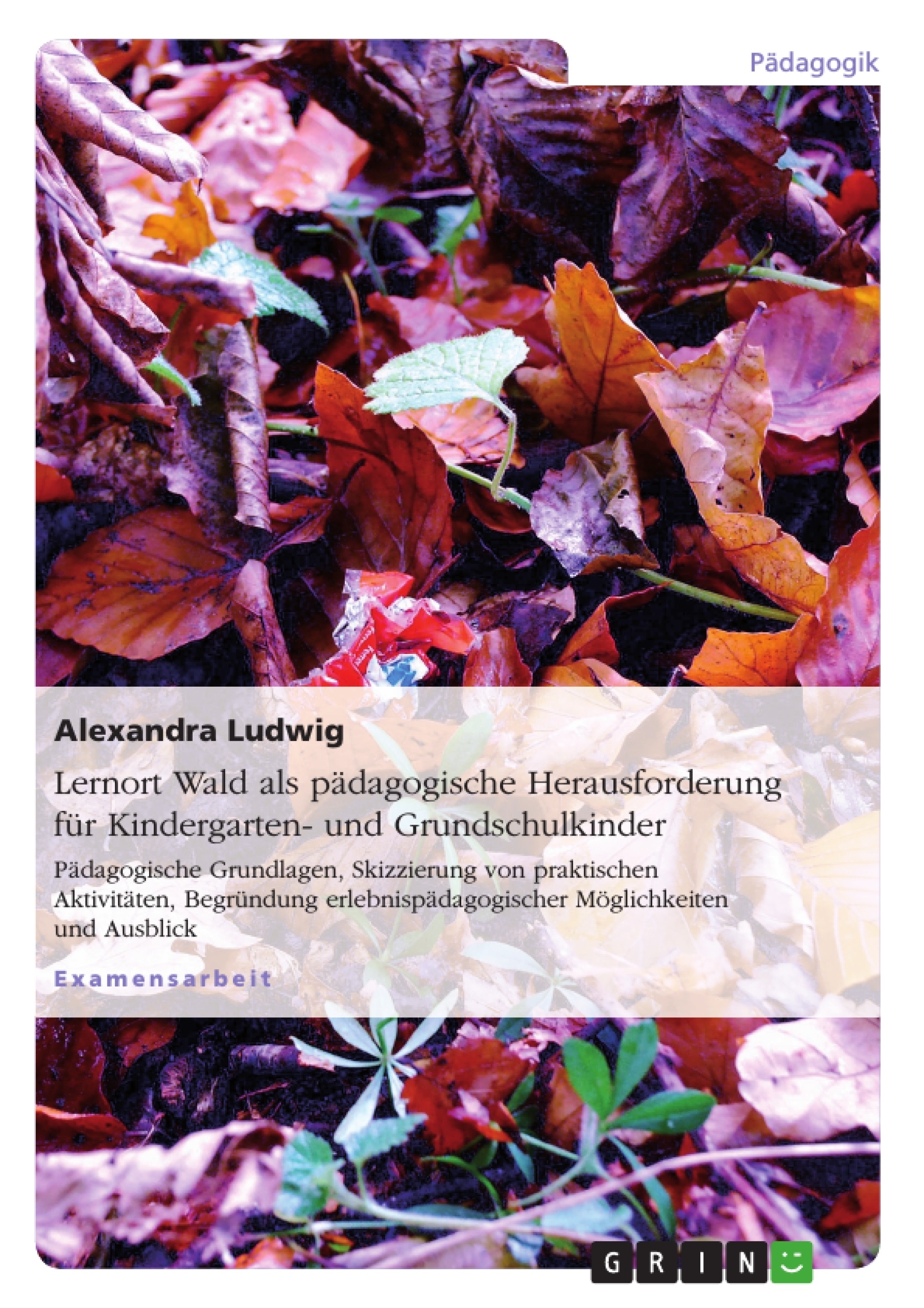Seit Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts lässt sich ein wachsendes Interesse der Bevölkerung am Wald feststellen. Staatliche Organisationen, Verbände, aber auch private Einrichtungen haben sich dieser erhöhten Aufmerksamkeit und Aktivität der Menschen angenommen und versuchen ihr mit der Entwicklung von Informationsmaterialien, der Durchführung von Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen bis hin zur Neugründung von Umweltbildungseinrichtungen gerecht zu werden.
Besonders für Kinder hat der Wald als Lernort an Bedeutung gewonnen. Dies wird unter anderem an den sich seit 1993 in Deutschland rasant entwickelnden Waldkindergärten deutlich. Parallel dazu hat sich die Umweltbildung als fester Bestandteil in den Rahmenrichtlinien der allgemein bildenden Schulen etabliert. Wie auch andere Ziele in der Umweltbildung ist der Wald als Ökosystem seit 1993 als Bildungsauftrag im Niedersächsischen Schulgesetz verankert.
Mit dieser zentralen Stellung des Waldes als Lernort und dem Aufkommen obiger Einrichtungen und Aktivitäten ist zudem eine eigens auf den Wald bezogene Pädagogik entstanden, die Waldpädagogik. Neben dem Ziel, Wissen über den Wald zu vermitteln und dem Umweltschutz zu dienen, prägt der Begriff des Erlebnisses seit einigen Jahren waldpädagogische Einrichtungen und Aktivitäten. Klassische Lehrpfade haben sich zu Walderlebnispfaden, Informationszentren zu Erlebniszentren und Waldschultage zu Walderlebnistagen entwickelt.
Warum konnte sich die Waldpädagogik etablieren und warum gibt es keine Wiesen- oder Meerpädagogik? Warum hat der Wald als Lernort für Kinder an Bedeutung gewonnen? Welche Bedeutung hat das Erlebnis und damit die Erlebnispädagogik für die Waldpädagogik?
Die oben beschriebene Entwicklung lässt auf einen besonderen Bedeutungsgehalt des Waldes für den Menschen schließen. So geht die vorliegende Arbeit besonders zwei Fragestellungen nach: Worin liegt sowohl die Bedeutung des Waldes für den Menschen als auch seine Bedeutung als Gegenstand der Pädagogik? Unter dieser Fragestellung soll genauer geklärt werden, um was für einen Lernort es sich beim Wald handelt, wodurch er sich auszeichnet und warum er für Kinder geeignet ist.
Welche Institutionen gibt es einerseits und welche Aktivitäten andererseits, um Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter im Wald lernen zu lassen?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Wald als Lebensraum
- 1.1. Grundsätzliches
- 1.1.1. Der Begriff des Waldes
- 1.1.2. Die Wälder der Erde
- 1.1.3. Der Wald in Deutschland
- 1.2. Der Wald als Ökosystem
- 1.2.1. Der Stoffkreislauf
- 1.2.2. Der Aufbau des Waldes
- 1.2.3. Die Artenvielfalt im Wald
- 1.3. Die Bedeutung des Waldes für den Menschen
- 1.3.1. Die Geschichte des Waldes
- 1.3.2. Die Bedeutung des Waldes in früherer Zeit
- 1.3.2.1. Die mythische, traditionelle und religiöse Bedeutung des Waldes
- 1.3.3. Die heutige Bedeutung des Waldes
- 1.3.3.1. Der Wald als Wirtschaftsraum
- 1.3.3.2. Der Wald als Erholungsraum
- 1.3.3.3. Der Wald als Schutz unseres Lebensraumes
- 1.3.3.4. Die kulturelle Bedeutung des Waldes
- 1.3.3.5. Gefahren im Wald
- 1.3.4. Neuartige Waldschäden
- 1.3.4.1. Was ist gegen Neuartige Waldschäden zu tun?
- 1.4. Zusammenfassung
- 1.1. Grundsätzliches
- 2. Grundlegung von Wald- und Erlebnispädagogik
- 2.1. Zur Waldpädagogik
- 2.1.1. Die Waldschulbewegung als Ursprung der Waldpädagogik
- 2.1.2. Heutige Gründung von waldpädagogischen Bildungseinrichtungen
- 2.1.3. Der Begriff „Waldpädagogik“
- 2.2. Zur Erlebnispädagogik
- 2.2.1. Zum Wesen des Erlebnisses
- 2.2.2. Abriss der Geschichte der Erlebnispädagogik
- 2.2.3. Das Erscheinungsbild der modernen Erlebnispädagogik
- 2.3. Zum Verhältnis von Wald- und Erlebnispädagogik
- 2.4. Zusammenfassung
- 2.1. Zur Waldpädagogik
- 3. Der Wert des Waldes für Kinder
- 3.1. Die Bedürfnisse der Kinder vor dem Hintergrund der „Veränderten Kindheit“
- 3.1.1. Das Bedürfnis nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit
- 3.1.2. Das Bedürfnis, Erlebtes, Stimmungen und Gefühle auszudrücken
- 3.1.3. Das Bedürfnis nach Freiheit, Grenzen, Selbständigkeit und Verantwortung
- 3.1.4. Das Bedürfnis nach Spannung, Abenteuer und Risiko
- 3.1.5. Das Bedürfnis, mit der Natur verbunden zu sein
- 3.1.6. Das Bedürfnis, herzustellen und zu gestalten
- 3.1.7. Das Bedürfnis zu spielen
- 3.1.8. Das Bedürfnis sich zu bewegen
- 3.1.9. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft
- 3.1.10. Das Bedürfnis, friedlich für sich allein zu sein
- 3.1.11. Das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu verstehen
- 3.1.12. Das Bedürfnis, vielfältig wahrzunehmen
- 3.2. Auswirkungen der mangelnden Bedürfnisbefriedigung
- 3.3. Befriedigung der Bedürfnisse im Wald
- 3.4. Zusammenfassung
- 3.1. Die Bedürfnisse der Kinder vor dem Hintergrund der „Veränderten Kindheit“
- 4. Zur Funktion von Naturerlebnissen in der Kindheit
- 4.1. Definition des Begriffes „Naturerleben“
- 4.2. Die Bedeutung von Naturerlebnissen
- 4.2.1. Die Bedeutung für den Umweltschutz
- 4.3. Flow Learning
- 4.3.1. Wie man Kinder begeistert
- 4.4. Zusammenfassung
- 5. Waldkindergärten in Deutschland
- 5.1. Die Waldkindergartenbewegung
- 5.2. Formen des Waldkindergartens
- 5.3. Konzeptionelle Inhalte und Leitgedanken
- 5.4. Was alles zu einem Waldkindergarten gehört
- 5.4.1. Gesetzliche Grundlagen
- 5.4.2. Die Ausrüstung
- 5.4.3. Verhaltensregeln im Wald
- 5.5. Ein Tag im Waldkindergarten
- 5.6. Einbeziehung walderlebnispädagogischer Aktivitäten in den Waldkindergarten
- 5.6.1. Der Entwicklungsstand des Kindergartenkindes
- 5.6.2. Mögliche Spiele und Aktivitäten mit Waldkindergartenkindern
- 5.7. Der Waldkindergarten und Schulfähigkeit
- 5.8. Zusammenfassung
- 6. Integration walderlebnispädagogischer Aktivitäten in die Grundschule
- 6.1. Der Entwicklungsstand des Grundschulkindes
- 6.2. Funktionen und Organisation der Schule
- 6.3. Mögliche Aktivitäten im Wald
- 6.3.1. Das Waldklassenzimmer
- 6.3.2. Das Waldtheater
- 6.3.3. Der Naturerlebnispfad
- 6.3.4. Die Nachtwanderung
- 6.3.5. Der Walderlebnistag
- 6.4. Mögliche Aktivitäten im Unterricht als Folge von Waldgängen
- 6.5. Zur Praxis der schulischen Umweltbildung
- 6.6. Zusammenfassung
- 7. Ausblick
- 8. Zusammenfassende Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die pädagogischen Möglichkeiten des Lernorts Wald für Kindergarten- und Grundschulkinder. Sie beleuchtet die Bedeutung des Waldes als Lebensraum und Ökosystem und untersucht dessen Wert für die kindliche Entwicklung im Kontext der „Veränderten Kindheit“.
- Die Bedeutung des Waldes als Lernort
- Die Rolle von Wald- und Erlebnispädagogik
- Die Bedürfnisse von Kindern in der heutigen Zeit
- Die Integration walderlebnispädagogischer Aktivitäten in Kindergarten und Grundschule
- Die Förderung von Naturerleben und Umweltschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Darstellung des Waldes als Lebensraum und Ökosystem, wobei die historische und aktuelle Bedeutung für den Menschen hervorgehoben wird. Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen von Wald- und Erlebnispädagogik, wobei die Geschichte und die heutige Bedeutung dieser Konzepte erläutert werden.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Bedürfnissen von Kindern im Kontext der „Veränderten Kindheit“ und zeigt auf, wie der Wald diese Bedürfnisse auf einzigartige Weise erfüllen kann.
Kapitel 4 betrachtet die Bedeutung von Naturerlebnissen in der Kindheit und stellt den „Flow Learning“-Ansatz vor.
Kapitel 5 und 6 behandeln die Integration walderlebnispädagogischer Aktivitäten in Kindergarten und Grundschule.
Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Herausforderungen und Möglichkeiten der Waldpädagogik.
Schlüsselwörter
Waldpädagogik, Erlebnispädagogik, Naturerleben, Umweltschutz, Kindheit, Kinderbedürfnisse, Waldkindergarten, Waldklassenzimmer, Flow Learning, nachhaltige Bildung.
- Quote paper
- Alexandra Ludwig (Author), 2003, Lernort Wald als pädagogische Herausforderung für Kindergarten- und Grundschulkinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24004