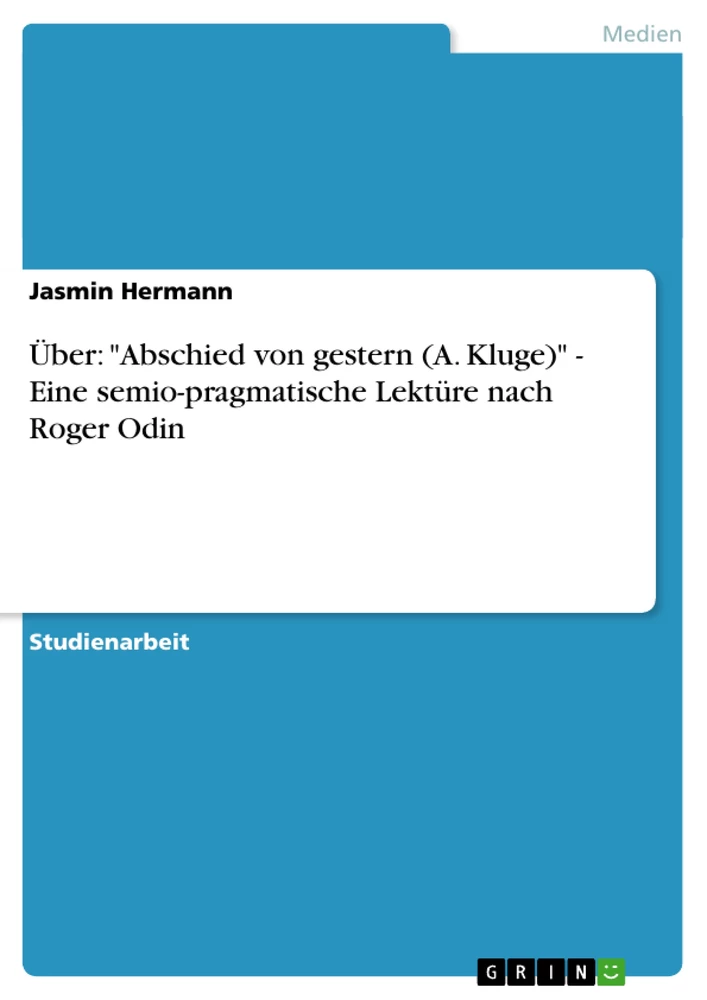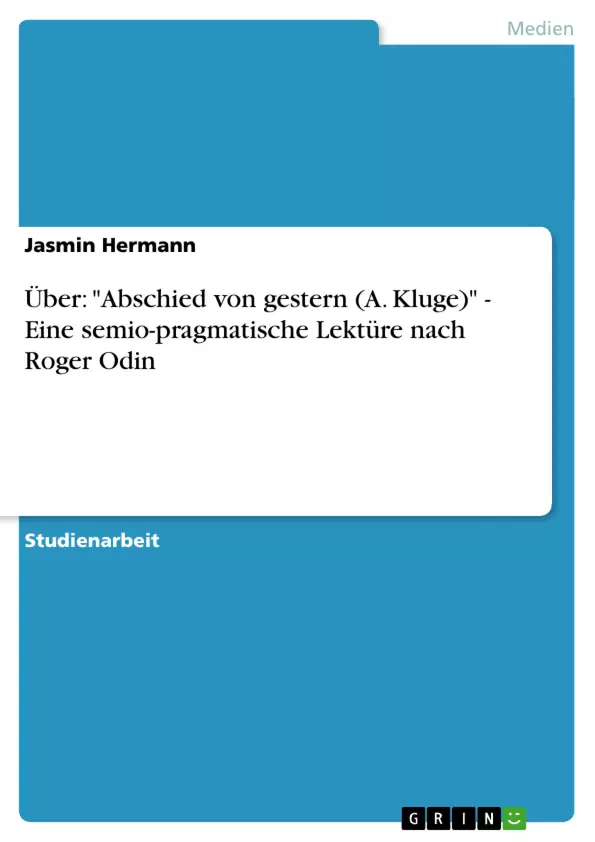Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Figurenkonzeption in Alexander Kluges 1965/66 gedrehtem Film "Abschied von gestern (Anita G.)" erscheint problematisch, überwindet er doch in eigensinniger Vermischung ‘fiktinaler und dokumentarischer Formen’ gängige Genrezuweisungen, bricht Wahrnehmungsmuster und Beschreibungsmodelle auf. Unter dem Etikett des Essayfilms subsumiert, oszillieren die Figuren als markierendes Element von Fiktion und Nicht-Fiktion zwischen Rolle und Selbstdarstellung: Ist der Figuren-begriff für die Nicht-Fiktion dann überhaupt anwendbar? Überzeugen ‘dokumentarische Formen’ nicht gerade durch die Präsenz ‘realer’ Menschen, die Authentizität ‘wirklichen’ Lebens? Wie überhaupt kann ein Nebeneinander von Fiktionalem und Dokumentarischem bestehen und funktionieren, will es sich auf die inhaltliche Präsentation durch Personen in Absetzung zur formalen Ausgestaltung durch dramaturgische und technische Mittel beziehen?
Fragen, die ins Zentrum einer Debatte der Postmoderne über das Wesen und den Status der ‘Bilder des Wirklichen’ weisen, stützen sie doch bedingt den Trugschluß, mit dem die Filmgeschichte einst begann: Der Bestimmung von Nicht-Fiktion und Fiktion, vorstrukturiert durch die angeblich nicht-narrativen, rein abbildenden ‘Protofilme’ der Lumières in Polarisierung zu den filmischen Illusionen eines Méliès; Ausgangspunkt einer Entwicklung, die ihren Höhepunkt früh in der Gleichsetzung von Nicht-Fiktionalem mit Dokumentarfilmen und Fiktionalem mit Spielfilmen fand. Eine Weiterentwicklung blieb aus: Die Marginalisierung des Dokumentarfilms gegenüber dem Sehgewohnheiten prägenden Genre des fiktionalen Films verursachte eine anhaltende Vernachlässigung innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses mit der Folge, daß fast hundert Jahre lang die Natur des Dokumentarischen im Realitätsbezug, in seiner Abbildfunktion von Wirklichkeit zu suchen war. Erst 1988 setzte mit Eva Hohenbergers Dissertation ‘Die Wirklichkeit des Films. Dokumentarfilm. Ethnographischer Film. Jean Rouch’ ein geistiger Kurswechsel in Deutschlands Köpfen ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Fiktion und Nicht-Fiktion - Gedanken zur Geschichte einer begrifflichen Verwirrung
- 1. Ein Rettungsversuch: Roger Odins Theorie der dokumentarisierenden Lektüre
- 1.1 Die Grundlage der dokumentarisierenden und fiktivisierenden Lektüre
- 1.2 Die Anwendung der dokumentarisierenden Lektüre
- 1.3 Die Produktionsmodi der dokumentarisierenden Lektüre
- 2. Reflexion der semio-pragmatischen Kopfprodukte Odins und ihre Bedeutung für eine Figurenanalyse
- 2. Ein Analyseversuch: Roger Odin meets Abschied von gestern (Anita G.)
- 2.1 Filmexterner Produktionsmodus: Das Vorwissen und die Erwartungshaltung des Zuschauers
- 2.1.1 Die Filmtheorie Kluges im Gedenken Adornos
- 2.1.2 Der Einfluß des Klugeschen Gedankenguts auf die Figurenrezeption in Abschied von gestern (Anita G.)
- 2.1.3 Anita G. und institutionelle Anweisungen
- 2.2 Der filmische Text
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Figurenkonzeption in Alexander Kluges Film "Abschied von gestern (Anita G.)" unter Verwendung der semio-pragmatischen Theorie von Roger Odin. Ziel ist es, die spezifischen Herausforderungen der Figurenanalyse in einem Film zu beleuchten, der sowohl fiktionale als auch dokumentarische Elemente integriert.
- Die Verbindung von Fiktion und Nicht-Fiktion in filmischen Erzählungen
- Die Bedeutung der dokumentarisierenden Lektüre nach Roger Odin
- Die Rezeption des Films im Kontext des Vorwissens und der Erwartungshaltung des Zuschauers
- Die Rolle von Figuren als Vermittler von fiktionalen und nicht-fiktionalen Inhalten
- Die Analyse von filmischen Gestaltungsmitteln im Hinblick auf die Figurenkonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Problematik der Abgrenzung zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion im Kontext der Filmgeschichte und untersucht, wie diese Thematik im Werk von Alexander Kluge besonders deutlich wird. Das erste Kapitel stellt Roger Odins Theorie der dokumentarisierenden Lektüre vor, die als analytisches Instrument für die Arbeit dient. Es werden die Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten der Theorie erläutert, sowie die verschiedenen Produktionsmodi der dokumentarisierenden Lektüre, die für die Analyse von Filmen relevant sind.
Das zweite Kapitel wendet Odins Theorie auf Kluges "Abschied von gestern (Anita G.)" an. Es werden zunächst die filmexternen Produktionsmodi, insbesondere das Vorwissen und die Erwartungshaltung des Zuschauers, im Kontext von Kluges Filmtheorie und Adornos "Dialektik der Aufklärung" untersucht. Anschließend wird die textuelle Lektüre des Films beleuchtet, mit dem Fokus auf die Analyse der Figuren und ihre Rolle im filmischen Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Figurenanalyse im Kontext von Fiktion und Nicht-Fiktion, insbesondere in Bezug auf Alexander Kluges "Abschied von gestern (Anita G.)". Die Schlüsselwörter umfassen die semio-pragmatische Theorie von Roger Odin, die dokumentarisierende Lektüre, die Rezeption des Films, die Figurenanalyse, die Filmtheorie Kluges, Adornos "Dialektik der Aufklärung" und die filmischen Gestaltungsmittel.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Roger Odins Theorie der dokumentarisierenden Lektüre?
Odin postuliert, dass die Einordnung eines Films als „dokumentarisch“ oder „fiktional“ primär durch die Rezeptionshaltung des Zuschauers (die Lektüre) und nicht nur durch formale Merkmale bestimmt wird.
Wie vermischt Alexander Kluge Fiktion und Dokumentation?
In seinem Film „Abschied von gestern“ nutzt Kluge essayistische Formen, in denen reale Menschen und fiktive Rollen oszillieren, um gängige Wahrnehmungsmuster aufzubrechen.
Wer ist die Figur Anita G.?
Anita G. ist die Protagonistin des Films, die als markierendes Element zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion steht und die Schwierigkeiten der individuellen Freiheit in einer starren Gesellschaft verkörpert.
Welchen Einfluss hatte Adorno auf Alexander Kluge?
Kluges Filmtheorie ist stark von der Kritischen Theorie Adornos geprägt, insbesondere hinsichtlich der Reflexion über die „Dialektik der Aufklärung“ und die Kritik an der Kulturindustrie.
Was ist ein „Essayfilm“?
Ein Essayfilm ist ein Genre, das sich der klaren Zuweisung als Spiel- oder Dokumentarfilm entzieht und stattdessen subjektive Reflexionen mit verschiedenen filmischen Formen mischt.
- Arbeit zitieren
- Jasmin Hermann (Autor:in), 2000, Über: "Abschied von gestern (A. Kluge)" - Eine semio-pragmatische Lektüre nach Roger Odin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24169