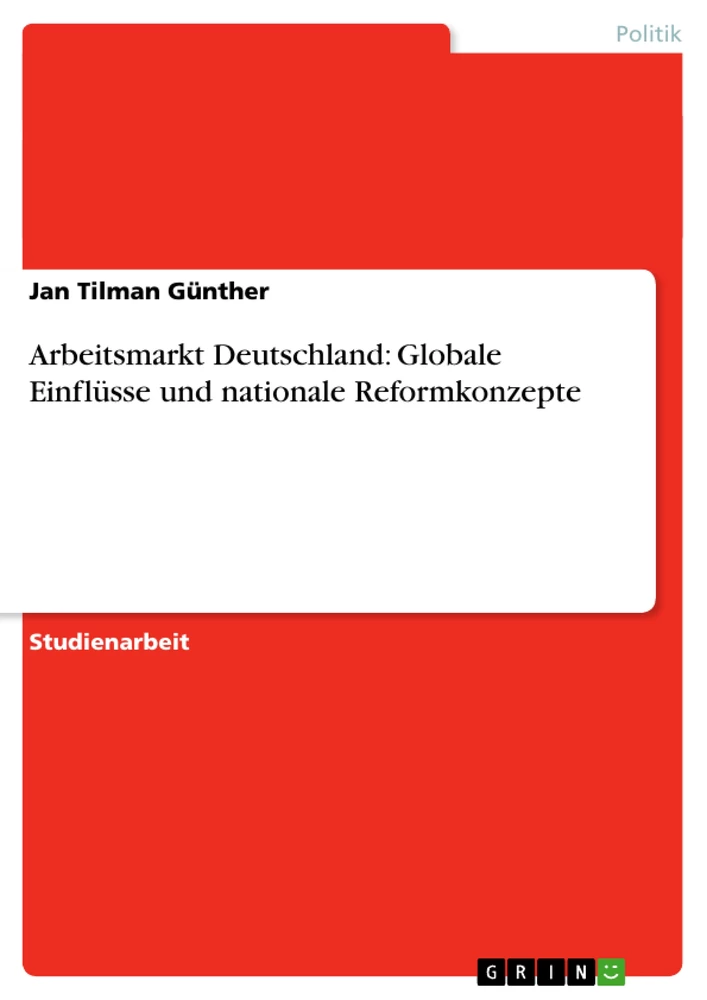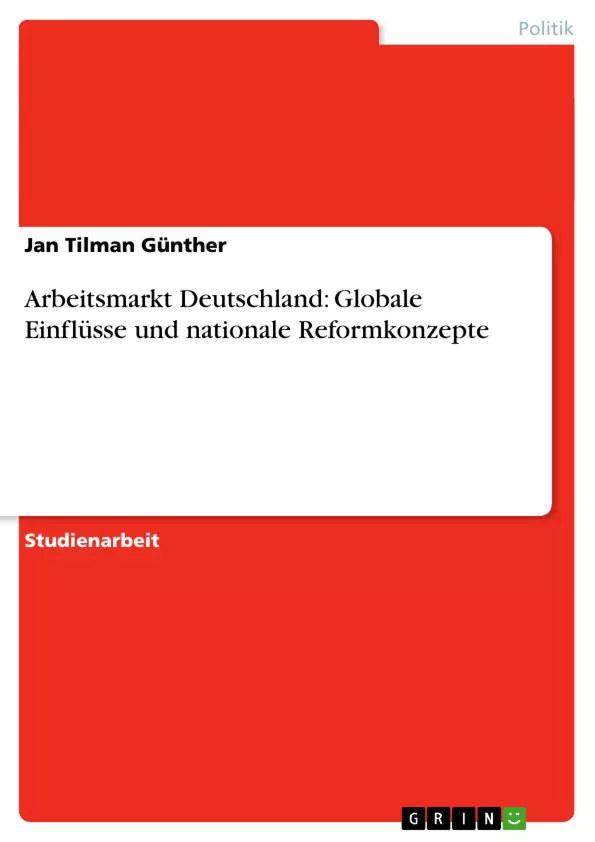[...] Dieser kurze Aufriss skizziert den Rahmen, auf den die Fragestellung der
vorliegenden Arbeit aufbaut. Ausgehend von der aktuellen Entwicklung von Quantität und Qualität der (Erwerbs-)
Arbeit, soll nach Ursachen der anhaltende Massenarbeitslosigkeit in Deutschland
gefragt werden. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der globalen
Transformation der Wirtschaft und dem nationalen Arbeitsmarkt? Welche Konzepte
werden gegenwärtig zur Lösung der Beschäftigungskrise verfolgt und wie sind diese
Konzepte vor dem Hintergrund der Globalisierung zu bewerten? Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden auf der Folie der fordistischen
Normalität der westlichen Industrienationen aus dem „Goldenen Zeitalter“ des
Kapitalismus (Eric Hobsbawm) die globalen Transformationsprozesse des Handels,
der Arbeits- und Finanzwelt sowie der Politik im Überblick dargestellt. Diese
Prozesse können im Rahmen dieser Arbeit in ihrer Komplexität nur skizziert werden.
Dennoch wird der Versuch unternommen, die Perspektive von den nationalen
Gegebenheiten des Arbeitsmarktes auf die globalen Transformationen zu erweitern.
Hier sind in Teilen die Ursachen des Problems wie auch mögliche Ansätze für
Lösungsstrategien zu suchen. Die rein nationale Betrachtung des Arbeitsmarktes
liefe nicht nur im Sinn des Seminarthemas in die falsche Richtung. Angesichts
wachsender weltwirtschaftlicher Verflechtungen und einer zunehmenden
Internationalisierung der Politik soll eine globale Perspektive im Hinblick auf nationale
Arbeitsmarktprobleme eröffnet werden. Dennoch soll nicht nach den Entwicklungen eines möglichen „globalen
Arbeitsmarktes“ gefragt werden. Im zweiten Teil der Arbeit verengt sich der Blick auf
den deutschen Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen
Entwicklung werden die aktuellen Reformansätze, insbesondere das „Hartz-
Konzept“, hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken kritisch untersucht.
Da sich die Zukunft nicht empirisch messen lässt, kann in diesem Anschnitt der
Arbeit kaum auf analytische Daten zurückgegriffen werden. Vielmehr sollen die
Reformansätze deskriptiv reflektiert und unter normativen Gesichtspunkten bewertet
werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Globale Transformation der Wirtschaft und strukturelle Transformation der Arbeitswelt
- Das fordistische Normalarbeitsverhältnis
- Strukturwandel der fordistischen Industriegesellschaft
- Wandel der Weltwirtschaft
- Technischer Wandel
- Beschäftigungswirkungen der Globalisierung
- Arbeitsmarkt in Deutschland: Situation und Reformansätze
- Aktuelle Reformentwürfe: Das Hartz-Konzept
- Job-Center
- Zeit- und Leiharbeit: Personal Service Agenturen
- Arbeitslosengeld II
- Mini-Jobs und Ich-AGS
- Die Neue Zumutbarkeit
- Alternativen der Beschäftigungspolitik
- Aktuelle Reformentwürfe: Das Hartz-Konzept
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Ursachen der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit in Deutschland im Kontext der globalen Transformation der Wirtschaft. Dabei wird der Zusammenhang zwischen der globalen Entwicklung und dem nationalen Arbeitsmarkt beleuchtet. Die Arbeit analysiert aktuelle Reformkonzepte zur Lösung der Beschäftigungskrise, insbesondere das Hartz-Konzept, und bewertet diese vor dem Hintergrund der Globalisierung.
- Globale Transformationsprozesse der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt
- Strukturwandel der Arbeitswelt und das fordistische Normalarbeitsverhältnis
- Die Rolle des technologischen Wandels in der Arbeitsmarktentwicklung
- Reformprozesse des deutschen Arbeitsmarktes, insbesondere das Hartz-Konzept
- Bewertung der Reformansätze im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland im Kontext der Globalisierung dar. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodischen Ansätze der Arbeit.
- Globale Transformation der Wirtschaft und strukturelle Transformation der Arbeitswelt: Dieses Kapitel analysiert die globalen Transformationsprozesse im Handel, in der Arbeitswelt und in der Finanzwelt. Es beleuchtet den Wandel des fordistischen Normalarbeitsverhältnisses und die Bedeutung des technischen Wandels für die Beschäftigungssituation.
- Arbeitsmarkt in Deutschland: Situation und Reformansätze: Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen Situation des deutschen Arbeitsmarktes und analysiert die Reformansätze, insbesondere das Hartz-Konzept. Es beleuchtet verschiedene Elemente des Hartz-Konzepts und deren Auswirkungen auf die Arbeitsmarktlage.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Globalisierung, Arbeitsmarkt, Massenarbeitslosigkeit, Strukturwandel, fordistisches Normalarbeitsverhältnis, technologischer Wandel, Reformprozesse, Hartz-Konzept, Beschäftigungspolitik. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen der globalen Wirtschaft und dem deutschen Arbeitsmarkt, analysiert aktuelle Reformansätze und bewertet diese im Kontext der Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für Massenarbeitslosigkeit in Deutschland?
Ursachen liegen im Strukturwandel der Industriegesellschaft, dem technologischen Wandel und der globalen Transformation der Finanz- und Arbeitsmärkte.
Was versteht man unter dem 'fordistischen Normalarbeitsverhältnis'?
Es bezeichnet ein unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges Vollzeit-Arbeitsverhältnis, das im 'Goldenen Zeitalter' des Kapitalismus der Standard war.
Was ist das Kernziel des Hartz-Konzepts?
Das Ziel war die Senkung der Arbeitslosigkeit durch eine Reform der Arbeitsvermittlung, die Einführung von Mini-Jobs und die Aktivierung von Arbeitslosen ('Fordern und Fördern').
Welche Rolle spielt die Globalisierung für den Arbeitsmarkt?
Globalisierung führt zu internationalem Wettbewerbsdruck, Standortverlagerungen und erfordert neue Qualifikationen sowie flexiblere Beschäftigungsformen.
Was sind Personal Service Agenturen (PSA)?
Ein Element der Hartz-Reformen, das Arbeitslose mittels Leiharbeit schneller wieder in den ersten Arbeitsmarkt integrieren sollte.
- Arbeit zitieren
- Jan Tilman Günther (Autor:in), 2004, Arbeitsmarkt Deutschland: Globale Einflüsse und nationale Reformkonzepte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24225