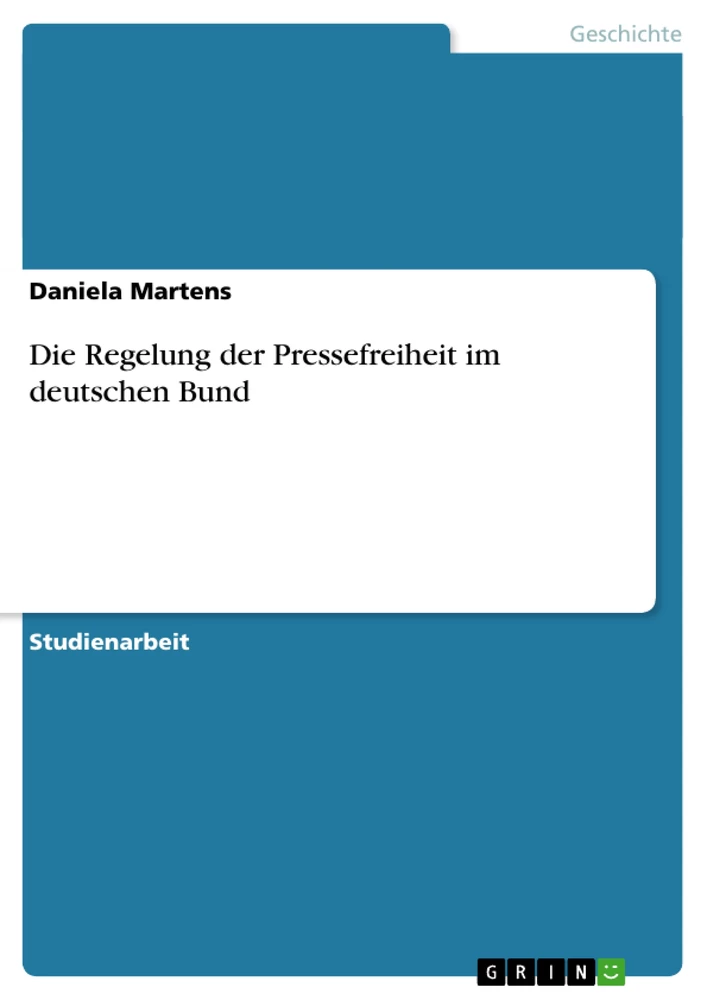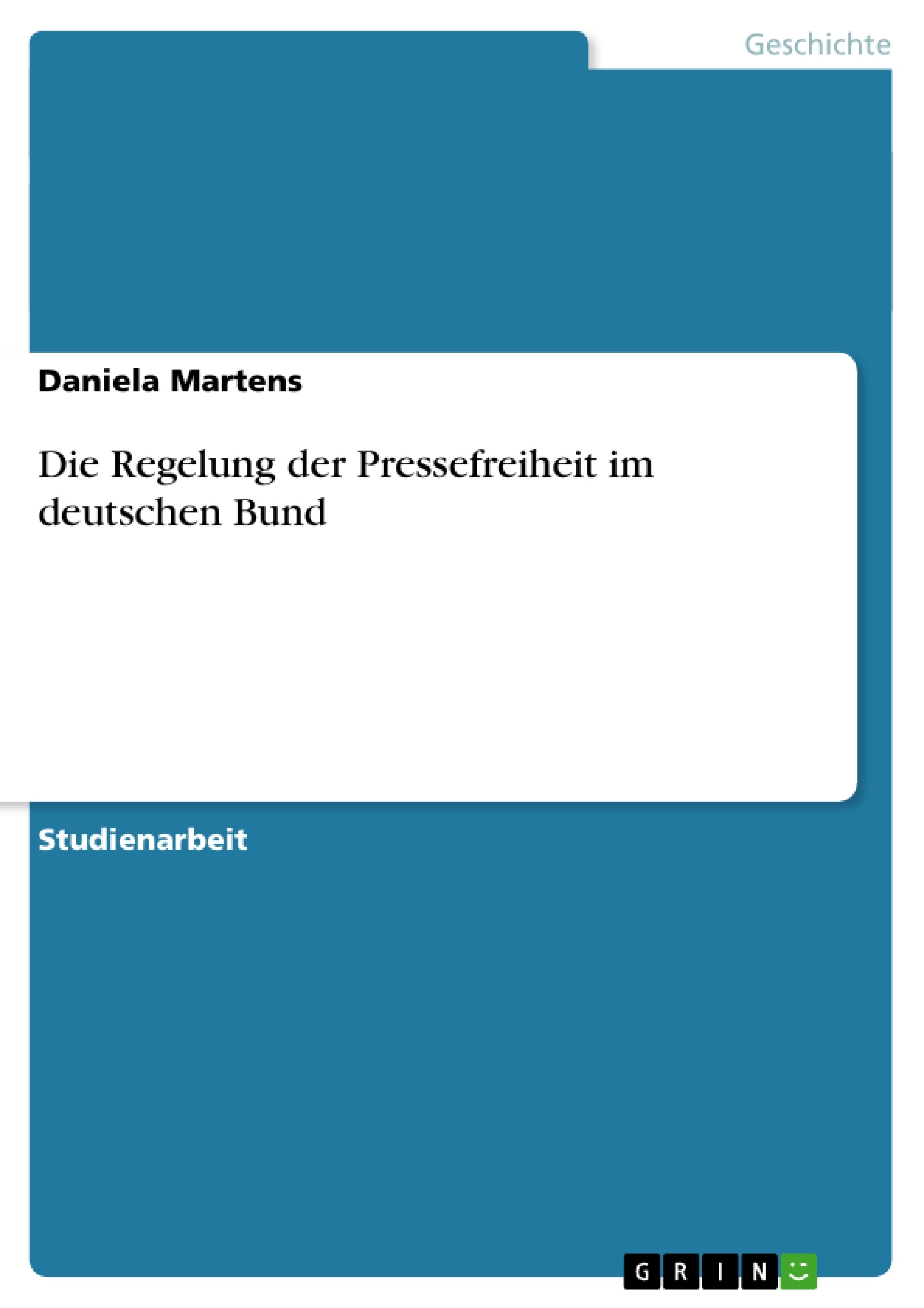Der Innenpolitik des Deutschen Bundes ging es vor allem um die Zurückweisung der liberalen und konstitutionellen Bewegungen. Eins der zentralen Elemente dabei war die Überwachung der Presse. Ausgehend von einer Definition der Pressefreiheit zeigt diese Arbeit, wie sich die Kontrolle sowohl auf der Ebene der Legislative, als auch auf der der Exekutive manifestierte und wie diese beiden miteinander verbunden waren. Außerdem wird das direkte Verhältnis zwischen den einschneidenden politischen Ereignisse wie dem Mord an Kotzebue und den Unruhen um 1832 und 1848 und der Pressegesetzgebung beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PRESSEFREIHEIT IN DEUTSCHLAND
- DIE GESETZLICHEN PRESSEREGELUNGEN IM DEUTSCHEN BUND
- DIE BUNDESAKTE
- DAS BUNDES-PREẞGESETZ ALS ERGEBNIS DER KARLSBADER BESCHLÜSSE
- Durchführung der Regelung
- Die Preußische Zensur-Verordnung
- Die Preẞkommission
- VERSCHÄRFUNG DER ZENSUR 1832/33. DIE 10 ARTIKEL
- VON DER FREIHEIT DER REVOLUTION ZU NEUER ZENSUR: PRESSEGESETZGEBUNG IN DEN SPÄTEN JAHREN DES DEUTSCHEN BUNDES
- REVOLUTION 1848: AUFHEBUNG DER ZENSUR
- ERNEUTE VERSCHÄRFUNG DER PRESSEGESETZE
- DIE REALITÄT DER UMSETZUNG UND ANWENDUNG DER PRESSEGESETZE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kontrolle der Presse im Deutschen Bund, insbesondere die Gesetzgebung und deren Umsetzung auf legislativer und exekutiver Ebene. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen politischen Ereignissen wie dem Mord an Kotzebue und den Unruhen von 1832/1848 und der Entwicklung der Pressegesetze. Die Analyse basiert auf einer Definition von Pressefreiheit und greift auf relevante Quellen und Sekundärliteratur zurück.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Pressefreiheit“ im 19. Jahrhundert
- Gesetzgebung zur Presse im Deutschen Bund: Bundesakte und Bundes-Pressegesetz
- Einfluss politischer Ereignisse auf die Pressegesetzgebung
- Zusammenspiel von Legislative und Exekutive bei der Kontrolle der Presse
- Umsetzung und Anwendung der Pressegesetze in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Pressezensur im Deutschen Bund als zentrales Element der Innenpolitik. Sie skizziert die Methodik, die auf Quellen von Ernst Huber und Lothar Gall basiert, und benennt die zentralen Forschungsfragen, die sich mit der Gesetzgebung und deren Umsetzung sowie deren Kontextualisierung durch politische Ereignisse befassen. Die Einleitung verweist auf die Notwendigkeit, Pressefreiheit im historischen Kontext zu definieren und zu analysieren.
2. Pressefreiheit in Deutschland: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Pressefreiheit“ im historischen Kontext und zeigt dessen Entwicklung. Es wird deutlich, dass die „Pressefreiheit“ im frühen 19. Jahrhundert breiter gefasst war als heute und die gesamte Kommunikation umfasste. Das Kapitel beschreibt die Politisierung der öffentlichen Meinung und die zunehmende Schriftzensur, während gleichzeitig die Praxis der Meinungsfreiheit im Alltag verankert war. Die napoleonische Herrschaft wird als Vorbild für spätere Zensurregelungen genannt, und die Verknüpfung von Pressefreiheit mit dem Streben nach Parlamentarismus wird hervorgehoben.
3. Die gesetzlichen Presseregelungen im Deutschen Bund: Dieses Kapitel analysiert die gesetzlichen Regelungen zur Presse im Deutschen Bund. Es beginnt mit der Bundesakte von 1815, die zwar die Pressefreiheit anspricht, aber keine konkreten Regelungen enthält. Der Fokus liegt dann auf dem Bundes-Pressegesetz von 1819, das als Ergebnis der Karlsbader Beschlüsse entstand und eine Vorzensur für Schriften einführte. Das Kapitel analysiert die Hintergründe und die Auswirkungen dieses Gesetzes und setzt es in den Kontext der politischen Ereignisse der Zeit, insbesondere des Mordes an Kotzebue. Die widersprüchliche Auslegung der „Pressefreiheit“ in der Bundesakte und ihre praktische Einschränkung durch Zensur werden behandelt.
4. Von der Freiheit der Revolution zu neuer Zensur: Pressegesetzgebung in den späten Jahren des Deutschen Bundes: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Pressegesetzgebung während und nach der Revolution von 1848. Es beschreibt die kurzzeitige Aufhebung der Zensur und die anschließende erneute Verschärfung der Pressegesetze, analysiert die Gründe hierfür und die Auswirkungen auf die Praxis der Pressefreiheit im Deutschen Bund. Die Analyse befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen revolutionären Forderungen nach Freiheit und den Bestrebungen der konservativen Kräfte, die Kontrolle über die öffentliche Meinung zu behalten.
Schlüsselwörter
Pressefreiheit, Deutscher Bund, Zensur, Pressegesetzgebung, Karlsbader Beschlüsse, Bundesakte, Metternich, Kotzebue, Revolution 1848, öffentliche Meinung, Legislativ, Exekutive.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Pressefreiheit im Deutschen Bund
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Pressefreiheit und die Pressegesetzgebung im Deutschen Bund des 19. Jahrhunderts. Es analysiert die gesetzlichen Regelungen, deren Umsetzung und den Einfluss politischer Ereignisse auf die Entwicklung der Pressezensur.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Definition und Entwicklung des Begriffs „Pressefreiheit“ im 19. Jahrhundert, die gesetzlichen Regelungen im Deutschen Bund (Bundesakte, Bundes-Pressegesetz), den Einfluss politischer Ereignisse wie der Mord an Kotzebue und die Revolution von 1848 auf die Pressegesetzgebung, das Zusammenspiel von Legislative und Exekutive bei der Kontrolle der Presse sowie die praktische Umsetzung und Anwendung der Pressegesetze.
Welche Quellen werden im Dokument verwendet?
Die Analyse basiert auf einer Definition von Pressefreiheit und greift auf relevante Quellen und Sekundärliteratur zurück, wobei Quellen von Ernst Huber und Lothar Gall explizit genannt werden.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Es untersucht die Pressefreiheit im Deutschen Bund in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der Bundesakte und dem Bundes-Pressegesetz, über die Auswirkungen des Mordes an Kotzebue und der Revolution von 1848 bis zur Praxis der Zensur.
Welche Rolle spielte die Bundesakte von 1815?
Die Bundesakte von 1815 sprach zwar die Pressefreiheit an, enthielt aber keine konkreten Regelungen. Dieser scheinbare Widerspruch zwischen der deklaratorischen Freiheit und der faktischen Zensur wird im Dokument analysiert.
Welche Bedeutung hatten die Karlsbader Beschlüsse?
Die Karlsbader Beschlüsse führten zum Bundes-Pressegesetz von 1819, das eine Vorzensur für Schriften einführte. Das Dokument analysiert die Hintergründe und Auswirkungen dieses Gesetzes im Kontext des Mordes an Kotzebue.
Wie wirkte sich die Revolution von 1848 auf die Pressefreiheit aus?
Die Revolution von 1848 führte zu einer kurzzeitigen Aufhebung der Zensur. Das Dokument analysiert die anschließende erneute Verschärfung der Pressegesetze und die Gründe hierfür, beleuchtend das Spannungsfeld zwischen revolutionären Forderungen nach Freiheit und konservativen Bestrebungen zur Kontrolle der öffentlichen Meinung.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Dokument relevant?
Schlüsselbegriffe sind Pressefreiheit, Deutscher Bund, Zensur, Pressegesetzgebung, Karlsbader Beschlüsse, Bundesakte, Metternich, Kotzebue, Revolution 1848, öffentliche Meinung, Legislative und Exekutive.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik basiert auf einer historischen Analyse der Gesetzgebung und deren Umsetzung auf legislativer und exekutiver Ebene. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen politischen Ereignissen und der Entwicklung der Pressegesetze und bezieht eine historisch kontextualisierte Definition von Pressefreiheit mit ein.
- Arbeit zitieren
- Daniela Martens (Autor:in), 2004, Die Regelung der Pressefreiheit im deutschen Bund, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24247