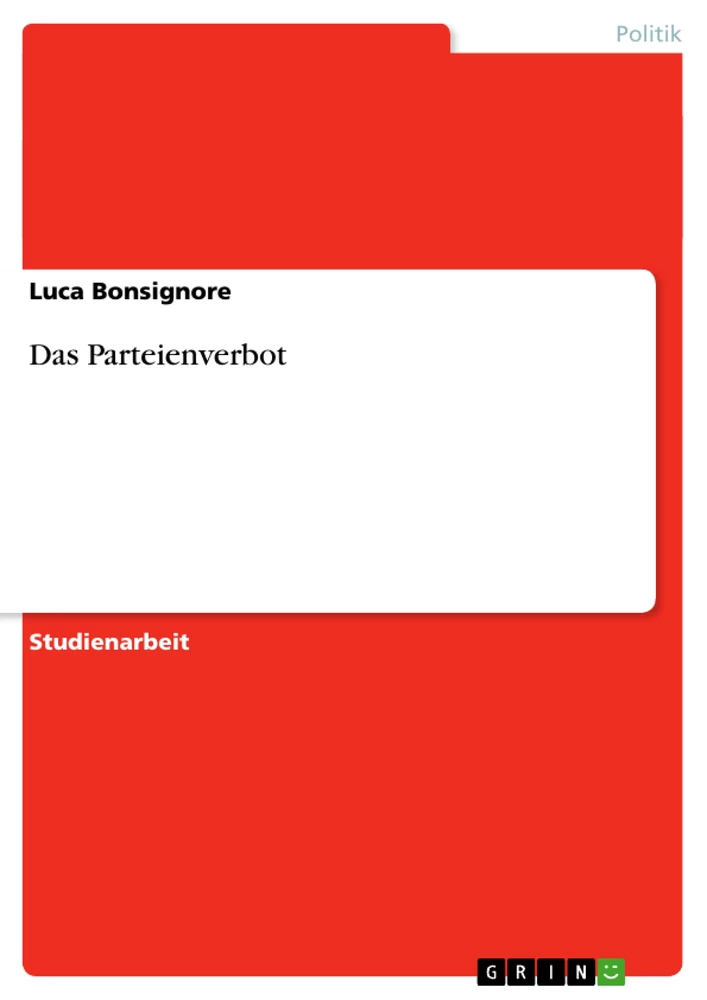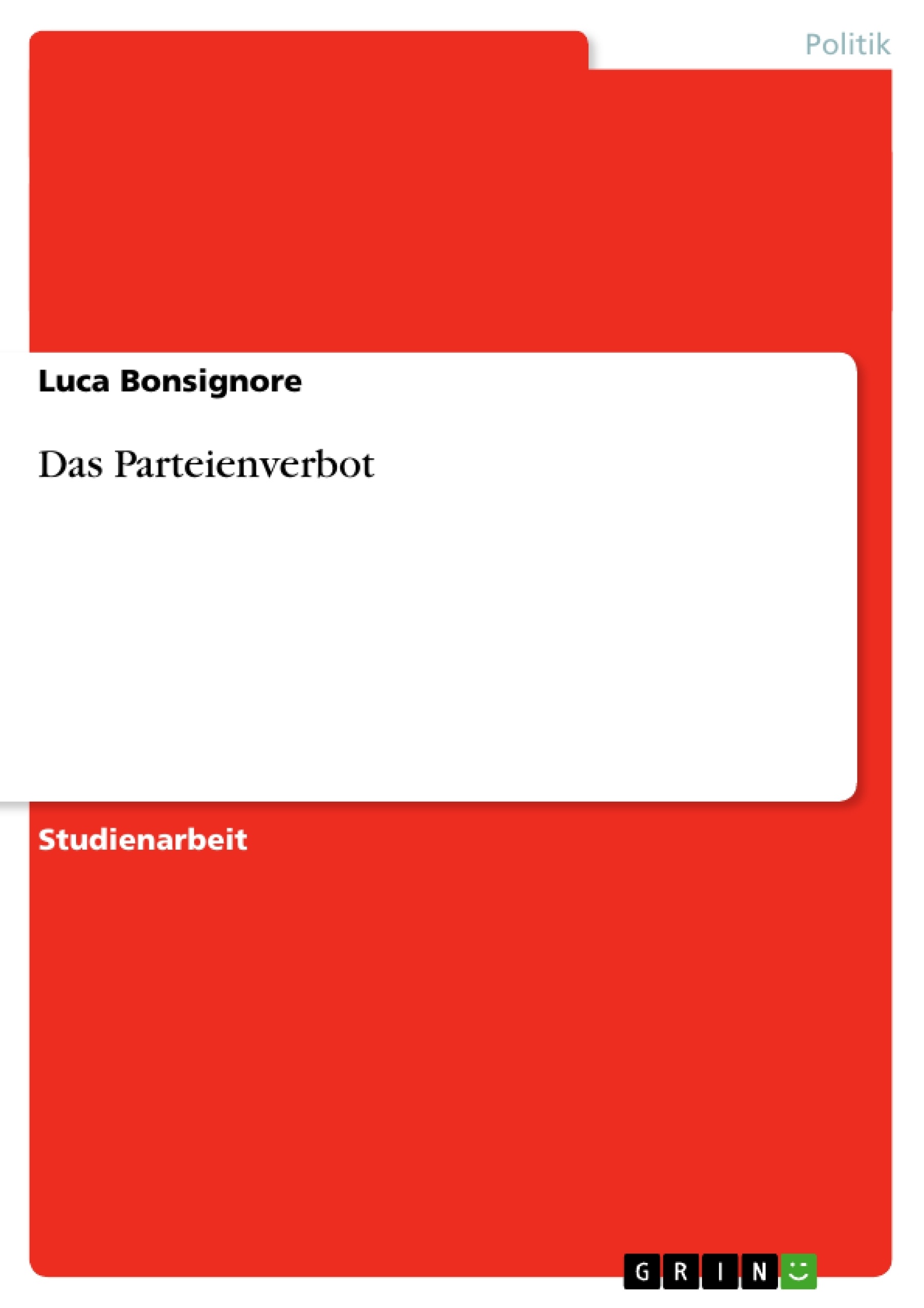Die Bestimmung des Grundgesetzes in Artikel 21, Abs. 2, wonach Parteien, die die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen versuchen, verboten werden können, läßt sich nur vor dem Hintergrund der spezifischen Erfahrungen aus der Weimarer Republik verstehen. 1
Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 2 (sogenannte Weimarer Reichsverfassung - WRV -) enthielt keine Regelung über die Stellung und Aufgaben der Parteien im Staat. 3 Lediglich in Art. 130 WRV, wonach die Beamten Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei sind, werden die politischen Parteien in einem eher negativen Sinn erwähnt. 4 Der Verfassungsgeber und der einfache Gesetzgeber der Weimarer Zeit haben die Parteien weitgehend ignoriert. 5 Auf diese Tatsache hat schon in der Weimarer Zeit Gustav Radbruch hingewiesen. Die Vernachlässigung der Entwicklung der politischen Parteien in der Reichsverfassung entspreche nicht den wirklichen Gegebenheiten im Verfassungsleben. 6 In der Tat hat die Weimarer Reichsverfassung durch die Einführung des parlamentarischen Regierungssystem 7 und des Verhältniswahlrechts 8 die konstitutionellen Voraussetzungen für ein politisches System geschaffen, das auf der Wirksamkeit der Parteien beruhte. Die Weimarer Verfassung enthielt darüber hinaus auch keine spezielle Regelung was das Parteienverbot betraf.
Von 1933 an bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es keine legalen Parteitätigkeit in Deutschland mehr. Die politischen Parteien wurden entweder verboten 9 oder hatten sich selbst aufgelöst. 10 Die NSDAP, die danach die einzige in Deutschland bestehende Partei war, kann nicht als politische Partei im eigentlichen Sinn bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hintergrund
- 2. Rechtslage
- 3. Juristisch
- 4. Probleme
- 5. Verbotspraxis
- a. Verbot der Sozialistische Reichspartei (SRP)
- 6. Kontroversen
- 7. Schlußfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht das Verbot von Parteien in Deutschland, insbesondere im Kontext des Artikels 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Er analysiert die historische Entwicklung des Parteiverbots, die rechtlichen Grundlagen, die juristische Praxis und die damit verbundenen Probleme und Kontroversen.
- Die historische Entwicklung des Parteiverbots in Deutschland
- Die rechtlichen Grundlagen des Parteiverbots im Grundgesetz
- Die juristische Praxis des Parteiverbots und ihre Anwendung
- Die Probleme und Kontroversen im Zusammenhang mit dem Parteiverbot
- Die Bedeutung des Parteiverbots für die freiheitliche demokratische Grundordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hintergrund
Dieses Kapitel untersucht den historischen Kontext des Parteiverbots in Deutschland, indem es die Situation in der Weimarer Republik und die fehlende Regelung von Parteien im damaligen Verfassungsrecht beleuchtet. Es betont, dass die Weimarer Verfassung, trotz der Einführung des parlamentarischen Systems und des Verhältniswahlrechts, keine spezifische Regelung für das Parteienverbot enthielt.
2. Rechtslage
Dieses Kapitel erläutert die verfassungsrechtliche Verankerung der politischen Parteien im Grundgesetz, insbesondere Artikel 21 Absatz 2, der die Voraussetzungen für ein Parteienverbot festlegt. Es hebt die Bedeutung dieses Artikels für die Anerkennung und Regulierung von politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland hervor.
3. Juristisch
Dieses Kapitel behandelt die juristischen Aspekte des Parteiverbots, die Definition von Verfassungswidrigkeit und die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Theorie und politischen Zielen einer Partei. Es erläutert die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Entscheidung über ein Parteienverbot und die rechtlichen Folgen eines Verbots.
4. Probleme
Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung des Parteiverbots ergeben, insbesondere die Schwierigkeit, Verfassungswidrigkeit anhand von Parteiprogrammen zu erkennen. Es beleuchtet die Rolle der Verfassungsschutzbehörden bei der Überwachung von Parteien und die potenziellen Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch die Anwendung des Parteiverbots.
5. Verbotspraxis
Dieses Kapitel stellt die Geschichte der Anwendung des Parteiverbots in Deutschland vor, wobei es die Fälle der Sozialistischen Reichspartei (SRP) und der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) im Detail betrachtet. Es beleuchtet die Gründe für diese Verbote und die politischen und gesellschaftlichen Folgen.
Schlüsselwörter
Parteiverbot, Grundgesetz, Artikel 21, freiheitliche demokratische Grundordnung, Verfassungswidrigkeit, Bundesverfassungsgericht, Weimarer Republik, Sozialistische Reichspartei (SRP), Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), Verfassungsschutz, Rechtsschutz, Demokratie, politische Parteien, Rechtsprechung, politische Ideologie, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Auf welcher Rechtsgrundlage basiert das Parteiverbot in Deutschland?
Das Parteiverbot ist in Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes verankert. Es richtet sich gegen Parteien, die die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen.
Warum gab es in der Weimarer Republik kein Parteiverbot?
Die Weimarer Reichsverfassung ignorierte Parteien weitgehend und enthielt keine speziellen Regelungen zu deren Verbot, was als eine der Schwächen der damaligen Demokratie gilt.
Wer entscheidet über ein Parteiverbot?
In der Bundesrepublik Deutschland liegt die alleinige Entscheidungsgewalt beim Bundesverfassungsgericht.
Welche Parteien wurden in der Geschichte der BRD bereits verboten?
Die Arbeit nennt als prominente Beispiele das Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) und der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).
Welche Rolle spielt der Verfassungsschutz beim Parteiverbot?
Der Verfassungsschutz überwacht potenziell verfassungswidrige Parteien und liefert das Beweismaterial, das für ein Verbotsverfahren vor Gericht notwendig ist.
- Arbeit zitieren
- Luca Bonsignore (Autor:in), 2000, Das Parteienverbot, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24274