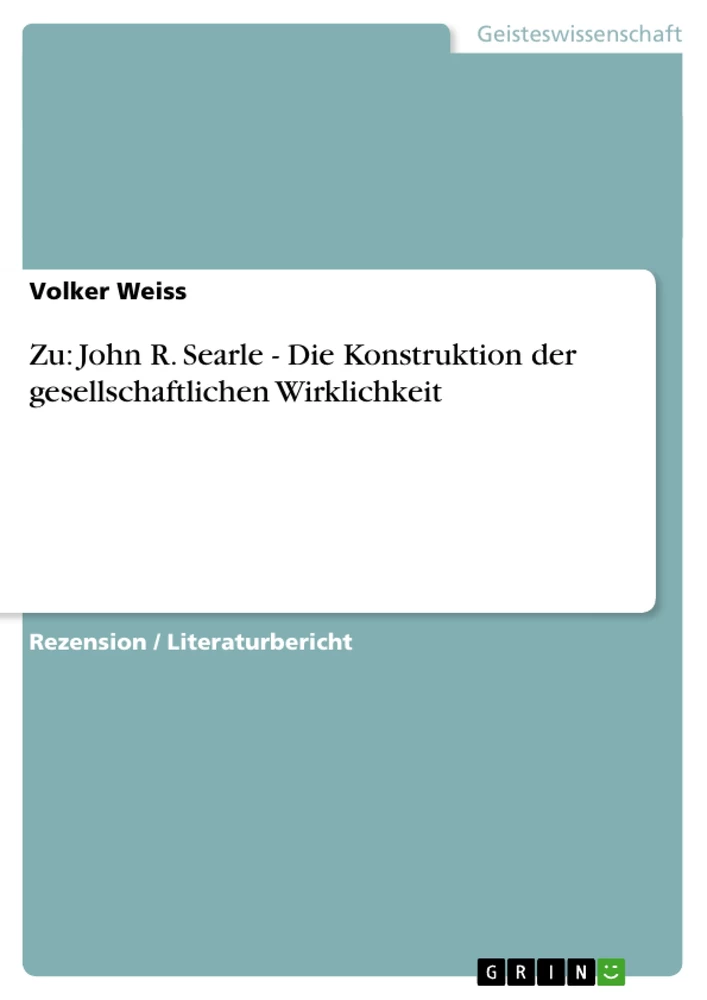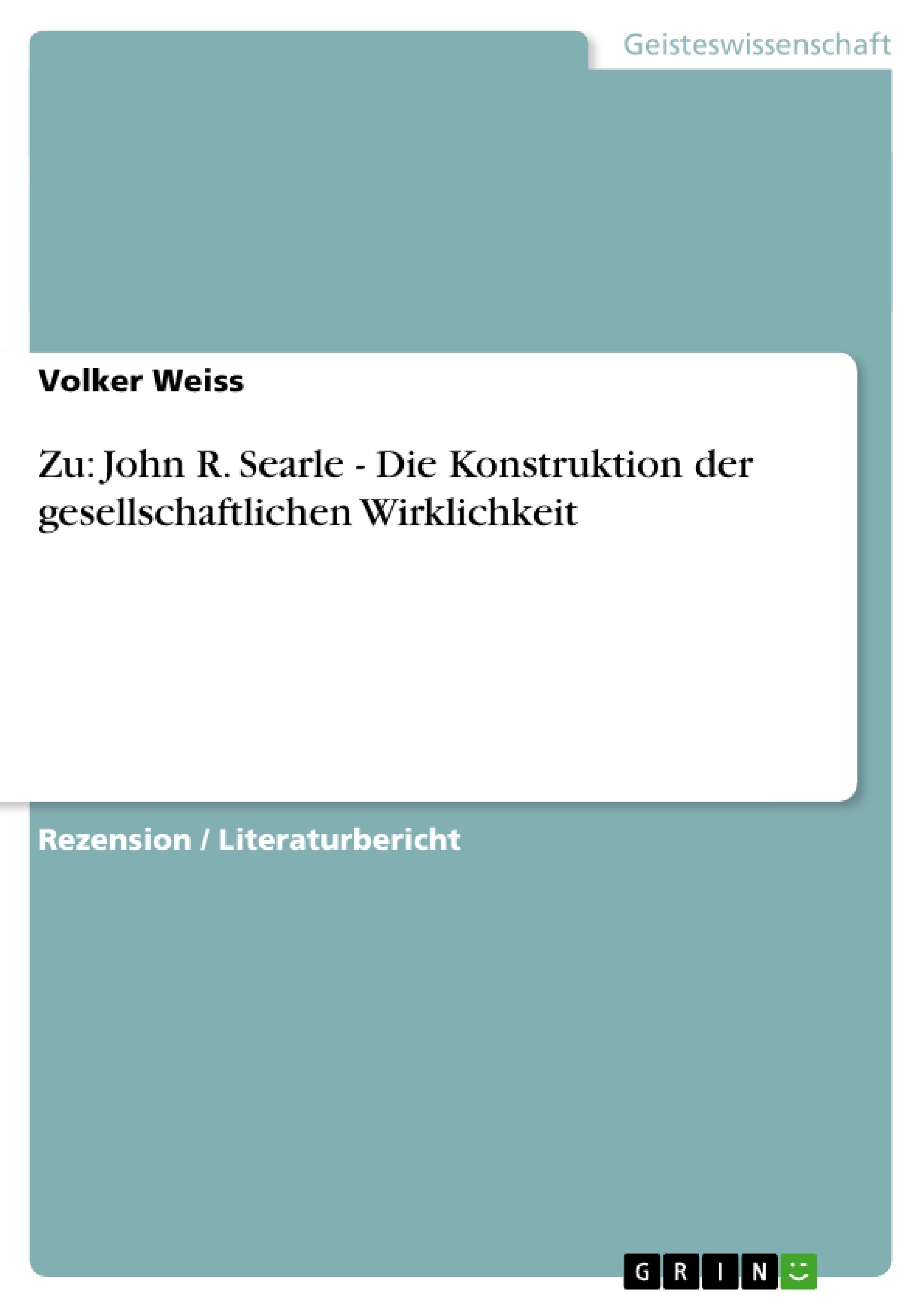In seinem Buch „Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit“ behandelt der Autor Searle das Problem der Objektivität von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Besondere Aufmerksamkeit richtet Searle auf die Anteile der Gesellschaft, die nur aufgrund gemeinsamer Absprachen existieren.
Dabei geht er über die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Beschreibung unserer Welt hinaus, indem er vielschichtige Zusammenhänge aufdeckt, die nicht durch die Physik, Chemie und andere Naturwissenschaften eindeutig erklärbar sind. Für Searle ist der Realismus, also die Vorstellung einer real existierenden, von unserem Bewusstsein unabhängigen Welt, sowie die Korrespondenztheorie der Wahrheit eine grundsätzliche Bedingung f ür jede Wissenschaft, insbesondere für jede Philosophie.
In seiner Einführung benennt Searle als einen Ausgangspunkt seiner Untersuchung die Theorie der Sprechakte zur Beantwortung der Grundfrage, wie und in welchem Verhältnis die unterschiedlichen Teile der Welt ineinander greifen, zueinander stehen.
Searle unterscheidet zwischen der geistigen und der physischen Wirklichkeit. Damit stellt sich für ihn die Frage, wie geistige Phänomene in einer auf physikalischen Begebenheiten beruhenden Welt existieren können. Für die Untersuchung der gesellschaftlichen Wirklichkeit konkretisiert er diese geistigen Phänomene durch gesellschaftliche Begriffe, wie z.B. Staatssysteme, Ehe, Wahlen, etc.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bausteine der gesellschaftlichen Wirklichkeit
- Institutionelle Tatsachen und rohe Tatsachen
- Wie sieht die Struktur institutioneller Tatsachen aus?
- Elementare Eigenschaften der Ontologie
- Objektivität und unsere gegenwärtige Weltsicht
- Immanente und beobachterrelative Eigenschaften der Welt
- Gesellschaftliche Wirklichkeit: Drei Elemente
- Die Schaffung institutioneller Tatsachen
- Die Selbstbezüglichkeit vieler gesellschaftlicher Begriffe
- Die Verwendung performativer Äußerungen bei der Schaffung institutioneller Tatsachen
- Der logische Vorrang roher Tatsachen gegenüber institutionellen Tatsachen
- Systematische Beziehungen zwischen institutionellen Tatsachen
- Der Primat gesellschaftlicher Handlungen vor gesellschaftlichen Gegenständen, von Prozessen vor Produkten
- Die linguistische Komponente vieler institutioneller Tatsachen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Searles Ansatz zur Objektivität gesellschaftlicher Wirklichkeit, insbesondere den Aspekt gemeinsamer Absprachen als Grundlage für soziale Tatsachen. Sie geht über naturwissenschaftliche Erklärungen hinaus und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge, die jenseits der Naturwissenschaften liegen. Der Realismus und die Korrespondenztheorie der Wahrheit bilden die Grundlage der Untersuchung.
- Die Unterscheidung zwischen institutionellen und rohen Tatsachen
- Die Struktur und Entstehung institutioneller Tatsachen
- Der Einfluss von Sprache und performativen Äußerungen auf die gesellschaftliche Wirklichkeit
- Das Verhältnis von geistiger und physischer Wirklichkeit
- Die methodologische Herausforderung der Beschreibung gesellschaftlicher Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in Searles Untersuchung zur Objektivität gesellschaftlicher Wirklichkeit ein. Sie betont die Bedeutung gemeinsamer Absprachen für die Existenz bestimmter gesellschaftlicher Phänomene und hebt die Grenzen naturwissenschaftlicher Erklärungen hervor. Searle vertritt einen Realismus und eine Korrespondenztheorie der Wahrheit als grundlegende Voraussetzungen. Die Sprechakttheorie wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Zusammenspiels verschiedener Weltausschnitte genannt, wobei der Unterschied zwischen geistiger und physischer Wirklichkeit und deren Verhältnis im Zentrum stehen.
Bausteine der gesellschaftlichen Wirklichkeit: Dieses Kapitel differenziert zwischen „rohen Tatsachen“, die unabhängig vom menschlichen Glauben existieren (z.B. Berge), und „institutionellen Tatsachen“, die auf menschlicher Übereinkunft beruhen (z.B. Geld). Searle illustriert dies mit Beispielen aus dem Alltag und zeigt, wie die Struktur institutioneller Tatsachen oft unsichtbar und nur durch ihre Funktion erlernbar ist. Die Komplexität der Struktur wird am Beispiel eines Telefonbuches verdeutlicht: Für jemanden, der das System nicht versteht, erscheinen die Einträge lediglich als zufällige Kombinationen von Namen und Zahlen. Die Schwierigkeit, die zugrundeliegenden Strukturen zu analysieren, wird aus phänomenologischer und behavioristischer Perspektive beleuchtet. Searle sucht nach einer Methode, um diese Strukturen zu beschreiben.
Schlüsselwörter
Gesellschaftliche Wirklichkeit, Institutionelle Tatsachen, Rohe Tatsachen, Sprechakttheorie, Objektivität, Realismus, Performative Äußerungen, Soziale Institutionen, Ontologie.
Searles Ansatz zur Objektivität gesellschaftlicher Wirklichkeit: FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht John Searles Ansatz zur Objektivität gesellschaftlicher Wirklichkeit. Sie fokussiert insbesondere auf die Rolle gemeinsamer Absprachen als Grundlage für soziale Tatsachen und erweitert den Blick über naturwissenschaftliche Erklärungen hinaus auf die komplexen Zusammenhänge jenseits der Naturwissenschaften. Der Realismus und die Korrespondenztheorie der Wahrheit bilden die methodologische Grundlage.
Welche Kernthemen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Unterscheidung zwischen institutionellen und rohen Tatsachen, die Struktur und Entstehung institutioneller Tatsachen, der Einfluss von Sprache und performativen Äußerungen auf die gesellschaftliche Wirklichkeit, das Verhältnis von geistiger und physischer Wirklichkeit sowie die methodologische Herausforderung der Beschreibung gesellschaftlicher Strukturen.
Was versteht Searle unter „institutionellen Tatsachen“ und „rohen Tatsachen“?
„Rohe Tatsachen“ existieren unabhängig vom menschlichen Glauben (z.B. Berge), während „institutionelle Tatsachen“ auf menschlicher Übereinkunft beruhen (z.B. Geld). Der Unterschied wird anhand von Alltagsbeispielen verdeutlicht und die oft unsichtbare Struktur institutioneller Tatsachen wird analysiert.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Schaffung institutioneller Tatsachen?
Die Sprache, insbesondere performative Äußerungen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung institutioneller Tatsachen. Searle untersucht, wie diese Äußerungen soziale Realitäten konstituieren und wie sie mit der Struktur dieser Realitäten zusammenhängen.
Wie wird das Verhältnis von geistiger und physischer Wirklichkeit dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet das komplexe Verhältnis zwischen geistiger und physischer Wirklichkeit und untersucht, wie diese beiden Aspekte zusammenwirken, um die gesellschaftliche Wirklichkeit zu formen. Die Sprechakttheorie dient dabei als analytisches Werkzeug.
Welche methodologische Herausforderung wird hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die methodologische Herausforderung hervor, die mit der Beschreibung gesellschaftlicher Strukturen verbunden ist. Sie analysiert die Komplexität dieser Strukturen und sucht nach geeigneten Methoden, um sie zu analysieren und zu beschreiben.
Welche Kapitel umfasst das Werk?
Das Werk umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den Bausteinen der gesellschaftlichen Wirklichkeit (inkl. institutionellen und rohen Tatsachen), ein Kapitel zur Schaffung institutioneller Tatsachen und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detaillierter beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Schlüsselbegriffe sind: Gesellschaftliche Wirklichkeit, Institutionelle Tatsachen, Rohe Tatsachen, Sprechakttheorie, Objektivität, Realismus, Performative Äußerungen, Soziale Institutionen, Ontologie.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die genaue Schlussfolgerung ist im bereitgestellten Text nicht explizit zusammengefasst, aber die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse von Searles Theorie zur Objektivität gesellschaftlicher Wirklichkeit.)
- Citar trabajo
- Volker Weiss (Autor), 2004, Zu: John R. Searle - Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24306