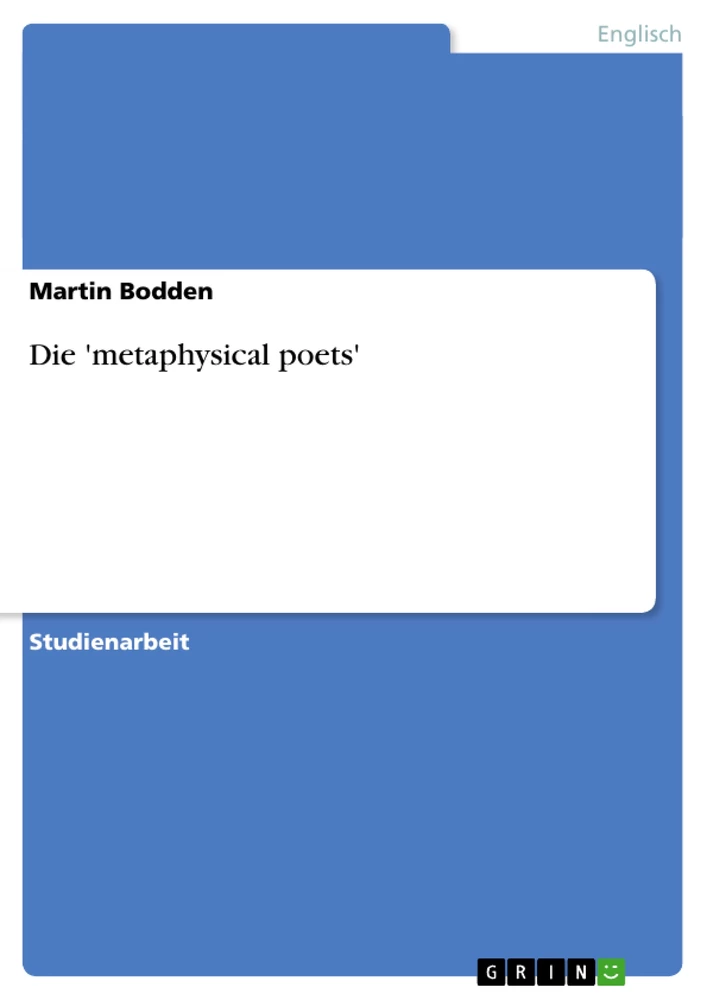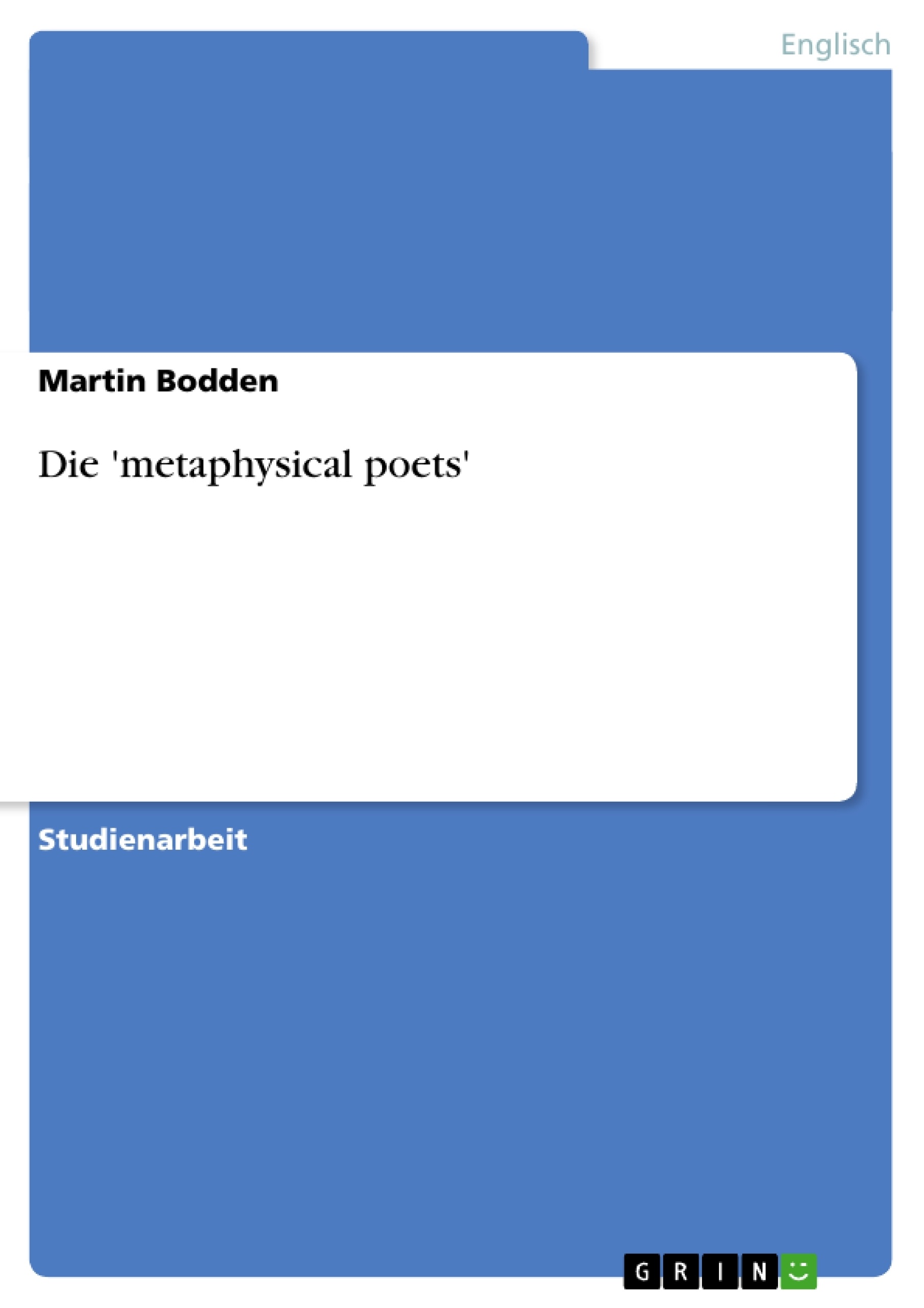"There is a bastard kind of eloquence that is crept into the Pulpit, which consists in affectations of wit and finery, flourishes, metaphors, and cadencies. Thus I have described to you the first Rule and Character of Preaching: it should be PLAIN.”
Joseph Glanvill, An Essay Concerning Preaching (1678)
I. Englische Religiöse Lyrik des 17. Jahrhunderts
Im 17. Jahrhundert entfaltete sich in England eine neue religiöse Dichtung. Diese religiöse Lyrik der Barockzeit pflegt man in der Literaturgeschichte als „metaphysical poetry“ zu bezeichnen. Die vier Hauptvertreter, „metaphysical poets“ genannt, sind: John Donne, George Herbert, Richard Crashaw, Henry Vaughan.
John Donne hat zwar nicht als erster in England Sonette geschrieben, aber seine „Holy Sonnets“ sind die ersten bedeutenden religiösen Sonette in England.
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen und weil sich die Kritik zunächst auf ihn, als bekanntesten der „metaphysical poets“ und berühmtesten Prediger in der Geschichte Englands bezieht, wird hauptsächlich Donne und seine Dichtung Gegenstand meiner Hausarbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Englische Religiöse Lyrik des 17. Jahrhunderts
- John Donne: zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Zum Problem der Religiösen Dichtung
- Das Verhältnis von weltlicher Dichtung zu religiöser Dichtung
- Holy Sonnets
- Holy Sonnet III “Batter my heart“; Stilmittelanalyse, Gedichtinterpretation
- Die „Holy Sonnets“
- Holy Sonnet III “Batter my heart“; Stilmittelanalyse, Interpretation
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die religiöse Lyrik des 17. Jahrhunderts in England, insbesondere das Werk von John Donne und seine „Holy Sonnets“. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext, in dem Donnes Dichtung entstand, und analysiert die Debatte um die Möglichkeit religiöser Dichtung. Sie konzentriert sich auf die Stilmittel und die Interpretation von Donnes Gedichten, speziell „Holy Sonnet III: Batter my heart“.
- Der historische Kontext der englischen religiösen Lyrik im 17. Jahrhundert
- Die Debatte um die Möglichkeit religiöser Dichtung ("pious poetry")
- Stilistische Analyse der „Holy Sonnets“ von John Donne
- Interpretation von Donnes „Holy Sonnet III: Batter my heart“
- Donnes Stellung innerhalb der „metaphysical poets“
Zusammenfassung der Kapitel
Englische Religiöse Lyrik des 17. Jahrhunderts: Dieses Kapitel führt in die Thematik der englischen religiösen Lyrik des 17. Jahrhunderts ein und bezeichnet sie als „metaphysical poetry“. Es nennt die vier Hauptvertreter dieser Bewegung – John Donne, George Herbert, Richard Crashaw und Henry Vaughan – und betont Donnes herausragende Bedeutung und seinen Einfluss auf die Entwicklung religiöser Sonette in England. Die Arbeit konzentriert sich aufgrund des Umfangs auf Donne und seine Dichtung.
John Donne: zeitgeschichtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel skizziert Donnes frühe Lebensjahre und den historischen Kontext, in dem er aufwuchs. Es beschreibt die religiösen und politischen Umwälzungen in England im ausgehenden 16. Jahrhundert, einschließlich der Exkommunikation Elisabeths I. durch Papst Pius V. und die Veröffentlichung der dreiunddreißig Artikel der Church of England. Besonders wird der Einfluss der wissenschaftlichen Revolution und des Wandels im Weltbild (vom geozentrischen zum heliozentrischen Modell) auf das Denken jener Zeit thematisiert, wobei die Arbeit ältere Interpretationen der „metaphysical poetry“ als Ausdruck eines zusammengebrochenen Weltbildes kritisch hinterfragt. Stattdessen wird die These aufgestellt, dass das 17. Jahrhundert eher durch das Zusammenspiel alter und neuer Ideen geprägt war.
Zum Problem der Religiösen Dichtung: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, ob religiöse Dichtung überhaupt möglich ist. Es diskutiert Dr. Johnsons These aus dem 18. Jahrhundert, die die Darstellung von Frömmigkeit und dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch als dichterisch unmöglich darstellt. Johnsons drei Hauptargumente – die geringe Anzahl an religiösen Themen, die Unvereinbarkeit von religiösen Verhaltensweisen mit poetischem Schaffen und der Mangel an "invention" – werden im Detail erläutert. Das Kapitel legt die Grundlage für die Analyse von Donnes Gedichten, indem es die Debatte um die Natur und die Möglichkeiten religiöser Lyrik in den Fokus rückt.
Schlüsselwörter
Metaphysische Dichtung, John Donne, Holy Sonnets, Religiöse Lyrik, 17. Jahrhundert, England, Stilmittel, Gedichtinterpretation, „pious poetry“, Devotionalliteratur, Historischer Kontext, Weltbildwandel.
Häufig gestellte Fragen: Seminararbeit über Englische Religiöse Lyrik des 17. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die englische religiöse Lyrik des 17. Jahrhunderts, insbesondere das Werk von John Donne und seine „Holy Sonnets“. Sie beleuchtet den historischen Kontext, analysiert die Debatte um die Möglichkeit religiöser Dichtung und interpretiert Donnes Gedichte, speziell „Holy Sonnet III: Batter my heart“.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Kontext der englischen religiösen Lyrik im 17. Jahrhundert, die Debatte um die Möglichkeit religiöser Dichtung ("pious poetry"), stilistische Analysen der „Holy Sonnets“, Interpretation von Donnes „Holy Sonnet III: Batter my heart“, und Donnes Stellung innerhalb der „metaphysical poets“.
Wer ist der zentrale Autor?
Der zentrale Autor ist John Donne, dessen „Holy Sonnets“ im Mittelpunkt der Analyse stehen. Die Arbeit betrachtet ihn im Kontext der „metaphysical poets“, einer Bewegung, der neben Donne auch George Herbert, Richard Crashaw und Henry Vaughan zugeordnet werden.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit skizziert Donnes Leben und den historischen Kontext des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts in England. Sie beschreibt religiöse und politische Umwälzungen, den Einfluss der wissenschaftlichen Revolution und den Wandel des Weltbildes (vom geozentrischen zum heliozentrischen Modell). Ältere Interpretationen der „metaphysical poetry“ als Ausdruck eines zusammengebrochenen Weltbildes werden kritisch hinterfragt.
Welche zentrale Frage zur religiösen Dichtung wird diskutiert?
Ein zentrales Thema ist die Debatte um die Möglichkeit religiöser Dichtung. Die Arbeit diskutiert Dr. Johnsons These aus dem 18. Jahrhundert, die die Darstellung von Frömmigkeit und dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch als dichterisch unmöglich darstellt. Johnsons Argumente – geringe Anzahl an religiösen Themen, Unvereinbarkeit von religiösen Verhaltensweisen mit poetischem Schaffen und Mangel an "invention" – werden analysiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Stilmittel-Analyse und der Gedichtinterpretation. Sie analysiert die sprachlichen Mittel in Donnes Gedichten, um zu einer Interpretation des Inhalts und der Aussage zu gelangen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Englischer religiöser Lyrik des 17. Jahrhunderts, John Donne: zeitgeschichtlicher Hintergrund, Zum Problem der Religiösen Dichtung, Die „Holy Sonnets“ (mit Fokus auf „Holy Sonnet III: Batter my heart“) und Konklusion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Metaphysische Dichtung, John Donne, Holy Sonnets, Religiöse Lyrik, 17. Jahrhundert, England, Stilmittel, Gedichtinterpretation, „pious poetry“, Devotionalliteratur, Historischer Kontext, Weltbildwandel.
- Arbeit zitieren
- Martin Bodden (Autor:in), 2001, Die 'metaphysical poets', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24392