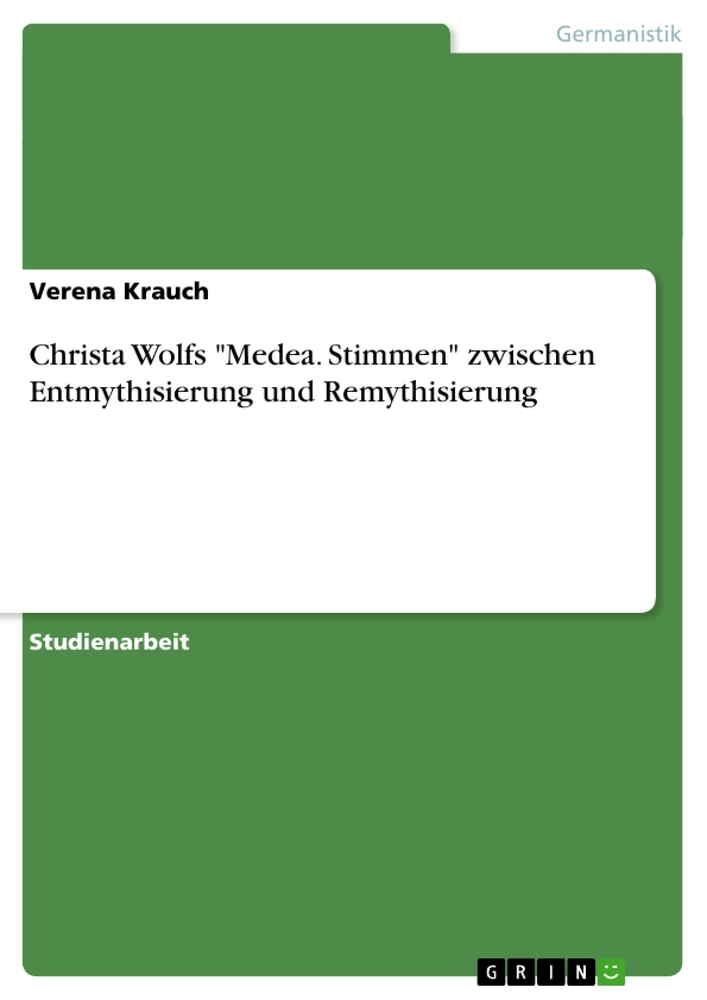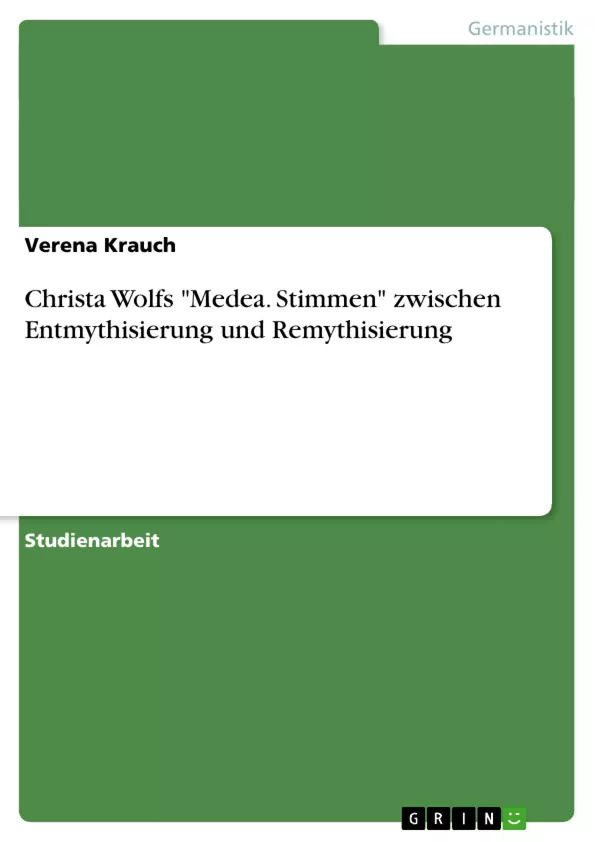In ihrem 1996 erschienenen Roman "Medea. Stimmen" stellt Christa Wolf ihre Titelheldin in ein Licht, das sich nicht radikaler von dem uns seit vielen Jahrhunderten überlieferten, traditionellen Bild der mythologischen Medea entfernen könnte. An die Stelle des Scheusals Medea, der betrogenen Ehefrau, deren leidenschaftliche Liebe in vernichtende Raserei umkippt und der kaltblütigen Bruder- und Kindermörderin tritt bei Wolf eine Exiliantin aus politischer Überzeugung, die in ihrer Wahlheimat Korinth auf die Spur eines grausamen Staatsverbrechens gerät und schließlich aufgrund ihrer staatsfeindlichen Nachforschungen zum Opfer eines gezielt inszenierten Rufmordes wird.
Christa Wolfs provozierende Mythenneubearbeitung verbindet sich überdies mit einem noch provozierenderen Anspruch: Dem Anspruch nämlich, ihren Lesern nicht nur irgendeine neue Variante des altbekannten Mythos zu liefern, sondern die einzige wahre und richtige Variante, aufgrund derer alle vorherigen "schnellfertige[n] Urteile" (MS: 9) über Medea von Grund auf widerrufen werden müssen.
Den wissenschaftlichtheoretischen Rahmen für Wolfs Neuinterpretation des Mythos liefert dabei die in 1980ger Jahren entwickelte Mythentheorie des französischen Soziologen und Kulturwissenschaftlers René Girard, der in seinen Untersuchungen "La Violence et le sacré" (Das Heilige und die Gewalt) und "Le Bouc émissaire" (Der Sündenbock) Mythen auf indirekte weil verschlüsselte Zeugnisse realer historischer Verfolgung zurückführt und auf den Wolf in ihrem Roman an verschiedenen Stellen zitierend Bezug nimmt.
Ausgehend von einem etwas genaueren Blick auf einige zentrale Thesen Girards und deren Umsetzung in "Medea. Stimmen" möchte sich die vorliegende Arbeit folgenden Fragen widmen: Inwieweit führt Wolfs Rückgriff auf die von Girard entwickelten sozialpsychologischen Interpretationsmuster insgesamt zu einer entmythisierenden Erzählweise? Inwieweit gelingt es Wolf durch die Thematisierung der Genese des Mythos "Medea" auf der Textoberfläche die Lebensgeschichte Medeas über das Persönliche hinaus als exemplarischen Fall eines Sündenbock- und Verfolgungsmechanismus darzustellen? Welche Probleme ergeben sich bei der literarischen Umsetzung dieser Intention? Und schließlich: Inwieweit lässt sich das von Christa Wolf entworfene Persönlichkeitsbild Medeas mit dem Versuch einer Entindividualisierung und Verallgemeinerung ihres Schicksals als das eines prototypischen Sündenbocks vereinbaren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Der mythische Held als Sündenbock: über René Girards Interpretation des Mythos als Zeugnis historischer Verfolgungs- und Ausgrenzungsprozesse
- II. Christa Wolfs Medea. Stimmen: Entmythisierung eines Sündenbockmechanismus? Über Wolfs literarische Umsetzung der girardschen Mythentheorie
- III. Mythos als Kulturprodukt - über zivilisationskritsche Aspekte in Medea. Stimmen, Christa Wolfs Begriff der Verkennung und die Frage nach der Exemplarität des medeischen Schicksals
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Christa Wolfs Roman "Medea. Stimmen" im Kontext von René Girards Mythentheorie. Sie untersucht, wie Wolf die girardschen Thesen in ihrem Werk umsetzt und welche Auswirkungen dies auf die Darstellung der Titelheldin hat.
- Entmythisierung des Medea-Mythos
- Sündenbockmechanismen in Literatur und Geschichte
- Zivilisationskritik und Verkennung
- Exemplarität des medeischen Schicksals
- Girards Mythentheorie und ihre Anwendung auf Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Christa Wolfs Roman "Medea. Stimmen" vor und skizziert die zentrale These: Wolf entwirft eine neue Interpretation des Medea-Mythos, die sich von traditionellen Darstellungen abhebt. Die Einleitung führt außerdem René Girards Mythentheorie ein, die als theoretischer Rahmen für die Analyse des Romans dient.
- I. Der mythische Held als Sündenbock: Dieses Kapitel analysiert Girards Theorie des Sündenbocks. Girard argumentiert, dass Mythen oft als verschlüsselte Zeugnisse realer Verfolgungsprozesse zu verstehen sind. Er betrachtet historische Verfolgungsgeschichten und zeigt, wie diese oft zu einer Verzerrung der Wirklichkeit führen, die sich in Form von Mythen manifestiert.
- II. Christa Wolfs Medea. Stimmen: Dieses Kapitel untersucht, wie Wolf Girards Theorie in ihrem Roman umsetzt. Es analysiert, wie die Thematisierung von Sündenbockmechanismen und Verfolgungsstrukturen die Darstellung Medeas beeinflusst.
- III. Mythos als Kulturprodukt: Dieses Kapitel setzt sich mit den zivilisationskritischen Aspekten des Romans auseinander. Es geht auf Wolfs Konzept der "Verkennung" ein und analysiert, wie das medeische Schicksal als exemplarisches Beispiel für gesellschaftliche Mechanismen der Ausgrenzung und Verfolgung verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Christa Wolf, Medea. Stimmen, René Girard, Mythentheorie, Sündenbock, Verfolgung, Verkennung, Exemplarität, Zivilisationskritik, Literaturanalyse, Mythosinterpretation.
- Quote paper
- Magistra Artium Verena Krauch (Author), 2004, Christa Wolfs "Medea. Stimmen" zwischen Entmythisierung und Remythisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24397