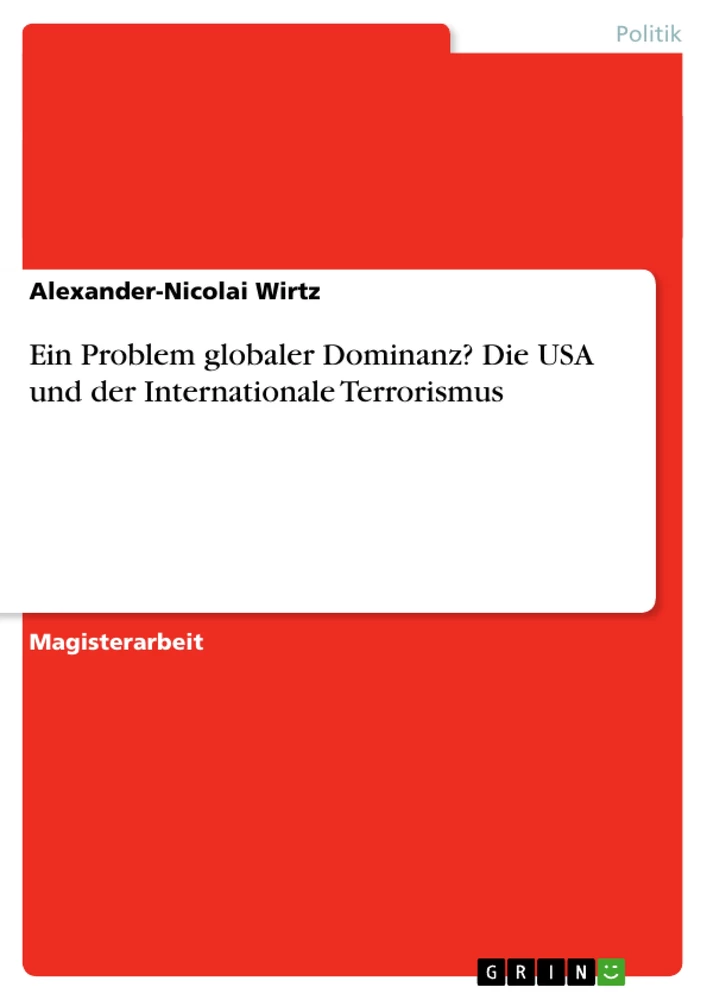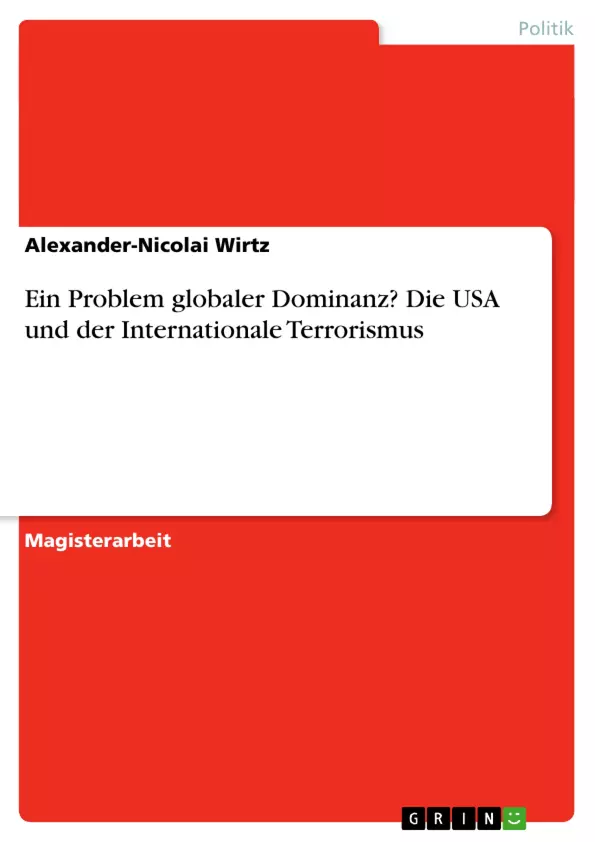„In times of peace, terrorists and other practitioners of political violence - not conventional military forcesmay pose the greatest threat to the lives of U.S. soldiers (...) A soldier entering the Army in 1977 and retiring today would have been more likely to die from a terrorist attack than be killed in combat.” 1 Im Jahr 1997 waren amerikanische Staatsbürger und Einrichtungen der Vereinigten Staaten das Ziel von rund 40 % aller terroristischen Anschläge, ein Anstieg um 15 % im Vergleich zu 1996. 2 Kein anderes Land, mit Ausnahme Israels, ist so häufig Angriffsziel terroristischer Gewaltakte wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Besondere Brisanz erfährt dieses Problem nicht nur aufgrund der Kosten an Menschen und Material durch Anschläge gegen die U.S.A. im Ausland, sondern durch die Gefahr möglicher Anschläge international operierender Terroristen in den Vereinigten Staaten selbst - eine Gefahr, der sich die USA spätestens seit dem Bombenanschlag auf das World Trade Center in New York in Februar 1993, stellen müssen. Die veränderte Organisationsstruktur des internationalen Terrorismus und die Unmöglichkeit, die Aktionsräume solcher Gruppen eindeutig abzugrenzen, stellen die Verantwortlichen innerhalb der amerikanischen Regierung vor schwerwiegende Probleme. Der veränderte Aufbau international agierender Terrorgruppen erschwert nicht nur die Bekämpfung durch Maßnahmen des amerikanischen Geheimdienstes, sondern lässt auch wirtschaftspolitische Maßnahmen, wie etwa Handelssanktionen gegen Unterstützerstaaten wirkungslos erscheinen, auch wenn diese Maßnahmen von offizieller Seite als geeignetes Mittel zur Bekämpfung des Problems angesehen werden. 3 Die derzeitigen Maßnahmen gegen terroristische Anschläge beschränkten sich zum überwiegenden Teil auf finanzielle Unternehmungen mit dem Ziel, die Schäden terroristischer Gewaltakte zu minimieren. Eine eingehende Auseinandersetzung mit den Ursachen des terroristischen Problems scheint nur oberflächlich stattzufinden, wie etwa den Reaktionen auf die Bombenanschläge auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania zu entnehmen ist: „(...) terrorists target America because we act and stand for peace and democracy, because the spirit of our country is the very spirit of freedom.“ 4
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Terrorismus – Entwicklungslinien
- 1) Begriffsdefinition
- 2) Terrorismus als Ausprägungsform politischer Gewalt
- 3) Die Bedeutung der Medien für den Terrorismus - Der CNN-Effekt
- 4) Strukturmerkmale des Terrorismus 1960 – 1979
- 5) Der Wandel seit 1979 - neue Formen des Terrorismus
- II. Die Vereinigten Staaten – Ein globaler Hegemon
- 1) Strategische Grundlagen amerikanischer Außenpolitik 1945 – 1990/91
- 2) Die veränderte weltpolitische Lage nach 1990/91
- 3) Der Primat militärischer Überlegenheit
- 4) Militärische Interventionen - U.S. amerikanische Ordnungsvorstellungen
- 5) Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika
- 6) Das amerikanische Bild der \"States of Concern\"
- III. Die Hegemonialstellung der U.S.A. im Persischen Golf – Ausprägungsformen und Konsequenzen
- 1) Das Konfliktpotential im Nahen und Mittleren Osten
- 2) Die Anfänge U.S.-amerikanischer Außenpolitik im Persischen Golf
- 3) Special Relationships
- a) Israel
- b) Saudi Arabien
- 4) U.S.-Sicherheitspolitik im Persischen Golf - vitales Interesse oder hegemoniale Versuchung?
- a) Die wirtschaftliche Bedeutung der Region
- b) Dual Containment
- IV. Strategien gegen den Terrorismus
- 1) Geostrategische Lösungsansätze
- 2) Internationale Kooperation zur Bekämpfung des Terrorismus
- 3) Innenpolitische Lösungsansätze, legislative Initiativen, verfassungsrechtliche Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hintergründe und Ursachen des internationalen Terrorismus und die Gefahr, die er für die Vereinigten Staaten darstellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob sich ein Zusammenhang zwischen terroristischen Anschlägen und amerikanischer Außenpolitik im Zeitraum 1990-2000 herstellen lässt.
- Entwicklung des Terrorismus und seine neuen Ausprägungsformen
- Amerikanische Außenpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges
- Die Rolle der USA im Persischen Golf als Fallbeispiel für U.S.-Außenpolitik
- Strategien zur Bekämpfung des Terrorismus
- Mögliche Auswirkungen des Internationalen Terrorismus auf die Vereinigten Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit setzt sich mit der Problematik des Internationalen Terrorismus und seiner Bedeutung für die Vereinigten Staaten auseinander. Sie untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen amerikanischer Außenpolitik und terroristischen Anschlägen besteht.
- I. Terrorismus – Entwicklungslinien: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Terrorismus“, beschreibt seine Entwicklung und untersucht seine neuen Ausprägungsformen. Es beleuchtet auch die Bedeutung der Medien für den Terrorismus.
- II. Die Vereinigten Staaten – Ein globaler Hegemon: Dieses Kapitel untersucht die Grundlagen der amerikanischen Außenpolitik seit 1945, besonders nach dem Ende des Kalten Krieges, und beleuchtet die Rolle der USA als globaler Hegemon.
- III. Die Hegemonialstellung der U.S.A. im Persischen Golf – Ausprägungsformen und Konsequenzen: Dieses Kapitel untersucht die U.S.-Außenpolitik im Persischen Golf als Fallbeispiel für die strategischen Interessen und das Hegemonialstreben der USA. Es beleuchtet die Spannungen in der Region und die Folgen der U.S.-Präsenz für die Sicherheit und Wirtschaft.
- IV. Strategien gegen den Terrorismus: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Strategien zur Bekämpfung des Terrorismus, sowohl auf geostrategischer Ebene als auch im Rahmen internationaler Kooperation und innerstaatlicher Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Internationale Terrorismus, amerikanische Außenpolitik, Hegemonie, Persischer Golf, Strategien zur Terrorismusbekämpfung, CNN-Effekt, Staaten von Belang, Dual Containment.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind die USA ein häufiges Ziel für Terrorismus?
Die Arbeit untersucht, ob die globale Dominanz und die Außenpolitik der USA, insbesondere im Nahen Osten, als Ursache für die häufigen Angriffe (ca. 40 % aller Anschläge 1997) zu sehen sind.
Was versteht man unter dem „CNN-Effekt“?
Der CNN-Effekt beschreibt die enorme Bedeutung der Medien für den Terrorismus, da Gewaltakte erst durch globale Berichterstattung ihre volle politische Wirkung entfalten.
Welche Rolle spielt der Persische Golf in der US-Politik?
Die Region ist aufgrund ihrer Ölvorkommen von vitalem wirtschaftlichem Interesse; die militärische Präsenz der USA dort wird jedoch oft als hegemoniale Versuchung und Konfliktquelle wahrgenommen.
Was ist „Dual Containment“?
Eine US-Strategie zur gleichzeitigen Eindämmung von Iran und Irak, um die Stabilität und die eigenen Interessen im Persischen Golf zu sichern.
Wie hat sich der Terrorismus seit 1979 verändert?
Die Arbeit beschreibt einen Wandel hin zu international operierenden Gruppen mit veränderten Organisationsstrukturen, die schwerer durch klassische Geheimdienstmethoden zu bekämpfen sind.
- Arbeit zitieren
- Alexander-Nicolai Wirtz (Autor:in), 2001, Ein Problem globaler Dominanz? Die USA und der Internationale Terrorismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24436