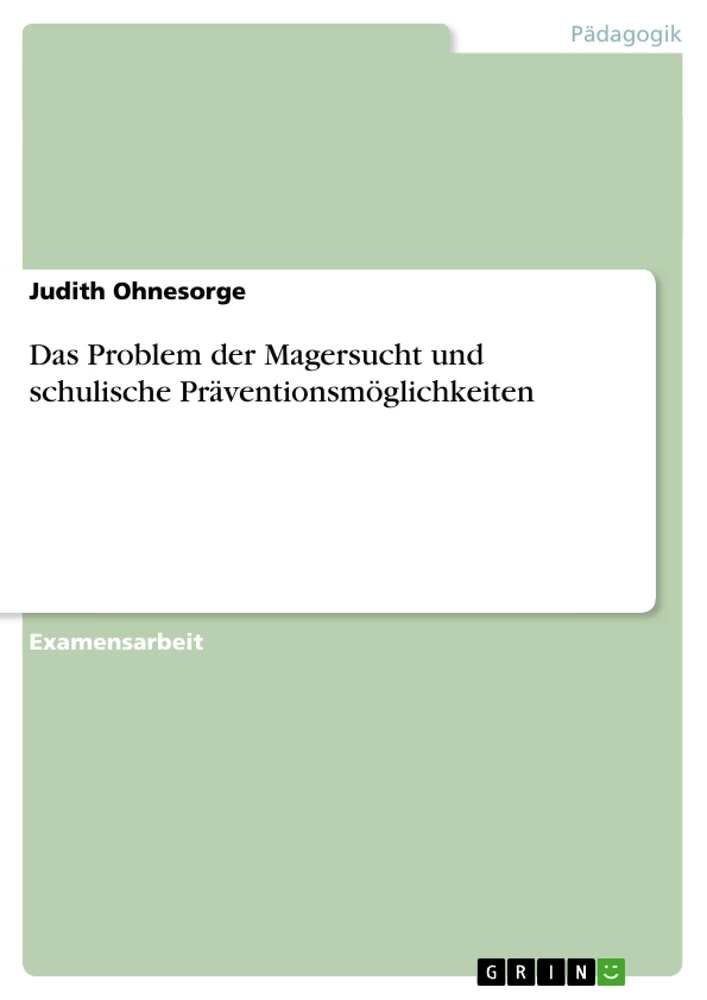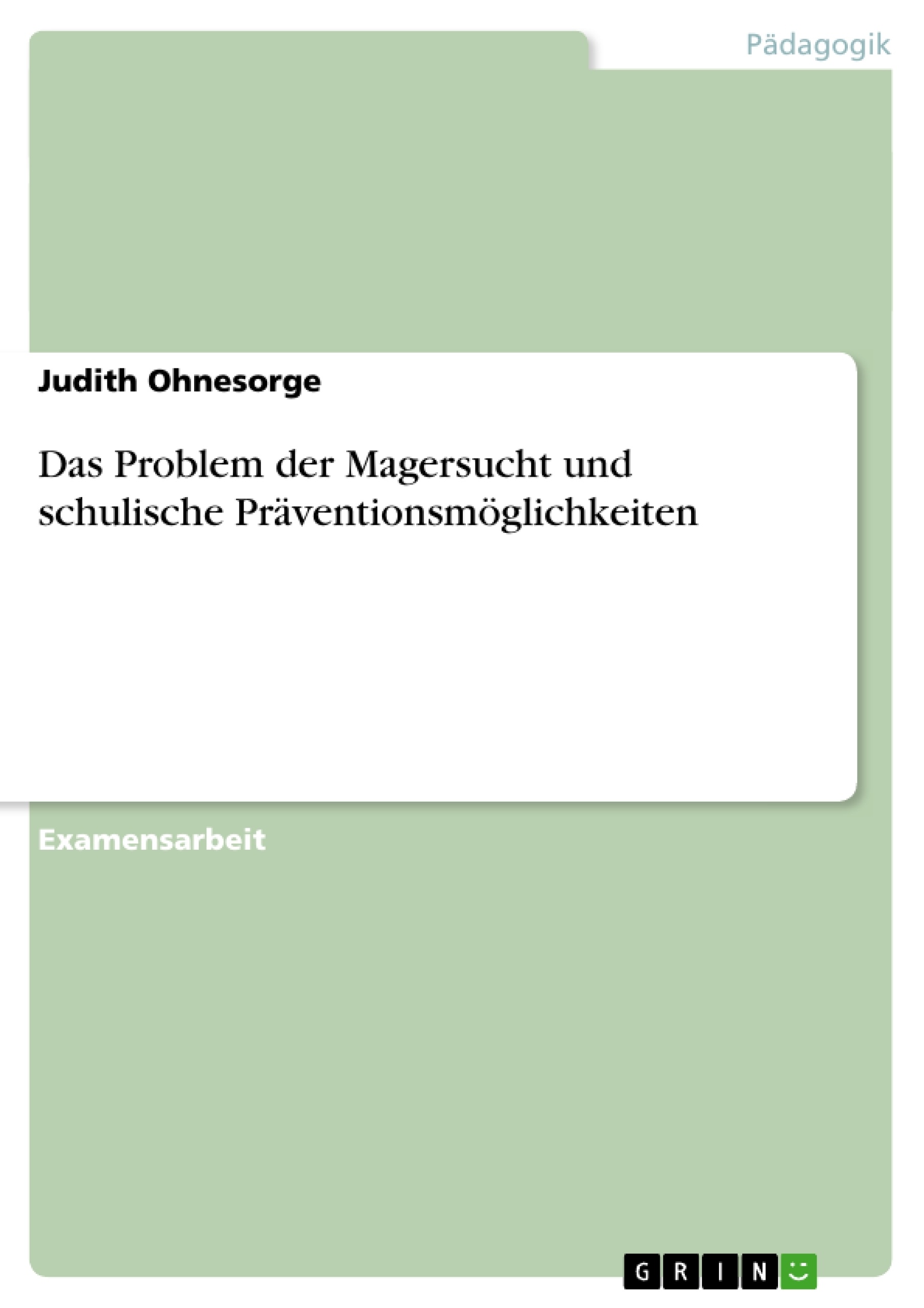In der heutigen Zeit wird das Problem Magersucht immer öfter in den Medien thematisiert, somit sind die (gesellschaftlichen) Ursachen in der Öffentlichkeit bekannter als früher. Dennoch steigt die Anzahl der Betroffenen rapide an. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem „Warum“. Da hauptsächlich junge Menschen von der Erkrankung betroffen sind, ist diese Frage auch für den schulischen Bereich und für angehende LehrerInnen von großer Bedeutung.
In der Sonderschule fallen hin und wieder sehr dünne Kinder auf. Häufig wird dies auf eine schlechte Versorgung im Elternhaus zurückgeführt. Dass eine Magersucht vorliegen könnte, wird in den meisten Fällen weniger in Betracht gezogen.
Aber gerade auf Kindern, die die Sonderschule besuchen, lastet ein hoher Leistungsdruck, der das Essverhalten negativ beeinflussen kann (siehe Kapitel I. 5.2), so dass das Auftreten von Magersucht bei Sonderschulkindern eigentlich nicht erstaunlich ist.
Natürlich spielen die gesellschaftlichen Einflüsse auch in der Schule eine bedeutende Rolle. Unsere heutige Gesellschaft ist von dem Idealbild des schlanken, sportlichen und aktiven Menschen geprägt. Dies hat zur Folge, dass Kinder, die diesen Maßstäben nicht entsprechen, oft gehänselt und ausgegrenzt werden. Gerade übergewichtigen Kindern gegenüber wird ein ablehnendes Verhalten gezeigt. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit diese Faktoren zu der Entwicklung von Essstörungen führen können. Bezüglich der Schule lässt sich sagen, dass sie, neben der Familie, die zweitwichtigste Sozialisationsinstanz darstellt. Ihr fällt -aufgrund der Tatsache, dass in unserer modernen Gesellschaft die ursprüngliche Familie immer weniger vorhanden ist- eine immer größere Rolle zu. Somit ist zu überlegen, wie die Schule süchtiges Essverhalten positiv oder negativ beeinflusst. Ausgehend davon ist zu klären, welche präventiven Maßnahmen in der Schule in Bezug auf gestörtes Essverhalten ergriffen werden können. Gerade für Studentinnen und Studenten des Lehramtes ist also das von mir gewählte Thema „Das Problem der Magersucht und schulische
Präventionsmöglichkeiten“ von großer Bedeutung (siehe Kapitel II. 3.3). So müssen Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sein, Anzeichen einer Magersucht zu erkennen, um angemessen reagieren zu können. Da es sich bei 95 % der an Magersucht erkrankten Personen um Mädchen und Frauen handelt, verwende ich in meiner Arbeit immer die weibliche Form, wenn es um die Betroffenen geht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Magersucht
- Definition
- Historischer Überblick
- Die Geschichte der Magersucht
- Behandlungsmethoden im Wandel der Zeit
- Symptome – Wie äußert sich Magersucht?
- Physische Symptome
- Gewichtsverlust
- Amenorrhöe
- Nierenschäden
- Herz- und Kreislaufprobleme
- Magen- und Verdauungsprobleme
- Haare, Haut und Knochen
- Schädigungen der Nerven und des Gehirns
- Psychische Symptome
- Verhalten und Einstellung
- Aktivität
- Schlafstörungen
- Interessen und Leistung
- Sexualität und Körperwahrnehmung
- Beziehungsprobleme
- Diagnostik
- Entwicklung diagnostischer Kriterien
- Diagnosekriterien nach Feighner et al. 1972
- Exkurs: ICD-10 und DSM-IV
- Probleme von ICD und DSM
- Die Diagnostik der Magersucht
- Die medizinische Diagnostik der Magersucht
- Die psychologische Diagnostik der Magersucht
- Ursachen
- Genetische Ursachen
- Schule und Peergroup
- Sexueller Missbrauch
- Körperlicher Missbrauch
- Die Familie
- Funktionale und dysfunktionale Familiensysteme
- Magersüchtige Mädchen und ihre Familie
- Frühkindliche Entwicklung
- Die Rolle der Mutter
- Die Rolle des Vaters
- Die Gesellschaft
- Der Teufelskreis Magersucht
- Schema: Der Teufelskreis der Magersucht
- Therapie
- Indikation
- Therapieformen
- Organmedizinische Behandlung
- Psychoanalyse
- Ansatz nach Hilde Bruch
- Verhaltenstherapie
- Klientenzentrierte Psychotherapie
- Familientherapie
- Feministische Therapien
- Gruppentherapeutische Verfahren
- Musiktherapie
- Kreativtherapie
- Heilungschancen
- Statistiken
- Alter bei Einsetzen der Anorexie
- Dauer der Anorexie
- Durchschnittlicher Gewichtsverlust
- Vergleich der Symptome nach den Feigherschen Kriterien während der Anorexie und heute
- II. Schulische Prävention
- Warum ist präventive Arbeit gerade in der Schule von Bedeutung?
- Theorie
- Prävention
- Präventionsmodelle
- Ganzheitliche Suchtprävention
- Praxis
- Gesundheitsfördernde Schulen
- Suchtgefährdete Kinder
- Geschlechtsspezifische Präventionsarbeit
- Unterrichtsmöglichkeiten und Vereinbarkeit mit den Rahmenrichtlinien
- Erleben mit allen Sinnen
- Körpererfahrungsübungen
- Identitätsbildung
- Figuren-/Rollenspiel
- Bewegungs- und Entspannungsübungen
- Gesundheitserziehung
- Die Aufgaben der/des LehrerIn
- Was kann die Schule tun, um gesundheitliche Risiken bei bereits magersüchtigen Mädchen zu vermeiden?
- Körperliches Training
- Essenszeiten
- Hausaufgaben
- Prüfungen
- Grenzen der schulischen Prävention
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Arbeiten mit dem Internet zum Thema Magersucht
- Reflexion
- Die Entstehung und Ausprägung der Magersucht
- Die Rolle der Schule in der Entstehung und Bekämpfung von Essstörungen
- Theoretische Grundlagen der Prävention
- Praktische Präventionsansätze in der Schule
- Die Bedeutung von Lehrer*innen in der Präventionsarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Magersucht und den Möglichkeiten der schulischen Prävention. Das Ziel ist es, die Entstehung und Ausprägung der Essstörung zu analysieren und zu verstehen, welche Rolle die Schule dabei spielen kann. Die Arbeit befasst sich sowohl mit den theoretischen Grundlagen der Prävention als auch mit praktischen Ansätzen, die in der Schule umgesetzt werden können.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der Magersucht einführt und die Relevanz der schulischen Präventionsarbeit verdeutlicht. Im ersten Teil wird die Magersucht als Krankheit definiert, ihre historische Entwicklung und die vielfältigen Symptome, die sie begleiten, beleuchtet. Es werden sowohl die physischen als auch die psychischen Aspekte der Magersucht detailliert beschrieben. Der erste Teil endet mit einer Analyse der Ursachen der Magersucht, wobei verschiedene Faktoren wie genetische Veranlagung, gesellschaftliche Einflüsse, Familiendynamik und die Rolle von Missbrauch beleuchtet werden.
Im zweiten Teil widmet sich die Hausarbeit der schulischen Präventionsarbeit. Hierbei werden die Bedeutung der Schule als präventive Instanz und die theoretischen Grundlagen der Prävention erläutert. Es werden verschiedene Präventionsmodelle vorgestellt und die Rolle der Schule in der Umsetzung der Prävention, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Gesundheit von Schüler*innen, dargestellt.
Schlüsselwörter
Magersucht, Anorexia nervosa, Essstörung, Prävention, schulische Prävention, Gesundheitserziehung, Lehrerrolle, Familientherapie, gesellschaftliche Einflüsse, Symptome, Diagnostik, Therapie.
- Arbeit zitieren
- Judith Ohnesorge (Autor:in), 2003, Das Problem der Magersucht und schulische Präventionsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24463