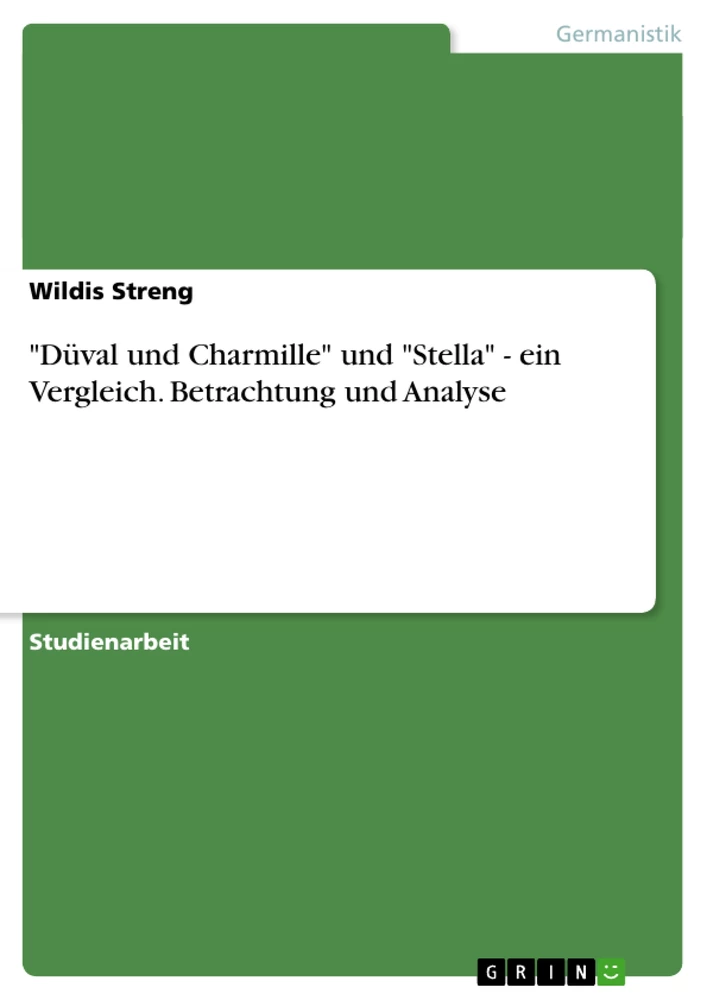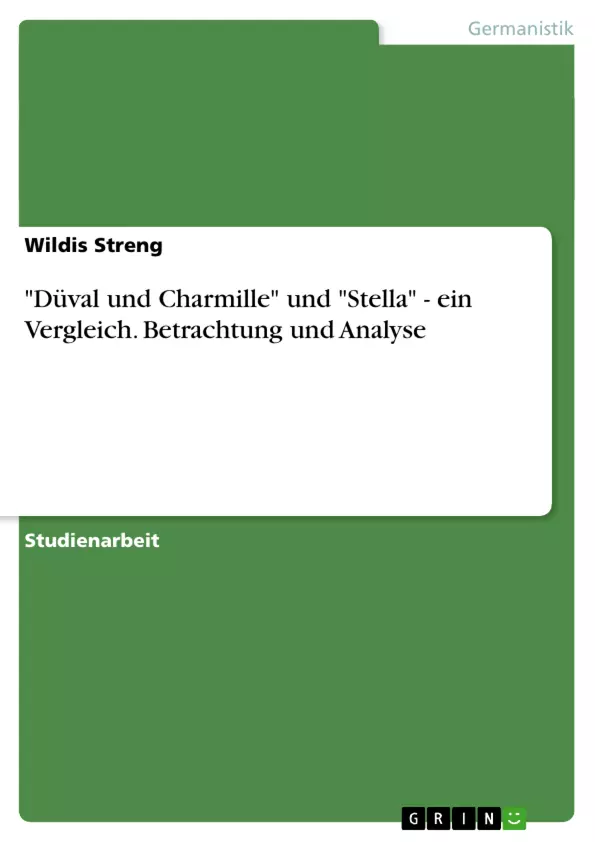Goethes "Stella" und Schlegels "Düval und Charmille" sind wichtige Werke im Hinblick auf die Gender Studies. Nicht nur, dass beide Werke von weiblicher Emanzipation und Selbstbestimmung handeln. Christiane Caroline Schlegel hat nämlich außerdem insofern als besonders emanzipiert zu gelten, als sie in einer Zeit, in der die meisten Frauen sie mit Tee trinken und sticken begnügen, selbst schriftstellerisch tätig wird. Die Abhandlung liefert einen Vergleich beider Werke.
Inhaltsverzeichnis
- Charakterisierungen der weiblichen Protagonisten
- Unterschiedliche Handhabung des Verlustes des Partners, charakterliche Voraussetzungen für Akzeptanz und Rezeption
- Die Verhältnisse der Frauengestalten in den Stücken zueinander
- Vergleich der beiden männlichen Protagonisten
- Veranschaulichung des Umgangs der Protagonisten miteinander an ausgewählten Szenen
- Der veränderte Schluss bei „Stella“ und die theoretische Möglichkeit einer Übertragung auf „Düval und Charmille“
- Die Symbolik der Schauplätze bei „Stella“ und „Düval und Charmille“
- Die Beziehungen der Protagonisten zu Gott, ihre religiösen Empfindungen
- Die geschlechtsspezifische Rollenzuweisung der Protagonisten
- Subjektive Beurteilung der Verhaltensweisen der weiblichen Protagonisten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert und vergleicht die beiden bürgerlichen Trauerspiele „Düval und Charmille“ von Christiane Caroline Schlegel und „Stella“ von Johann Wolfgang Goethe. Beide Werke basieren auf realen Begebenheiten und erfüllen weitgehend die aristotelischen Formprinzipien. Die Arbeit untersucht Parallelen und Unterschiede in den Charakteren, der Handlungsentwicklung und der Darstellung von Liebe, Verlust und gesellschaftlichen Normen.
- Vergleich der weiblichen Protagonisten: Analyse ihrer Charakteristika und ihres Umgangs mit Liebe, Verlust und gesellschaftlichen Erwartungen.
- Untersuchung der unterschiedlichen Reaktionen auf den Verlust des Partners und die individuellen Voraussetzungen für Akzeptanz und Verarbeitung.
- Veranschaulichung der Beziehungen zwischen den Figuren, insbesondere zwischen den weiblichen Protagonisten und den männlichen Hauptfiguren.
- Analyse der Symbolsprache der Schauplätze und ihrer Bedeutung im Kontext der Handlung.
- Erörterung der religiösen Dimension in den Stücken und ihrer Einfluss auf das Verhalten der Figuren.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Charakterisierungen der weiblichen Protagonisten: Dieses Kapitel analysiert die Charaktere der weiblichen Hauptfiguren in beiden Stücken, insbesondere die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Stella und Amalie sowie Cäcilie und Mariane. Die Autorin hebt die Bedeutung der reinen Liebe und die Rechtfertigung des Verhaltens der Figuren durch diese hervor.
- Kapitel 2: Unterschiedliche Handhabung des Verlustes des Partners, charakterliche Voraussetzungen für Akzeptanz und Rezeption: Der Fokus liegt hier auf dem Umgang der weiblichen Figuren mit dem Verlust ihres Partners. Die Autorin analysiert die unterschiedlichen Reaktionen von Stella, Cäcilie und Mariane, die unterschiedliche Bewältigungsstrategien aufzeigen. Die Postmeisterin wird als Gegenbeispiel herangezogen, um die pragmatische Sichtweise auf den Verlust im Kontrast zu den romantisierten Vorstellungen anderer Figuren zu beleuchten.
- Kapitel 3: Die Verhältnisse der Frauengestalten in den Stücken zueinander: Dieses Kapitel untersucht die Interaktionen zwischen den weiblichen Figuren und ihre Beziehungen zueinander. Die Autorin geht insbesondere auf die Unterschiede zwischen Stella und Amalie sowie Cäcilie und Mariane ein und analysiert deren Rolle im Kontext der Handlung.
- Kapitel 4: Vergleich der beiden männlichen Protagonisten: Dieses Kapitel vergleicht die Charaktere der männlichen Hauptfiguren, insbesondere die Unterschiede in ihrem Verhalten und ihren Beziehungen zu den weiblichen Protagonisten.
- Kapitel 5: Veranschaulichung des Umgangs der Protagonisten miteinander an ausgewählten Szenen: Der Fokus liegt hier auf der Analyse ausgewählter Szenen, um die Interaktionen zwischen den Protagonisten und die Entwicklung der Handlung zu verdeutlichen.
- Kapitel 6: Der veränderte Schluss bei „Stella“ und die theoretische Möglichkeit einer Übertragung auf „Düval und Charmille“: Dieses Kapitel untersucht den veränderten Schluss von „Stella“ und die Möglichkeit, diesen auf „Düval und Charmille“ zu übertragen. Die Autorin analysiert die Auswirkungen der Änderungen auf die Handlung und die Interpretation des Stücks.
- Kapitel 7: Die Symbolik der Schauplätze bei „Stella“ und „Düval und Charmille“: Dieses Kapitel analysiert die Symbolik der Schauplätze und ihre Bedeutung im Kontext der Handlung. Die Autorin untersucht die räumlichen Gegebenheiten und ihre symbolische Aufladung.
- Kapitel 8: Die Beziehungen der Protagonisten zu Gott, ihre religiösen Empfindungen: Dieses Kapitel untersucht die religiösen Dimensionen in beiden Stücken und analysiert den Einfluss der Religion auf das Verhalten der Figuren.
- Kapitel 9: Die geschlechtsspezifische Rollenzuweisung der Protagonisten: Dieses Kapitel analysiert die Geschlechterrollen in beiden Stücken und untersucht die gesellschaftlichen Erwartungen an die Figuren.
- Kapitel 10: Subjektive Beurteilung der Verhaltensweisen der weiblichen Protagonisten: Dieses Kapitel bietet eine subjektive Bewertung der Verhaltensweisen der weiblichen Protagonisten. Die Autorin beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Entscheidungen der Figuren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Bürgerlichen Trauerspiels, insbesondere Liebe, Verlust, gesellschaftliche Normen, Geschlechterrollen und die Rolle der Religion. Die Analyse der Charaktere, ihrer Beziehungen und Handlungen steht im Vordergrund. Die beiden Werke „Düval und Charmille“ von Christiane Caroline Schlegel und „Stella“ von Johann Wolfgang Goethe dienen als Grundlage für den Vergleich und die Erörterung dieser Themen.
- Arbeit zitieren
- Wildis Streng (Autor:in), 2000, "Düval und Charmille" und "Stella" - ein Vergleich. Betrachtung und Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24482