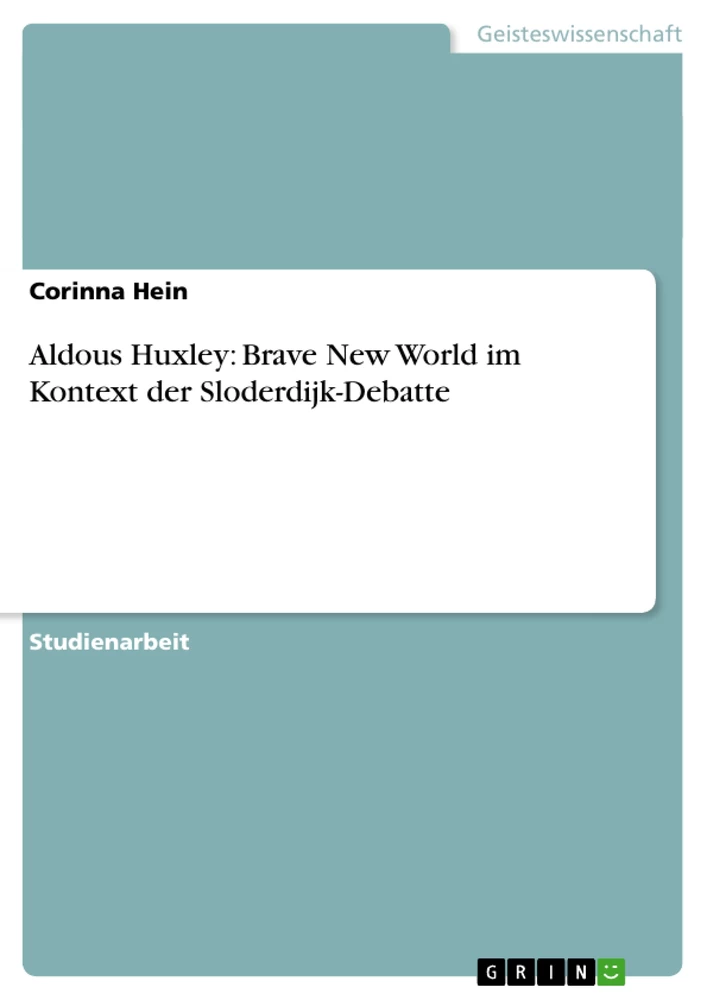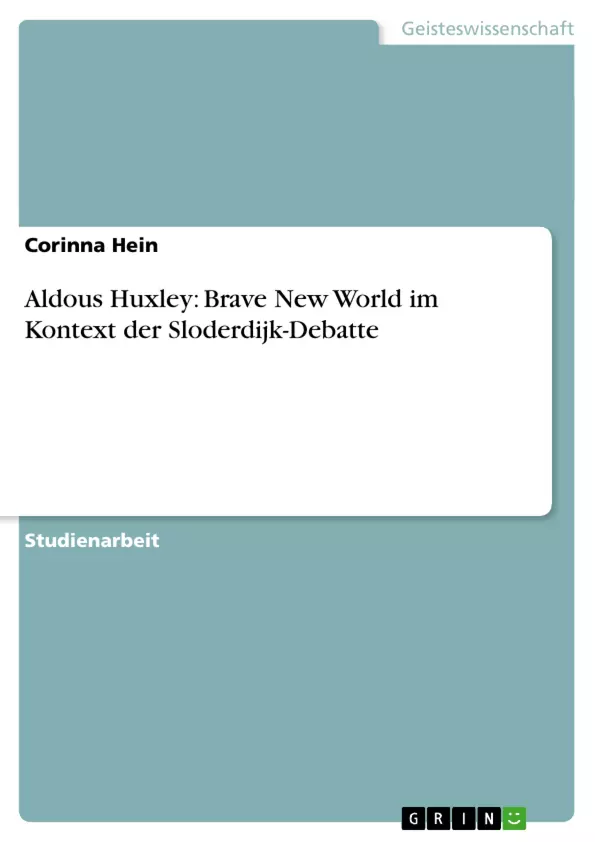Aldous Huxley entwickelte die Ideen zu seinem im Jahr 1932 geschriebenen Roman „Brave New World“ über viele Jahre hinweg. Er konnte nicht wissen, dass seine Vision einer auf Massenproduktion in Biologie und Ökonomie so schnell Realität werden würde. Tatsächlich war er davon überzeugt, dass seine Dystopie vielleicht in Hunderten von Jahren wahr werden könnte. Somit erschuf er eine im Grunde fiktionale Welt, die uns heute jedoch bereits seltsam real erscheint.
In dieser Arbeit wird zunächst in das literarische Genre der Utopie sowie in den Roman selbst eingeführt, dann auf Huxleys Utopie eingegangen und anschließend ein Einblick in die immer noch aktuelle Debatte um die Gentechnik gegeben.
Der biotechnologische Aspekt des Buches war in der vorliegenden Arbeit der wichtigste Diskussionspunkt. Doch es bieten sich weit mehr Parallelen zu Gegenwart. Man kann auf die große Werbemaschinerie blicken und sie mit Huxleys „Hypnopaedia“ vergleichen. Es gibt zwar noch keinen „Obstacle Golf“, aber die Industrie entwickelt von Jahr zu Jahr neue Spaß-Sportarten, Spiele und Autos – kurz: neue Produkte, die der Mensch konsumieren soll. Wir sind bereits Bestandteil der so genannten Konsumgesellschaft und sowohl die Wünsche der Menschen als auch ihre Moralvorstellungen passen sich diesen neuen Entwicklungen unaufhaltsam an. Daher bietet der Roman viel Raum für weitere Analysen und Vergleiche.
Deutlich wurde das Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in der „Sloterdijk-Debatte“. Die Rede des Philosophen Sloterdijk „Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus” war ursprünglich ein Beitrag zu einem Vortragszyklus über die Aktualität des Humanismus am 15.6.1997 in Basel. Anfang September 1999 löste der Artikel „Das Zarathustra-Projekt” von Thomas Assenheuer in „Die Zeit” die Diskussion, die bereits im Sommer 1999 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angeklungen war, um diese Rede auf der Elmauer Tagung aus. Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die diskutierten Thesen und zeigt, dass die „Schöne neue Welt“ technisch noch nicht völlig umsetzbar aber moralisch nah ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsangabe
- 1. Vorwort
- 2. Exkurs zur Themengenesis von „Brave New World”
- 3. Einführung in die Utopie und die negative Utopie
- 1. Die Utopie
- 2. Die negative Utopie
- II. Einführung
- 1. Vorwort
- 2. Exkurs zur Themengenesis von „Brave New World”
- 3. Einführung in die Utopie und die negative Utopie
- 1. Die Utopie
- 2. Die negative Utopie
- III. Aldous Huxley: Brave New World
- 1. Inhaltsangabe
- 2. Die Gesellschaft der negativen Utopie „Brave New World”
- 1. Stabilität
- 1. Soziale Stabilität
- 2. Wirtschaftliche Stabilität
- 2. Die Gegenwelt
- 3. Konflikte in einer konfliktlosen Welt
- IV. Die Sloterdijk - Debatte
- 1. Einführung
- 2. Peter Sloterdijk: Regeln für den Menschenpark
- 3. Die Debatte
- V. Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Aldous Huxleys Roman „Brave New World”, einer negativen Utopie, die eine Gesellschaft schildert, in der Menschen künstlich reproduziert und entsprechend ihrer zukünftigen Funktion im Staat geformt werden. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das literarische Genre der Utopie zu beleuchten, den Roman selbst einzuführen und einen Einblick in die aktuelle Debatte um die Gentechnik zu geben.
- Das literarische Genre der Utopie und die negative Utopie
- Aldous Huxleys visionäre Darstellung einer negativen Utopie
- Die gesellschaftliche Organisation und die Stabilität in „Brave New World”
- Die ethisch-moralischen Fragen und Konflikte im Zusammenhang mit der Gentechnik
- Die Debatte um die Gentechnik und ihre Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Die Inhaltsangabe gibt einen ersten Überblick über die Struktur und die Inhalte des Romans „Brave New World”.
- Kapitel II: In der Einleitung wird der Kontext des Romans vorgestellt. Es wird auf die Entstehungszeit und die Inspirationen Huxleys eingegangen und eine kurze Einführung in die Thematik der Utopie und der negativen Utopie gegeben.
- Kapitel III: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Gesellschaft der negativen Utopie in „Brave New World”. Es werden die Prinzipien der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität sowie die Gegenwelt und die Konflikte in dieser scheinbar konfliktlosen Welt beleuchtet.
Schlüsselwörter
Utopie, negative Utopie, Aldous Huxley, Brave New World, Gentechnik, Reproduktionstechnologie, Eugenik, soziale Stabilität, gesellschaftliche Kontrolle, ethisch-moralische Fragen, Debatte, Peter Sloterdijk, Menschenpark
- Quote paper
- Corinna Hein (Author), 2000, Aldous Huxley: Brave New World im Kontext der Sloderdijk-Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24622