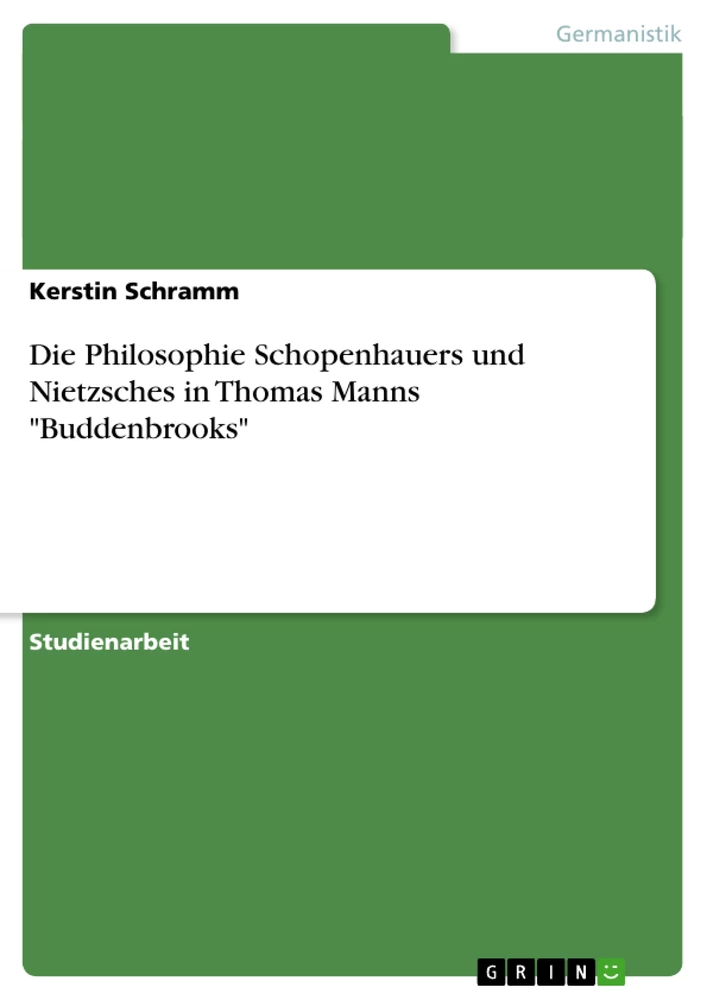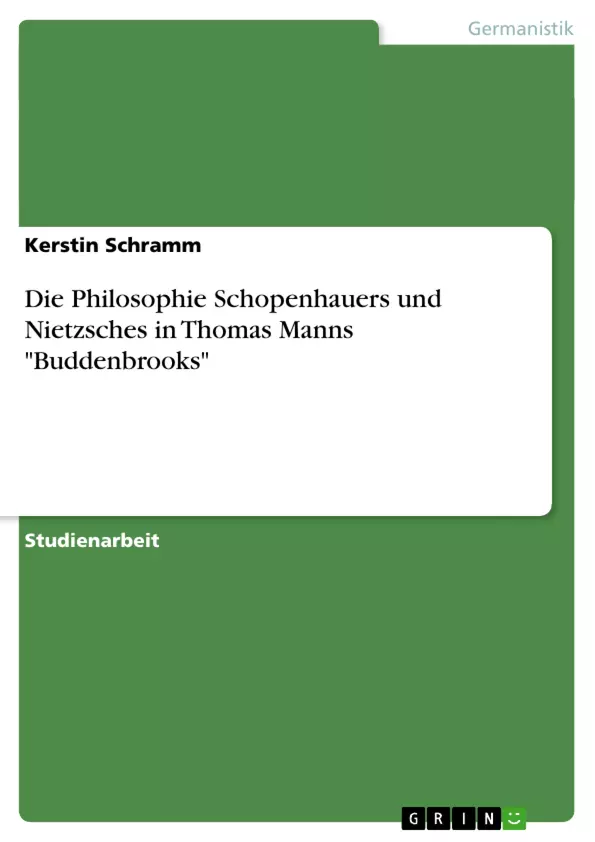Vorwort
Angeblich handelte es sich „bei Thomas Manns Verhältnis zur Philosophie […] recht besehen um ein Unverhältnis“1, die philosophischen Kenntnisse Thomas Manns seien gering gewesen. Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche aber wurden von Thomas Mann immer wieder herangezogen.
Thomas Manns intensive Schopenhauer-Lektüre ist nach eigenen Angaben in späteren Briefen im Jahre 1899 anzusiedeln. Eine Vordatierung auf 1895/1896 ist unwahrscheinlich, da die frühen Romankonzeptionen keine schopenhauerschen Motive zeigen und die Verarbeitung des Leseerlebnisses in den Buddenbrooks sich auf Thomas Buddenbrooks Schopenhauer- Rausch beschränkt und ein „auffallend untypisches Einsprengsel darstellt “2. Die Lektüre hingegen ist viel früher, schon im Jahre 1894 anzusetzen und streckte sich über Jahrzehnte hin. Thomas Mann soll sich nicht nur mit Nietzsches eigentlichem philosophischen Werk, sondern auch mit dessen Briefen und zahlreichen Werken über Nietzsche beschäftigt haben. Jedoch ist seine Nietzscheauffassung und -auslegung, je nach politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen argen Schwankungen unterworfen. Der Einfluss der Philosophie Schopenhauers auf die „Buddenbrooks“ ist umstritten. Nach Thomas Manns Selbstaussagen in einem Brief an Agnes E. Meyer vom Januar 1951 hat er Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“ erst kennen gelernt, als er bereits im letzten Drittel des Buches stand. „Aber außer diesem Kapitel ist nichts in dem Roman Produkt meiner Schopenhauer-Lektüre“. Später heißt es, „Schopenhauers pessimistische Moral, Nietzsche´s Décadence-Psychologie […] waren die Bildungselemente, die dem Erzählwerk des Dreiundzwanzig- bis Fünfundzwanzigjährigen (Thomas Mann), >Buddenbrooks< […] zur Gestalt verhalfen“3. Die Selbstaussagen Thomas Manns sind immer mit äußerst kritischem Blick zu betrachten und gründlich zu überprüfen, da sich Thomas Mann mit seinen Selbstkommentaren in die Tradition Lavaters und anderer öffentlicher autobiographische r Selbstdarstellungen einreihen lässt.
Die Forschung, insbesondere Hans Zeller, ist, unbeirrt der widersprüchlichen Selbstaussagen Thomas Manns, der Ansicht, daß der Roman in seiner gesamten Konzeption von der schopenhauerschen Philosophie geprägt und strukturiert ist.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Vorwort
- 2.0 Thomas Manns Schopenhauer-Leseerlebnis
- 2.1 Thomas Buddenbrooks Leseerlebnis
- 3.0 Schopenhauer-Lektüre als religiöses Erlebnis
- 4.0 Die Philosophie Schopenhauers und Nietzsches im Vergleich
- 4.1 Der Wille
- 4.2 Der Verstand
- 4.3 Die Lösungsmodelle
- 4.3.1 Schopenhauers Lösungsmodell
- 4.3.2 Nietzsches Lösungsmodell
- 5.0 „Kreativer Missbrauch“ der Philosophie bei Thomas Buddenbrook
- 6.0 Die Quintessenz des Romans aus Philosophischer Perspektive
- 7.0 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches auf Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“. Ziel ist es, die Rezeption und Verarbeitung dieser philosophischen Ideen im Roman aufzuzeigen und zu analysieren, insbesondere im Kontext der literarischen Décadence des Fin de Siècle. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, inwieweit und wie die philosophischen Konzepte in die Handlung und Charakterentwicklung eingeflochten sind.
- Rezeption der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches bei Thomas Mann
- Vergleich der philosophischen Systeme Schopenhauers und Nietzsches
- Die Rolle der Philosophie in der Charakterentwicklung von Thomas Buddenbrook
- Der Einfluss der Philosophie auf die Gesamtkonzeption des Romans
- Die Darstellung von Dekadenz und Lebenskrise im Kontext der philosophischen Einflüsse
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Vorwort: Das Vorwort thematisiert die kontroverse Diskussion um den tatsächlichen Einfluss der Philosophie auf Thomas Manns Werk. Es werden widersprüchliche Aussagen Manns selbst zitiert und die Forschungsmeinungen dazu gegenübergestellt. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse möglicher Spuren der Auseinandersetzung mit Schopenhauer und Nietzsche in den „Buddenbrooks“, insbesondere in Kapitel 5 des zehnten Teils.
2.0 Thomas Manns Schopenhauer-Leseerlebnis: Dieses Kapitel beschreibt Manns persönliches und intensives Leseerlebnis von Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“. Es wird die Bedeutung dieses Ereignisses für Mann hervorgehoben, wobei die Beschreibungen von „Erfülltheit“, „Hingerissenheit“ und „metaphysischem Rausch“ im Vordergrund stehen. Die Parallele zu Thomas Buddenbrooks Leseerlebnis wird bereits hier angedeutet, um die spätere Einarbeitung in den Roman vorwegzunehmen.
2.1 Thomas Buddenbrooks Leseerlebnis: Die Darstellung von Thomas Buddenbrooks Begegnung mit Schopenhauers Philosophie wird detailliert analysiert. Der Fokus liegt auf der intensiven Lesesession, der Beschreibung der emotionalen und intellektuellen Wirkung des Textes auf Buddenbrook und der Frage, ob dieses Kapitel als zentrales Element der Gesamtkomposition des Romans interpretiert werden kann, oder ob es als ein eher untypisches "Einsprengsel" betrachtet werden sollte. Die Wirkung der Lektüre wird als eine Art „Rausch“ geschildert, der seine Persönlichkeit nachhaltig beeinflusst.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Buddenbrooks, Schopenhauer, Nietzsche, Décadence, Fin de Siècle, Philosophie, Lebenskrise, Vitalität, Wille zum Leben, Welt als Wille und Vorstellung, literarische Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zu: Thomas Manns Buddenbrooks und der Einfluss von Schopenhauer und Nietzsche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Einfluss der Philosophie Arthur Schopenhauers und Friedrich Nietzsches auf Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“. Der Fokus liegt auf der Rezeption und Verarbeitung dieser philosophischen Ideen im Roman, insbesondere im Kontext der literarischen Décadence des Fin de Siècle. Es wird untersucht, wie die philosophischen Konzepte in die Handlung und Charakterentwicklung eingeflochten sind.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Rezeption der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches bei Thomas Mann, ein Vergleich der philosophischen Systeme Schopenhauers und Nietzsches, die Rolle der Philosophie in der Charakterentwicklung von Thomas Buddenbrook, der Einfluss der Philosophie auf die Gesamtkonzeption des Romans und die Darstellung von Dekadenz und Lebenskrise im Kontext der philosophischen Einflüsse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Ein Vorwort, das die kontroverse Diskussion um den Einfluss der Philosophie auf Manns Werk thematisiert; ein Kapitel über Manns persönliches Schopenhauer-Leseerlebnis; ein Kapitel über Thomas Buddenbrooks Leseerlebnis von Schopenhauer; ein Kapitel, das Schopenhauers und Nietzsches Philosophie vergleicht (mit Unterkapiteln zu Wille, Verstand und Lösungsmodellen); ein Kapitel über den "kreativen Missbrauch" der Philosophie bei Thomas Buddenbrook; ein Kapitel zur Quintessenz des Romans aus philosophischer Perspektive; und ein Schlusswort.
Welche Rolle spielt das Leseerlebnis von Schopenhauer in der Arbeit?
Das Leseerlebnis von Schopenhauer, sowohl bei Thomas Mann persönlich als auch bei seinem Romanhelden Thomas Buddenbrook, wird als zentrales Thema behandelt. Manns intensives und fast religiöses Leseerlebnis wird beschrieben, und die Parallele zu Buddenbrooks emotionaler und intellektueller Reaktion auf Schopenhauers "Welt als Wille und Vorstellung" wird detailliert analysiert. Die Frage, ob Buddenbrooks Lektüre ein zentrales Element der Romanhandlung ist oder eher ein "Einsprengsel", wird diskutiert.
Wie werden Schopenhauer und Nietzsche verglichen?
Die Arbeit vergleicht die philosophischen Systeme Schopenhauers und Nietzsches, insbesondere hinsichtlich ihres Verständnisses von Wille und Verstand und ihren jeweiligen Lösungsmodellen für die menschlichen Probleme. Dieser Vergleich dient dazu, die philosophischen Einflüsse auf den Roman besser zu verstehen.
Was ist die Quintessenz der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss von Schopenhauer und Nietzsche auf Thomas Manns „Buddenbrooks“ aufzuzeigen und zu analysieren. Sie untersucht, wie philosophische Konzepte die Handlung, die Charakterentwicklung und die Gesamtkonzeption des Romans prägen, insbesondere im Kontext der Dekadenz des Fin de Siècle. Die detaillierte Analyse des Leseerlebnisses von Schopenhauer bei Mann und Buddenbrook bildet einen zentralen Aspekt der Untersuchung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas Mann, Buddenbrooks, Schopenhauer, Nietzsche, Décadence, Fin de Siècle, Philosophie, Lebenskrise, Vitalität, Wille zum Leben, Welt als Wille und Vorstellung, literarische Rezeption.
- Arbeit zitieren
- Kerstin Schramm (Autor:in), 2004, Die Philosophie Schopenhauers und Nietzsches in Thomas Manns "Buddenbrooks", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24657