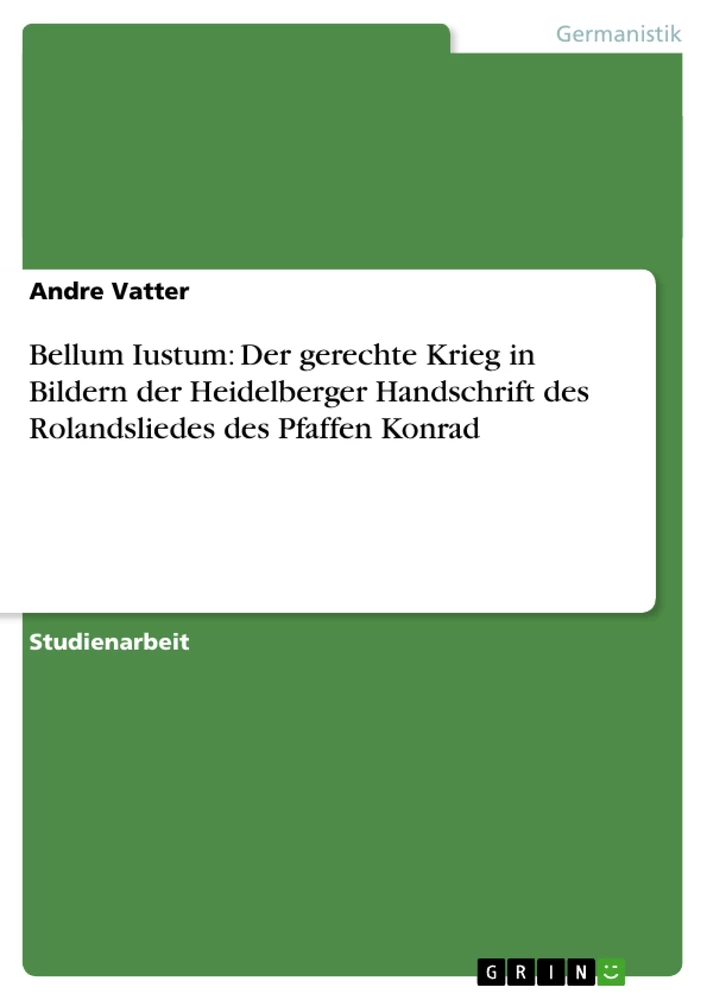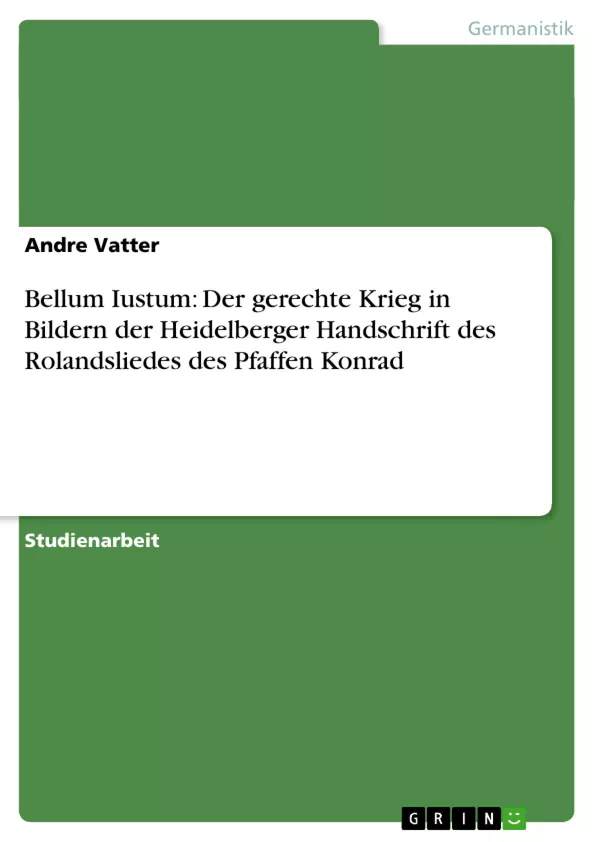Besprochen werden die Hintergründe der Entstehung des Rolandslieds, zudem wird eine detaillierte Analyse der 39 Federzeichnungen geboten. Letztlich finden sich fünf Deutungsansätze zu den Miniaturen, ihren Intentionen und Funktionsweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad.
- Das Rolandslied im Detail.
- CPG 112: Die Geschichte der Heidelberger Handschrift.
- Text- u. Bildvarianten: Weitere Überlieferungen des Rolandslieds.
- Scriptura: Der Text der Heidelberger Handschrift.
- Pictura: Die Zeichnungen der Heidelberger Handschrift.
- Allgemeine Feststellungen.
- Original / Kopie: der Bilderzyklus der Heidelberger Handschrift.
- Superbia librorum: Über die Schlichtheit der Bilder.
- Schrift und Bild: Differenzen und Korrespondenzen.
- Funktionsweisen und Gebrauch der Zeichnungen.
- Das Triptychon: Ein theologisches Bild- und Literaturprogramm.
- Kunst und Krieg: Auf der Suche nach göttlicher Legitimierung.
- Bellum iustum: Der gerechte Krieg in Bildern.
- Memoris: Bilder und ihre Rolle im Erinnerungsdiskurs.
- Incarnazione: die Fleischwerdung im Bild.
- Ein Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Heidelberger Handschrift des Rolandsliedes des Pfaffen Konrad und analysiert das Verhältnis von Text und Bild in diesem einzigartigen Codex. Sie beleuchtet die medialen Möglichkeiten der Bilder in einer neuen Schriftkultur und bietet konkrete Interpretationen ihres Einsatzes.
- Die Geschichte der Heidelberger Handschrift (CPG 112) und ihre Bedeutung im Kontext der Buch- und Bibliotheksgeschichte.
- Die Analyse der Miniaturen als mediales Element und deren Funktion im Text-Bild-Verhältnis.
- Die Rolle der Bilder im Erinnerungsdiskurs und ihre Verbindung zum theologischen Programm des Codex.
- Die Interpretation der Bilder im Kontext des "Bellum iustum" und der Suche nach göttlicher Legitimierung für den Krieg.
- Die Bedeutung der Schriftkultur und die Rezeption der Bilder im Spannungsfeld von Original und Kopie.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Der Einleitungsteil gibt einen kurzen Überblick über das Rolandslied als deutsches Chanson de geste, Kreuzzugsepos und historiographische Biographie. Er stellt die Heidelberger Handschrift als den ersten bebilderten Codex der Sage um den Spanienfeldzug Karls des Großen vor und hebt die Bedeutung der Miniaturen für die paläographische Forschung hervor.
- Kapitel 2: Das Rolandslied im Detail. Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Heidelberger Handschrift (CPG 112) und setzt sie in den Kontext der Bibliotheksgeschichte. Es geht zudem auf die Text- und Bildvarianten in anderen Überlieferungen des Rolandsliedes ein und stellt die Straßburger Handschrift A als vergleichbaren Codex mit ähnlichen Miniaturen vor.
- Kapitel 3: Scriptura: Der Text der Heidelberger Handschrift. Dieser Abschnitt analysiert die typographischen Merkmale des Textes der Heidelberger Handschrift, beleuchtet die Frage nach dem Schreiber und untersucht die Qualität der verwendeten Tinte.
- Kapitel 4: Pictura: Die Zeichnungen der Heidelberger Handschrift. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Miniaturen der Heidelberger Handschrift und analysiert ihre Bedeutung und Funktion. Es beleuchtet die Frage nach Original und Kopie und untersucht die Schlichtheit der Bilder im Kontext der "Superbia librorum".
- Kapitel 5: Funktionsweisen und Gebrauch der Zeichnungen. Dieses Kapitel untersucht die Funktionsweisen und den Gebrauch der Miniaturen in der Heidelberger Handschrift. Es analysiert das Triptychon als theologisches Bild- und Literaturprogramm, die Suche nach göttlicher Legitimierung für den Krieg und die Rolle der Bilder im Erinnerungsdiskurs.
Schlüsselwörter
Das Rolandslied des Pfaffen Konrad, Heidelberger Handschrift (CPG 112), Text-Bild-Verhältnis, Miniaturen, Schriftkultur, "Bellum iustum", theologisches Programm, Erinnerungsdiskurs, Original und Kopie, "Superbia librorum".
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Rolandslied“ des Pfaffen Konrad?
Das Rolandslied ist ein mittelhochdeutsches Epos aus dem 12. Jahrhundert, das den Spanienfeldzug Karls des Großen und den Heldentod Rolands als christlichen Kreuzzug darstellt.
Was bedeutet der Begriff „Bellum Iustum“?
„Bellum Iustum“ steht für den „gerechten Krieg“. Im Kontext des Rolandsliedes dient er der theologischen Rechtfertigung des Kampfes gegen Nichtchristen als gottgewolltes Werk.
Warum ist die Heidelberger Handschrift (CPG 112) so bedeutend?
Sie ist der erste bebilderte Codex der Rolandssage und bietet durch ihre 39 Federzeichnungen wertvolle Einblicke in das Zusammenspiel von Text und Bild im Mittelalter.
Welche Funktion haben die Miniaturen in der Handschrift?
Die Bilder dienten nicht nur der Illustration, sondern auch der theologischen Untermauerung des Textes, als Gedächtnisstütze (Memoria) und zur Veranschaulichung der göttlichen Legitimierung des Krieges.
Was bedeutet „Superbia librorum“?
Der Begriff bezieht sich auf den Stolz oder die Pracht von Büchern. In der Arbeit wird untersucht, warum die Bilder in der Heidelberger Handschrift trotz des hohen Anspruchs des Werkes auffallend schlicht gehalten sind.
- Citation du texte
- Andre Vatter (Auteur), 2004, Bellum Iustum: Der gerechte Krieg in Bildern der Heidelberger Handschrift des Rolandsliedes des Pfaffen Konrad, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24757