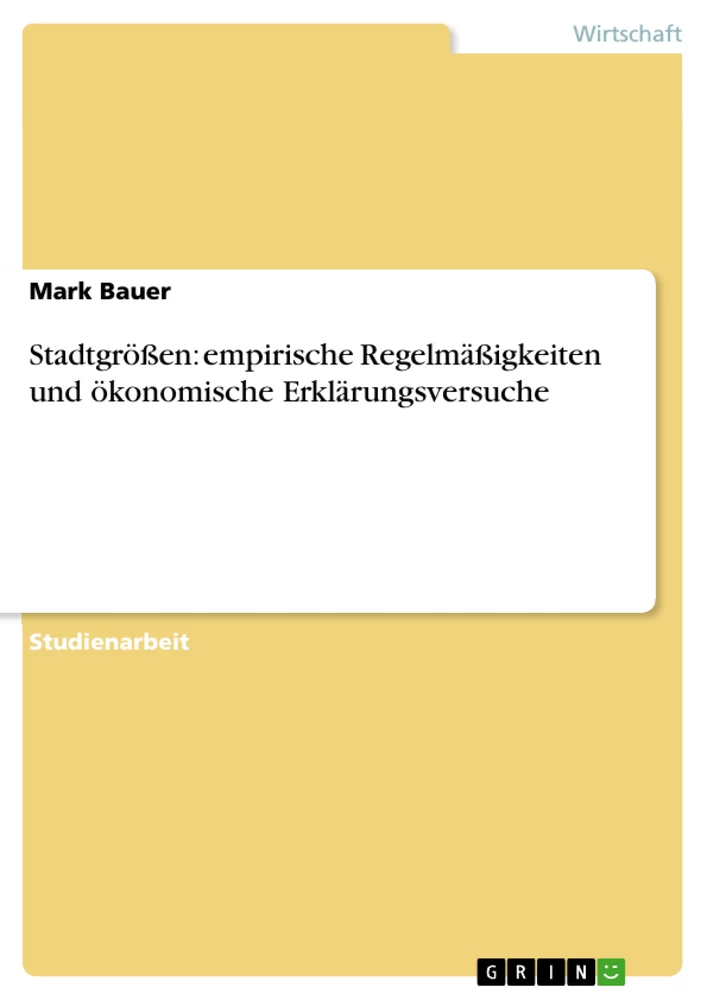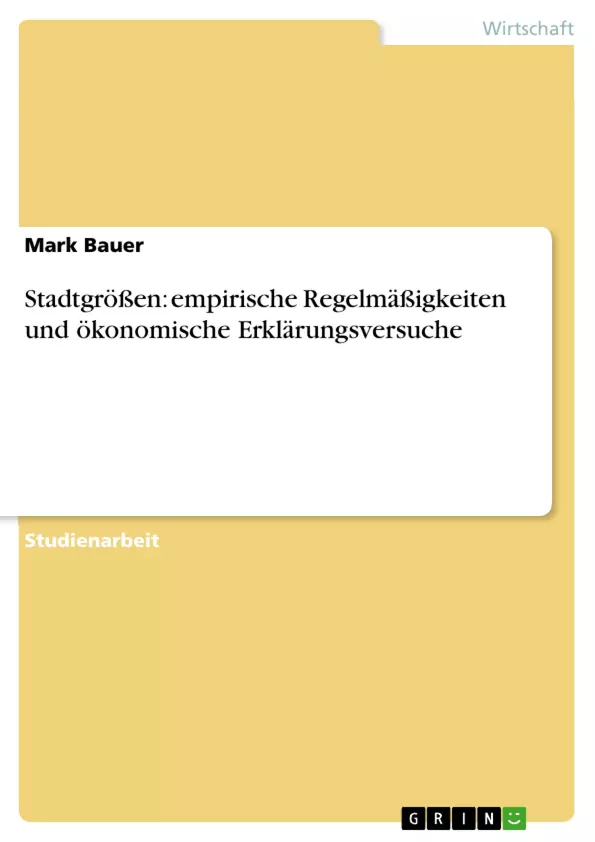Einleitung
Viele wirtschaftswissenschaftliche Modelle arbeiten mit Aggregationsniveaus, die die räumliche Verteilung der Wirtschaftssubjekte nicht, oder nur implizit, berücksichtigt. So werden z.B. die Haushalte und Unternehmen jeweils zu Gruppen zusammengefasst, um so später globale Aussagen treffen zu können, ohne jedes einzelne Wirtschaftssubjekt beschreiben zu müssen. Die Vernachlässigung der räumlichen Aufteilung ist für die meisten Modelle problemlos oder zumindest aus Gründen der Übersichtlichkeit und Beherrschbarkeit soweit vertretbar, als dass die Nachteile der geringeren Detailliertheit von den Vorteilen des „Handlings“ dieser Modelle aufgewogen werden.
Der Student der Ökonomie kann jedoch vor allem im Grundstudium den Eindruck gewinnen, dass eine räumliche Betrachtung ökonomischer Sachverhalte nur peripher zum umfassenden volkswirtschaftlichen Verständnis beiträgt. Dem ist jedoch bei weitem nicht so. Vielmehr wird dieses Verständnis durch die Beschäftigung mit Regionalökonomik und –politik vertieft und es werden Einblicke vermittelt, die für eine umfassende volkswirtschaftliche Analyse unerlässlich sind.
Ein wichtiger Teilaspekt der Regionalökonomik ist die Betrachtung von Städten als Ballung von Haushalten und Unternehmen, Standort von Märkten, Zentrum von Innovationskräften, etc. Dabei treten verschiedene Fragestellungen auf:
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Messung von Stadtgrößen
- 2.1 Bevölkerung
- 2.2 Fläche
- 2.3. Dichte
- 2.4. Bedeutung oder Zentralität
- 2.5 Fazit
- 3. Empirische Regelmäßigkeiten der Stadtgrößen-verteilung
- 3.1 Rang-Größen-Verteilung
- 3.2 Rank Size Rule
- 3.3 Beispiele für die Rang-Größen-Verteilung
- 3.3.1 Stadtgrößenverteilung Deutschlands
- 3.3.2 Stadtgrößenverteilung der USA
- 3.3.3 Stadtgrößenverteilung Frankreichs
- 3.3.4 Stadtgrößenverteilung Brasiliens
- 3.3.5 Zusammenfassung der Beispiele
- 4. Übersicht über wichtige stadtökonomische Modelle und Erklärungsgehalt für die Beobachtungen
- 4.1 Theorie der zentralen Orte
- 4.2 Henderson Modell
- 4.3 Optimale Stadtgröße
- 3.2.1 Ansatz der minimalen kommunalen Kosten
- 3.2.2 Ansatz der maximalen Differenz
- 4.4 Modelle zufälligen Wachstums
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht empirische Regelmäßigkeiten in der Verteilung von Stadtgrößen und analysiert verschiedene ökonomische Modelle, die diese Beobachtungen erklären können.
- Messung von Stadtgrößen und deren Bedeutung für die Analyse von Stadtentwicklungen
- Empirische Regelmäßigkeiten der Stadtgrößenverteilung, insbesondere die Rang-Größen-Verteilung und die Rank Size Rule
- Analyse verschiedener stadtökonomischer Modelle, wie die Theorie der zentralen Orte, das Henderson Modell und Modelle zufälligen Wachstums
- Bewertung des Erklärungsgehalts der Modelle für die beobachteten empirischen Regelmäßigkeiten
- Diskussion der Implikationen für die Stadt- und Regionalpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Stadtgrößen ein und erläutert die Bedeutung der Messung von Stadtgrößen. Kapitel 2 analysiert empirische Regelmäßigkeiten der Stadtgrößenverteilung, insbesondere die Rang-Größen-Verteilung und die Rank Size Rule. Es werden Beispiele aus verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, USA, Frankreich und Brasilien, vorgestellt. Kapitel 3 bietet einen Überblick über wichtige stadtökonomische Modelle, die versuchen, die beobachteten Regelmäßigkeiten zu erklären. Diese Modelle umfassen die Theorie der zentralen Orte, das Henderson Modell, Modelle der optimalen Stadtgröße und Modelle zufälligen Wachstums.
Schlüsselwörter
Stadtgrößen, empirische Regelmäßigkeiten, Rang-Größen-Verteilung, Rank Size Rule, Stadtökonomische Modelle, Theorie der zentralen Orte, Henderson Modell, Optimale Stadtgröße, Modelle zufälligen Wachstums, Stadt- und Regionalpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Stadtgrößen in der Ökonomie gemessen?
Messgrößen sind unter anderem die Bevölkerungszahl, die Fläche, die Bevölkerungsdichte sowie die Zentralität oder Bedeutung einer Stadt.
Was besagt die „Rank Size Rule“?
Diese empirische Regelmäßigkeit besagt, dass die Größe einer Stadt umgekehrt proportional zu ihrem Rang in der Städtehierarchie eines Landes steht.
Was ist die Theorie der zentralen Orte?
Sie erklärt die räumliche Verteilung von Städten basierend auf ihrer Funktion als Versorgungszentren für das Umland.
Gibt es eine „optimale Stadtgröße“?
Modelle zur optimalen Stadtgröße untersuchen das Gleichgewicht zwischen minimalen kommunalen Kosten und maximalem Nutzen für die Bewohner.
Was sind Modelle zufälligen Wachstums?
Diese stadtökonomischen Modelle erklären die Größenverteilung von Städten als Ergebnis stochastischer Prozesse über lange Zeiträume.
- Citar trabajo
- Mark Bauer (Autor), 2001, Stadtgrößen: empirische Regelmäßigkeiten und ökonomische Erklärungsversuche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2477