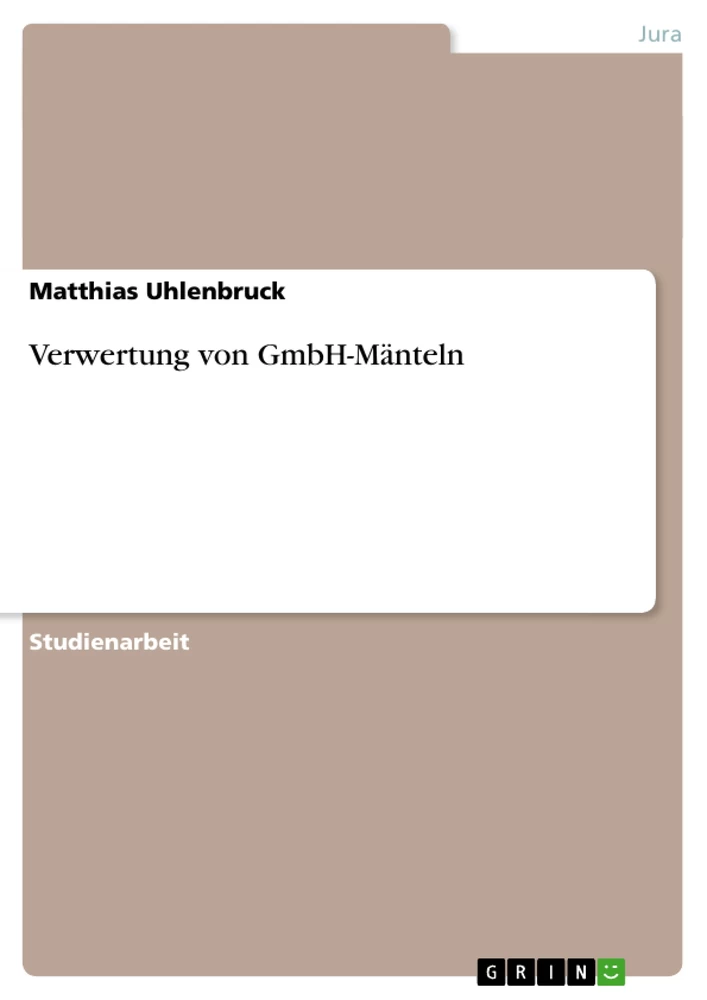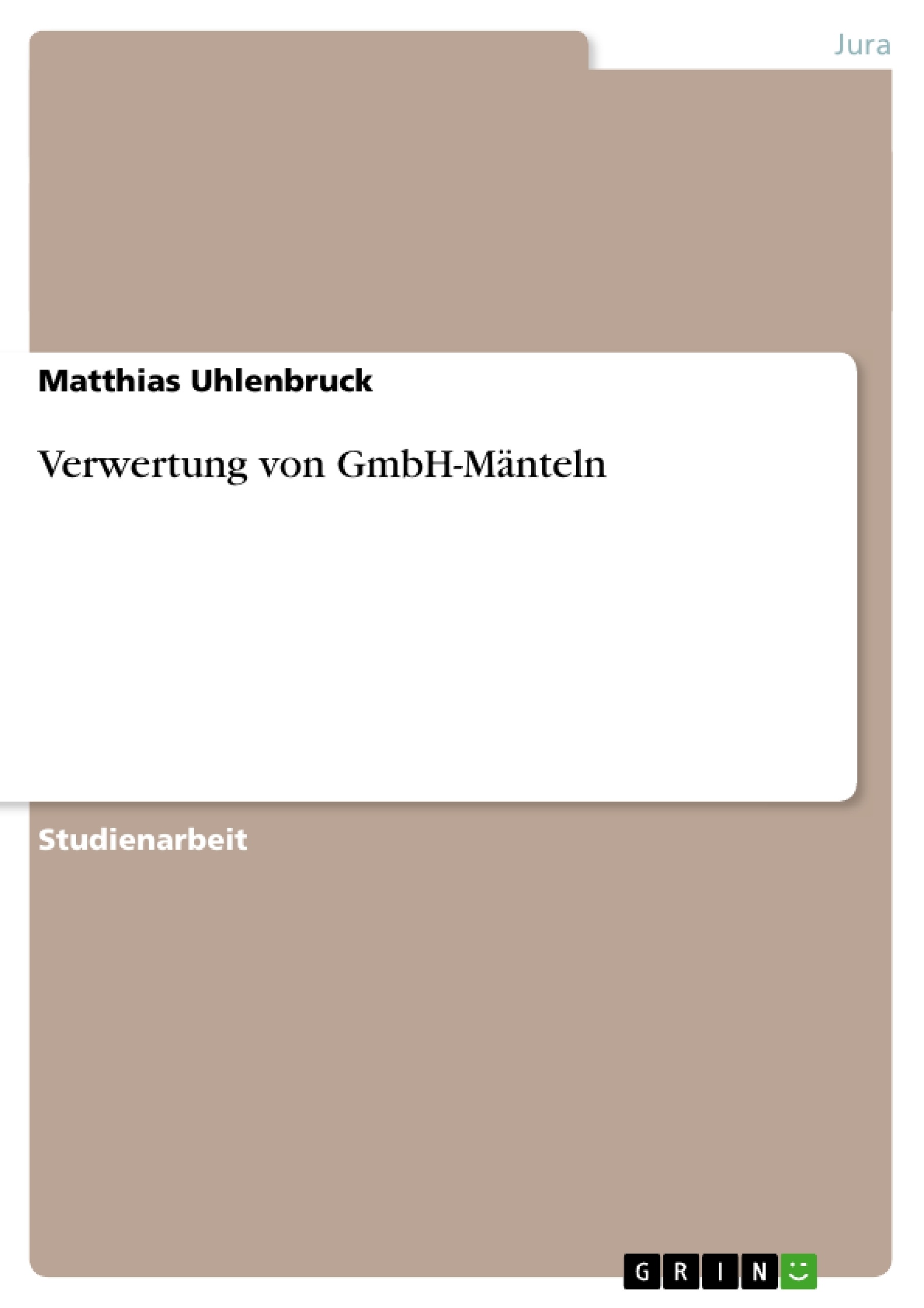Ein kurzer Blick ins Internet zeigt: Es wird ein reger Handel mit GmbHMänteln betrieben. Grund hierfür ist zunächst, dass die Bedeutung der GmbH als Rechtsform zur Unternehmensführung stark zugenommen hat. Ihre Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht, wobei 95 % der in den letzten 20 Jahren neu eingetragenen 270.000 GmbH´s als Vorratsgesellschaft gegründet worden sein dürften.Die Entstehung und Begründung einer GmbH setzt voraus, dass sie im Handelsregister eingetragen wird. Erst dann greifen die Haftungsbeschränkungen. Für die Gründer einer GmbH ergibt sich damit die Gefahr, dass bis zur Eintragung im Handelsregister eine Haftungsbeschränkung ausgeschlossen ist. Um die damit verbundenen Risiken möglichst zu minimieren, wurde in der Praxis die Möglichkeit geschaffen, eine Vorratsgesellschaft oder einen GmbH-Mantel zu erwerben und zu verwerten.
Eine solche Vorgehensweise mag aus ökonomischen Sicht durchaus sinnvoll sein; aber es stellt sich die Frage, wie die Verwertung von GmbH-Mänteln rechtlich einzuordnen ist. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Zuerst erfolgt eine Begriffsklärung. Dann wird dargelegt, unter welchen Voraussetzungen die Verwertung von GmbH-Mänteln grundsätzlich rechtmäßig ist. Im Anschluss daran wird behandelt, wie die Verwertung eines GmbH-Mantels rechtlich zu erfolgen hat. Schließlich wird noch der Frage nachgegangen, ob die Verwendung einer britischen Ltd. eine sinnvolle Alternative zur Verwertung eines GmbHMantels darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Der Begriff „,GmbH-Mantel“
- I. Vorratsgesellschaften
- II. GmbH-Mantel
- B. Gründe für die Mantel- und Vorratsgründung
- I. Verminderung von Haftungsrisiken
- II. Vermeidung von Gründungsverzögerungen
- III. Sonstige Gründe
- C. Zulässigkeit von Mantelgründungen
- I. Verdeckte Mantelgründungen
- II. Offene Mantelgründungen
- D. Der Mantelkauf
- I. Wirksamkeit des Vertrages
- 1. Kein Scheingeschäft nach § 117 BGB
- 2. Kein Verstoß nach § 134 BGB i.V.m. § 3 II Nr. 2 GmbHG
- 3. Kein Verstoß gegen § 138 BGB
- II. Analoge Anwendung der GmbH-Gründungsvorschriften?
- 1. Teil der Lehre: lehnt analoge Anwendung ab
- 2. Die herrschende Meinung: bejaht die analoge Anwendung
- 3. Stellungnahme
- III. Abgrenzung zur Umstrukturierung bzw. Sanierung GmbH
- 1. Teile der Lehre: auf Indizien achten
- 2. Der BGH: aktives Unternehmen ist entscheidend
- 3. Stellungnahme
- IV. GmbH-Haftung: Gläubigerschutz durch Kapitalaufbringung
- 1. Teile der Lehre: Kapitalgarantie nicht erforderlich
- 2. Herrschende Lehre: gesetzliches Mindeststammkapital reicht
- 3. Rechtsprechung: satzungsmäßiges Stammkapital nötig
- 4. Stellungnahme
- V. Haftung der GmbH-Gesellschafter und -Geschäftsführer
- 1. Teile der Lehre: GmbH-Haftung genügt
- 2. Herrschende Meinung: Haftung analog § 11 II GmbHG
- 3. Stellungnahme
- E. Ist die englische Ltd. eine Alternative zum GmbH-Mantel?
- I. Die EuGH-Rechtsprechung
- II. Das deutsche Schrifttum
- 1. Herrschende Literatur
- 2. Teile der Lehre
- 3. Stellungnahme
- III. Praktische Konsequenzen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff des „GmbH-Mantels“ und seinen rechtlichen Implikationen. Sie untersucht die Entstehung, Zulässigkeit und rechtliche Grenzen der Verwendung von Mantelgesellschaften sowie die haftungsrechtlichen Besonderheiten des Mantelkaufes.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „GmbH-Mantel“
- Rechtliche Grundlagen und Zulässigkeit von Mantelgründungen
- Haftungsrechtliche Aspekte des Mantelkaufes
- Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten wie Umstrukturierung und Sanierung
- Alternativen zum GmbH-Mantel, insbesondere die englische Ltd.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des „GmbH-Mantels“ ein und erläutert die Grundzüge dieses Begriffs. Sie beleuchtet verschiedene Arten von Mantelgesellschaften und die Gründe für deren Gründung.
Kapitel A definiert den Begriff „GmbH-Mantel“ und unterscheidet zwischen Vorratsgesellschaften und GmbH-Mänteln. Es werden die verschiedenen Gründe für die Mantelgründung beleuchtet, wobei insbesondere die Vermeidung von Haftungsrisiken und Gründungsverzögerungen im Vordergrund stehen.
Kapitel B behandelt die rechtliche Zulässigkeit von Mantelgründungen. Es wird zwischen verdeckten und offenen Mantelgründungen unterschieden und die rechtlichen Rahmenbedingungen für beide Formen beleuchtet.
Kapitel C analysiert den Mantelkauf im Detail. Es werden die Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Mantelkaufvertrages untersucht und die Frage der analogen Anwendung der GmbH-Gründungsvorschriften behandelt.
Kapitel D befasst sich mit der Abgrenzung des Mantelkaufes von anderen Rechtsformen wie Umstrukturierung und Sanierung. Es werden die relevanten Rechtsprechung des BGH und die verschiedenen Ansichten in der Lehre vorgestellt.
Kapitel E untersucht die Haftung der GmbH-Gesellschafter und -Geschäftsführer im Zusammenhang mit dem Mantelkauf. Es werden verschiedene Meinungen in der Literatur dargestellt und die Rechtslage zum Gläubigerschutz durch Kapitalaufbringung beleuchtet.
Kapitel F beschäftigt sich mit der Frage, ob die englische Ltd. eine Alternative zum GmbH-Mantel darstellt. Es werden die relevanten EuGH-Rechtsprechung und die Meinungen im deutschen Schrifttum vorgestellt.
Schlüsselwörter
GmbH-Mantel, Vorratsgesellschaft, Mantelgründung, Mantelkauf, Haftungsrisiken, Gründungsverzögerungen, Gläubigerschutz, Kapitalaufbringung, GmbH-Haftung, Ltd., Rechtsprechung, Rechtslehre.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein GmbH-Mantel?
Ein GmbH-Mantel ist eine bereits im Handelsregister eingetragene Gesellschaft, die keinen aktiven Geschäftsbetrieb mehr hat, aber als rechtliche Hülle weiterverkauft wird.
Warum werden GmbH-Mäntel oder Vorratsgesellschaften gekauft?
Hauptgründe sind die sofortige Haftungsbeschränkung ab Erwerb und die Vermeidung von Zeitverzögerungen durch das langwierige Gründungsverfahren.
Ist die Mantelgründung rechtlich zulässig?
Ja, man unterscheidet zwischen offener und verdeckter Mantelgründung, wobei die Rechtsprechung (BGH) strenge Regeln zur Kapitalaufbringung aufgestellt hat.
Welche Haftungsrisiken bestehen beim Kauf eines Mantels?
Gesellschafter und Geschäftsführer können analog zur Neugründung haften, wenn das Stammkapital zum Zeitpunkt der wirtschaftlichen Neugründung nicht real vorhanden ist.
Ist die britische Ltd. eine gute Alternative zum GmbH-Mantel?
Die Arbeit untersucht die EuGH-Rechtsprechung und stellt praktische Konsequenzen sowie Vor- und Nachteile der Ltd. gegenüber dem deutschen GmbH-Mantel dar.
- Arbeit zitieren
- Matthias Uhlenbruck (Autor:in), 2004, Verwertung von GmbH-Mänteln, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24823