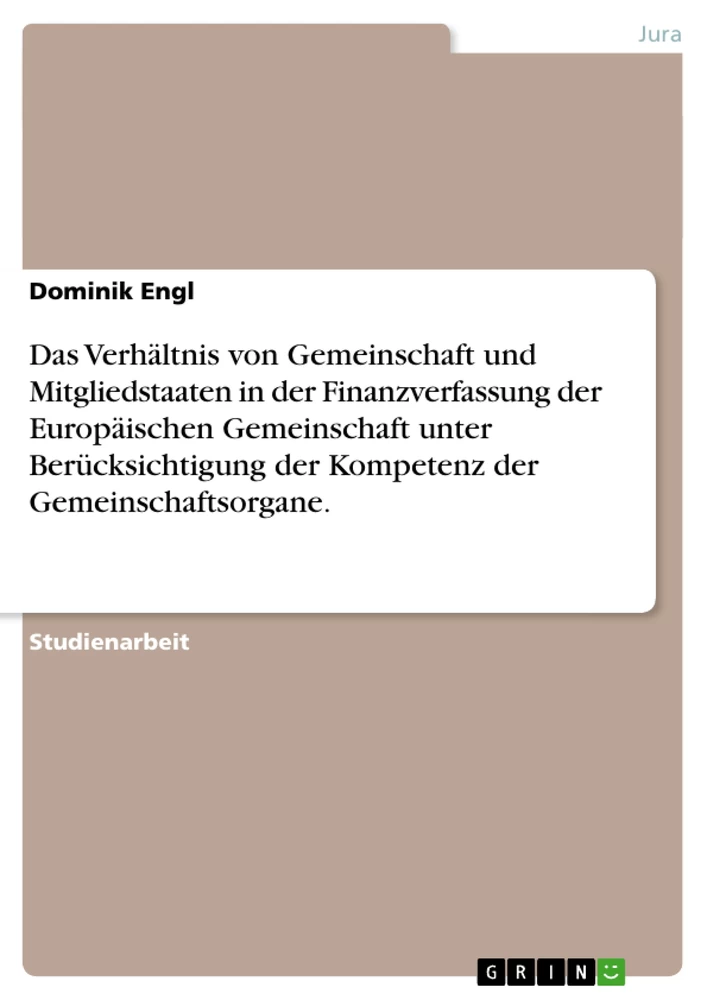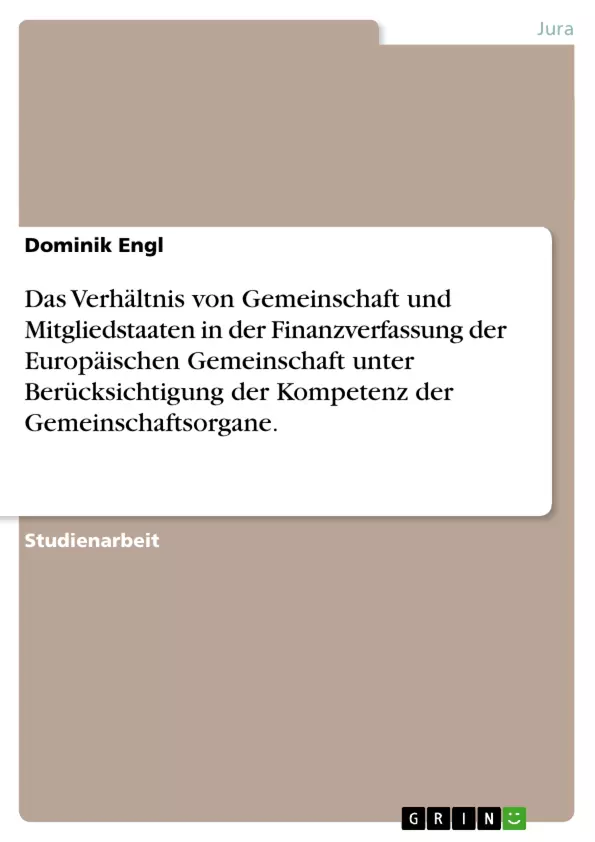In dieser Arbeit wird das Verhältnis der Mitgliedstaaten zur Europäischen Gemeinschaft in der Finanzverfassung der Europäischen Gemeinschaft unter Berücksichtigung der Kompetenz der Gemeinschaftsorgane untersucht. Das grundsätzliche Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft ergibt sich zunächst aus dem freien Entschluss der Mitgliedstaaten zum Abschluss der Gemeinschaftsverträge. Die Mitgliedstaaten sind also die „Herren der Verträge“. Auch ist es ohne die Mitwirkung der mitgliedstaatlichen Organteile nicht möglich die Verträge zu ändern. Allerdings darf dieser Titel nicht als ein Über- und Unterordnungsverhältnis missverstanden werden, denn die Gemeinschaft hat mittlerweile fast in allen Bereichen (mit)bestimmenden Einfluss auf die Mitgliedstaaten gewonnen1. In dieser Arbeit soll der Focus auf dieses Verhältnis, nämlich zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, in der Finanzverfassung gelegt werden. Die Mitgliedstaaten direkt selbst haben kaum Einfluss auf die Haushalt svorgänge, allerdings können sie über die Organe, v.a. im Rat, entscheidend mitwirken. Es gilt also auch die Kompetenz der einzelnen Gemeinschaftsorgane in der Finanzverfassung der Gemeinschaft genauer zu untersuchen. Die Finanzierung der Gemeinschaft erfolgt über ein sog. „Eigenmittelsystem“, dessen Last teilweise von den Mitgliedstaaten getragen werden muss. Weiterhin soll noch ein kurzer Überblick über die Ausgabearten der Gemeinschaft gegeben werden, damit nachvollzogen werden kann, wofür die Finanzmittel der Gemeinschaft verwendet werden. 1 Arndt, Hans-Wolfgang, Europarecht, S. 81 f:
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Finanzordnung der Gemeinschaft
- I. Finanzrechtliche Bestimmungen
- II. Finanzhoheit
- 1. Rechtsetzungshoheit
- 2. Ertragshoheit
- 3. Ausgabenhoheit
- 4. Verwaltungshoheit
- III. Finanzhoheit und Finanzautonomie der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten
- B. Entwicklung des Haushaltsrechts
- C. Haushaltsplan
- I. Haushaltsverfahren
- II. Rechtsnatur
- III. Einnahmen
- 1. Entwicklung des Eigenmittelsystems der Gemeinschaft
- 2. Verfahren zur Entstehung der Eigenmittelbeschlüsse und deren Rechtsnatur
- 3. Der Begriff der Eigenmittel
- 4. Arten der Eigenmittel
- a. Agrarabschöpfungen
- b. Zölle
- c. Eigenmittel aus dem mitgliedstaatlichen Mehrwertsteueraufkommen
- d. Eigenmittel auf der Grundlage der mitgliedstaatlichen Bruttosozialprodukte
- e. sonstige Einnahmen
- 5. Kreditfinanzierung
- 6. Beitragsgerechtigkeit der Mitgliedstaaten
- IV. Ausgaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis der Mitgliedstaaten zur Europäischen Gemeinschaft in der Finanzverfassung der Europäischen Gemeinschaft unter Berücksichtigung der Kompetenz der Gemeinschaftsorgane. Die Arbeit untersucht, wie die Finanzhoheit der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten ausgeübt wird, wie die Finanzverfassung der Gemeinschaft sich entwickelt hat, und wie das Haushaltsrecht der Gemeinschaft funktioniert.
- Die Finanzverfassung der Europäischen Gemeinschaft
- Die Finanzhoheit der Europäischen Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten
- Die Kompetenz der Gemeinschaftsorgane in der Finanzverfassung
- Das Haushaltsrecht der Europäischen Gemeinschaft
- Das Eigenmittelsystem der Europäischen Gemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Verhältnisses zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Gemeinschaft in der Finanzverfassung. Es wird hervorgehoben, dass die Mitgliedstaaten die „Herren der Verträge“ sind, aber die Gemeinschaft mittlerweile einen starken Einfluss auf die Mitgliedstaaten gewonnen hat.
A. Finanzordnung der Gemeinschaft
I. Finanzrechtliche Bestimmungen
Dieser Abschnitt behandelt die finanzrechtlichen Normen, die in den europäischen Verträgen verteilt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass es kein einheitliches Regelwerk gibt und die Normierung in den Verträgen nur als Ansatz einer Finanzverfassung angesehen werden kann.
II. Finanzhoheit
Dieser Abschnitt beschreibt die Finanzhoheit der Gemeinschaft, die sich aus der Rechtsetzungshoheit, Ertragshoheit, Ausgabenhoheit und Verwaltungshoheit zusammensetzt. Es wird erörtert, wie die Gemeinschaft diese Finanzhoheit im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten ausübt.
III. Finanzhoheit und Finanzautonomie der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten
Dieser Abschnitt behandelt die Finanzhoheit und Finanzautonomie der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten. Es wird erörtert, wie die Gemeinschaft ihre Finanzautonomie gegenüber den Mitgliedstaaten sicherstellt und welche Auswirkungen dies auf das Verhältnis zwischen beiden hat.
B. Entwicklung des Haushaltsrechts
Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklung des Haushaltsrechts der Europäischen Gemeinschaft.
C. Haushaltsplan
I. Haushaltsverfahren
Dieser Abschnitt beschreibt das Haushaltsverfahren der Europäischen Gemeinschaft. Es wird erläutert, wie der Haushalt erstellt wird und wie die einzelnen Organe der Gemeinschaft an diesem Prozess beteiligt sind.
II. Rechtsnatur
Dieser Abschnitt behandelt die Rechtsnatur des Haushaltsplans der Europäischen Gemeinschaft.
III. Einnahmen
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere dem Eigenmittelsystem. Es wird erläutert, wie die verschiedenen Arten von Eigenmitteln erhoben werden und welche Rolle die Mitgliedstaaten dabei spielen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Finanzverfassung der Europäischen Gemeinschaft, die Finanzhoheit der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten, die Kompetenz der Gemeinschaftsorgane in der Finanzverfassung, das Haushaltsrecht der Europäischen Gemeinschaft, das Eigenmittelsystem der Europäischen Gemeinschaft und die verschiedenen Arten von Eigenmitteln.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Herren der Verträge" im EU-Kontext?
Er beschreibt die Rolle der Mitgliedstaaten, die durch freien Entschluss die Gemeinschaftsverträge abgeschlossen haben und ohne deren Mitwirkung keine Vertragsänderungen möglich sind.
Wie finanziert sich die Europäische Gemeinschaft?
Die Finanzierung erfolgt über das sogenannte Eigenmittelsystem, das unter anderem aus Zöllen, Agrarabschöpfungen und Anteilen am Mehrwertsteueraufkommen sowie am Bruttosozialprodukt der Mitgliedstaaten besteht.
Welche Kompetenzen haben die Gemeinschaftsorgane im Haushaltsrecht?
Die Arbeit untersucht die Rollen von Kommission, Rat und Parlament im Haushaltsverfahren sowie deren jeweilige Entscheidungsbefugnisse über Einnahmen und Ausgaben.
Was versteht man unter der Finanzhoheit der Gemeinschaft?
Die Finanzhoheit setzt sich aus der Rechtsetzungshoheit, Ertragshoheit, Ausgabenhoheit und Verwaltungshoheit zusammen, die das Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten prägen.
Gibt es eine Beitragsgerechtigkeit zwischen den Mitgliedstaaten?
Die Arbeit diskutiert die Verteilung der finanziellen Lasten und wie das System sicherstellt, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten in einem fairen Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stehen.
Ist eine Kreditfinanzierung für den EU-Haushalt zulässig?
Dieses Kapitel der Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und Grenzen der Kreditaufnahme durch die Europäische Gemeinschaft im Rahmen ihrer Finanzverfassung.
- Quote paper
- Dominik Engl (Author), 2004, Das Verhältnis von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten in der Finanzverfassung der Europäischen Gemeinschaft unter Berücksichtigung der Kompetenz der Gemeinschaftsorgane., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24839