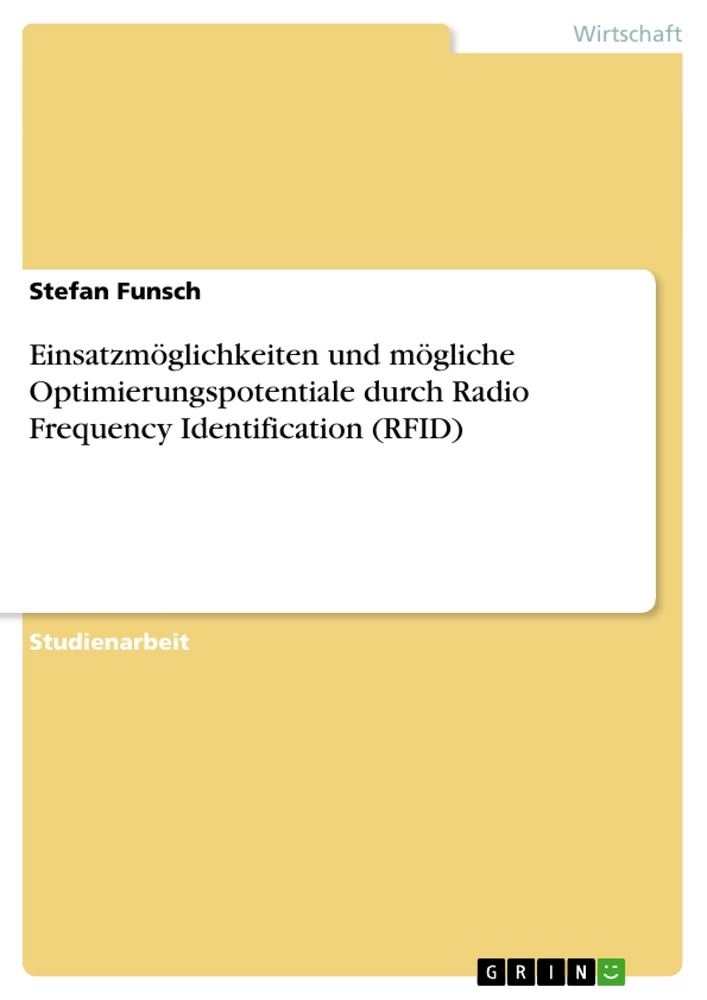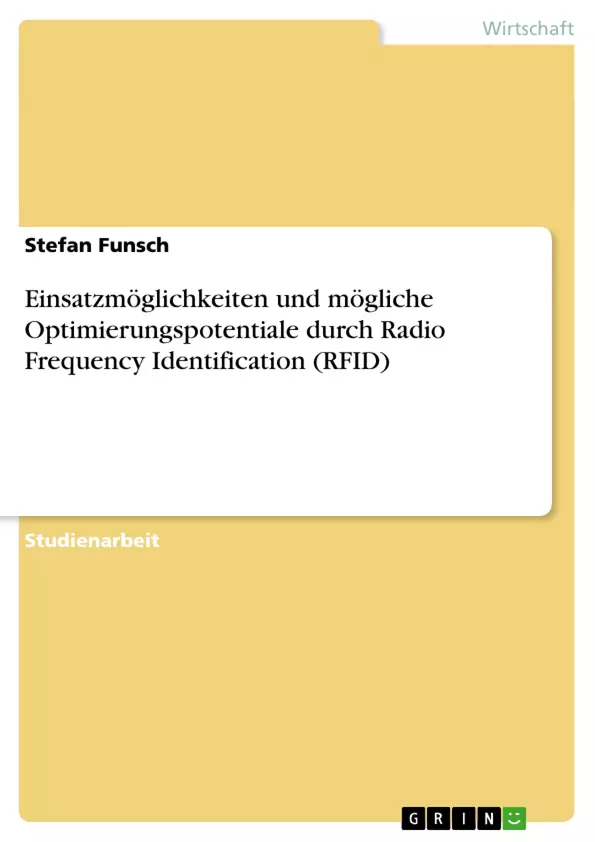Schnelligkeit von Material -, Produkt- und insbesondere Informationsflüssen spielt in
der heutigen Technologieära eine entscheidende und erfolgskritische Rolle. Lagerüberhänge
und Fehlmengen sind Zustände, die durch ein effizie ntes Logistik- und
Supply-chain-management vermieden werden sollen. Der Einsatz von technologischen
Hilfsmitteln, wie dem Internet, speziellen Planungstools und ausgeklügelten Verfahren
des Informationsaustausches zwischen Menschen und Objekten ist dabei unerläßlich
geworden. Gerade der Austausch von Informationen ist aber oftmals ein ineffizienter
und zeitraubender Vorgang. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil Informationen in unterschiedlicher
Form auftreten können und ger ade beim Informationsaustausch häufig
ihren Zustand wechseln, d.h. beispielsweise von virtuellen Informationen des menschlichen
Gehirns zu schri ftlich fixierten Dokumenten oder von Informationen in schriftlicher
Form zu Informationen, die in modernen ERP -Systemen weiterverarbeitet und
gespeichert werden. Häufig wird bezüglich dieser Problematik auch von Medienbrüchen
gesprochen.
Selbst in technologisierten Welten, wie Rechenzentren großer Unternehmen können
Informationen nicht so ohne weiteres ausgetauscht werden. Spezielle und standard isierte
Formate und Übertragungsarten, wie EDI (Electronic Data Interface), mußten
entwickelt werden, um einen solchen Austausch zu ermöglichen.
Wie jedoch lassen sich Informationen zwischen Menschen und Dingen austauschen?
Dieser Vorgang war bisher immer ein vom Menschen ausgehender aktiver Prozess,
d.h. der Mensch brachte die Information an der Sache an und konnte sie so entsprechend
aktiv wieder von ihr erlangen bzw. ablesen. Auch dieser Prozess wurde mit der
Einführung von Standards und der Entwicklung neuer Technologien immer mehr vereinfacht.
So werden Produkte heute mit Nummerncodes (wie European Article Number
oder Universal Product Code) versehen, welche sie identifizieren und in Datenbanken
gespeicherten Informationen zuordnen. Um diese Nummerncodes zu lesen, werden spezielle technische Hilfsmittel, wie z.B.
auf Lasertechnik beruhende Barcodeleser eingesetzt, wie man sie von Kassen im Einzelhandel
kennt. Derartige Verfahren sind nicht nur aus Supermärkten heutzutage
nicht mehr wegzudenken. Auch in vorgelagerten Stufen der Wer tschöpfungskette und
insbesondere bei den logistischen Prozessen ist die Verwendung solcher Codes heute
weitverbreitet und hat zu erheblichen Optimierungen und Einsparungen geführt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Historie des RFID.
- Einführung in Auto – ID und RFID
- Grundlagen von Auto - ID
- RFID
- Ubiquitous Computing und Intelligente Dinge
- RFID versus Barcode
- Optimierungspotentiale
- Konsumgüterindustrie.
- Handel
- Produktion
- Logistikdienstleister
- Weitere Szenarien
- Hindernisse und Probleme von RFID
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Optimierungspotentialen von Radio Frequency Identification (RFID) im Logistikbereich. Sie untersucht die Funktionsweise von RFID, seine Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Technologien, sowie seine konkreten Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen.
- Die Entwicklung und Funktionsweise von RFID-Technologie im Vergleich zum Barcode.
- Die Untersuchung der Optimierungspotentiale von RFID in unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette, insbesondere in der Konsumgüterindustrie, im Handel, in der Produktion und bei Logistikdienstleistern.
- Die Analyse der Herausforderungen und Hindernisse, die bei der Implementierung von RFID-Systemen auftreten können.
- Die Darstellung der zukünftigen Entwicklung von RFID-Technologien und deren Auswirkungen auf die Logistik.
- Der Vergleich der Kosten und Nutzen von RFID-Systemen in verschiedenen Anwendungsszenarien.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, dass die Informationsflüsse in der heutigen Zeit effizienter gestaltet werden müssen. Der Autor stellt den Bedarf an einer Technologie wie RFID, die einen automatischen Informationsaustausch ermöglicht, dar. Das erste Kapitel gibt einen Einblick in die Entstehung von RFID, während Kapitel 3 die Funktionsweise der Technologie erläutert. Kapitel 4 vergleicht RFID mit der etablierten Barcode-Technologie und zeigt bereits einige mögliche Optimierungspotentiale auf. Kapitel 5 untersucht dann die konkreten Optimierungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen wie der Konsumgüterindustrie, dem Handel, der Produktion und bei Logistikdienstleistern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Radio Frequency Identification (RFID), Auto-ID, Supply-Chain Management, Optimierungspotenziale, Konsumgüterindustrie, Handel, Produktion, Logistikdienstleister, Barcode-Technologie und Ubiquitous Computing.
Häufig gestellte Fragen
Was ist RFID und wie funktioniert es?
RFID steht für Radio Frequency Identification. Es ermöglicht die automatische Identifizierung von Objekten über Funkwellen, ohne dass Sichtkontakt zwischen Lesegerät und Transponder erforderlich ist.
Was sind die Vorteile von RFID gegenüber dem Barcode?
Im Gegensatz zum Barcode können RFID-Tags gleichzeitig gelesen werden (Pulklesung), sie sind wiederbeschreibbar, robuster gegenüber Verschmutzung und benötigen keinen direkten Sichtkontakt.
Wo liegen die größten Optimierungspotenziale in der Logistik?
RFID optimiert die Bestandsgenauigkeit, beschleunigt Wareneingangs- und Warenausgangsprozesse, verbessert die Rückverfolgbarkeit von Produkten und reduziert Fehler bei der Kommissionierung.
Welche Branchen profitieren besonders von RFID?
Besonders die Konsumgüterindustrie, der Handel (Retail), die Automobilproduktion und große Logistikdienstleister nutzen RFID zur Effizienzsteigerung ihrer Supply Chain.
Welche Hindernisse gibt es bei der Einführung von RFID?
Herausforderungen sind die hohen Investitionskosten für Hardware und Tags, fehlende globale Standards, technische Probleme bei Metall oder Flüssigkeiten sowie Datenschutzbedenken.
- Citation du texte
- Stefan Funsch (Auteur), 2003, Einsatzmöglichkeiten und mögliche Optimierungspotentiale durch Radio Frequency Identification (RFID), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24913