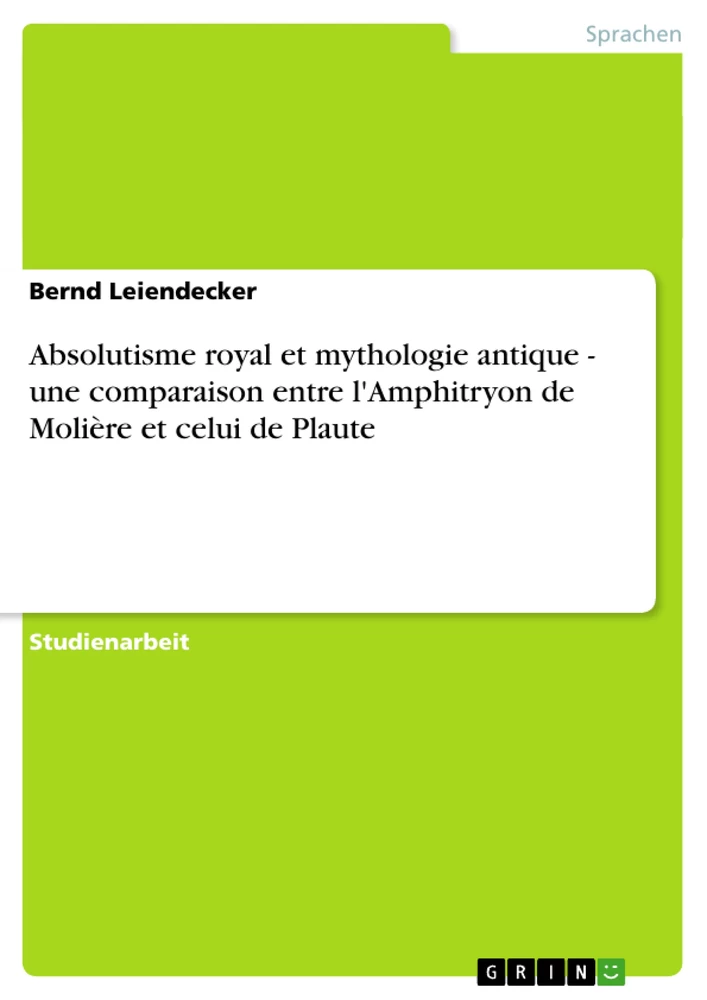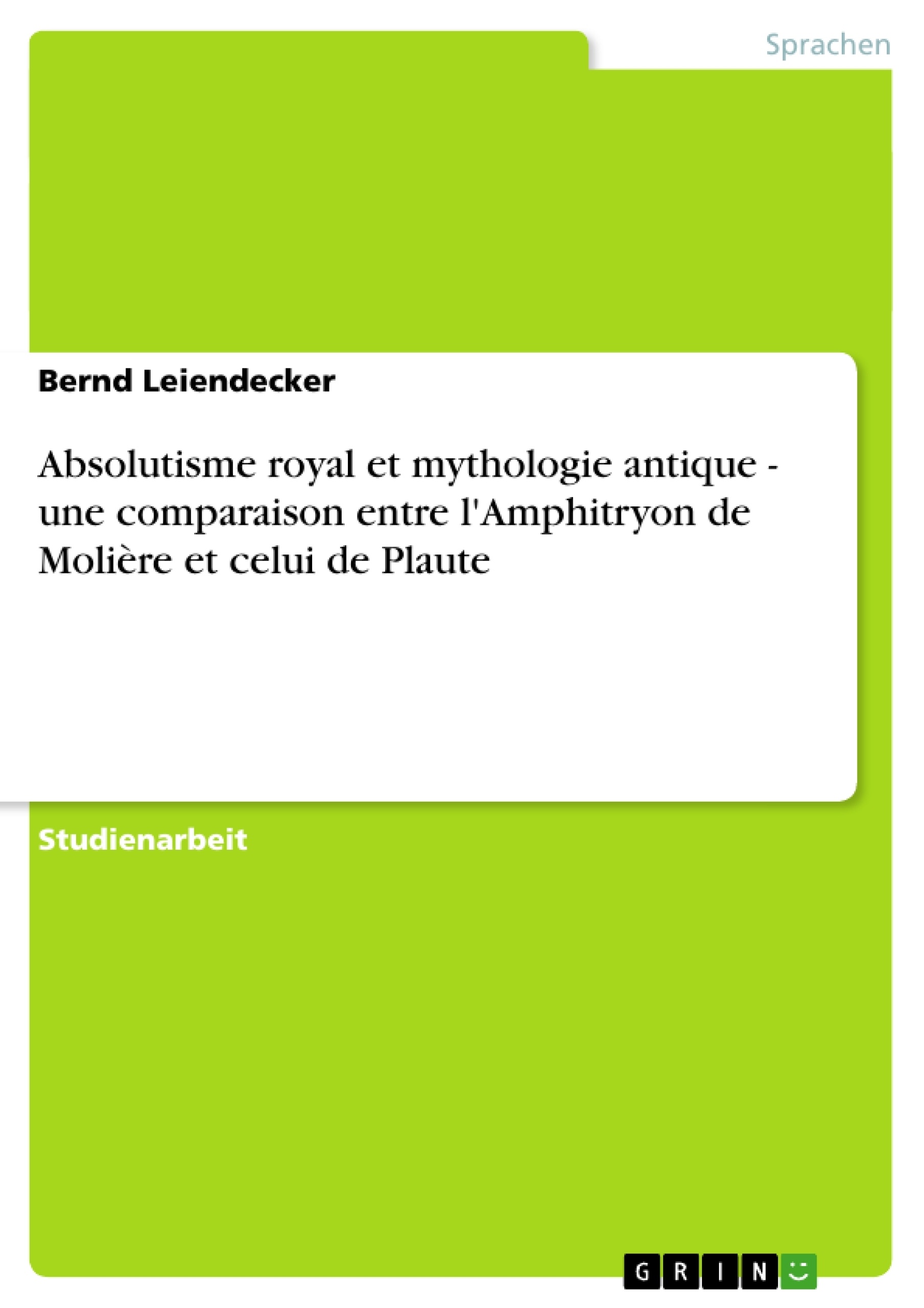Jean Baptiste Molières erfolgreiches Theaterstück Amphitryon wurde im Jahr 1668 uraufgeführt. Molière verfasste es während seiner Tätigkeit als Hofdichter des Königs Louis XIV. Das Stück wird zwar noch in die - vor allem politische Stücke umfassende - mittlere Phase von Molières Schaffen eingeordnet, weist aber bereits eine erkennbare Nähe zu den Ballettkomödien seiner späten Phase auf. 1 Amphitryon geht vor allem auf zwei Vorlagen zurück: Les sosies von Rotrou, welches 1636 uraufgeführt wurde und somit zu Molières Zeiten noch relativ aktuell war, und Amphitruo, verfasst vom römischen Schriftsteller Titus Macchius Plautus, wahrscheinlich zwischen 190 und 184 vor Christus. 2
Diese Arbeit untersucht, welche Änderungen Molière an der Vorlage von Plautus vorgenommen hat und versucht die Gründe für diese Änderungen aufzuzeigen. Um dies zu erreichen, soll zunächst die mythologische Grundlage beider Stücke, der griechische Mythos von der Geburt des Herakles, zusammengefasst werden. Anschließend werden markante Unterschiede in der Umsetzung dieses Stoffes vorgestellt. Danach wird näher auf die unterschiedliche Charakterisierung der einzelnen Akteure eingegangen, um zuletzt allgemeinere Erkenntnisse aus den gemachten Beobachtungen zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mythos der Geburt des Herakles
- Die Umsetzung des Stoffes
- Die Handlung
- Der Prolog
- Der Zusatzcharakter Cléanthis
- Die Charakterisierung der Hauptakteure
- Amphitryon
- Alkmene
- Sosie
- Jupiter
- Merkur
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Änderungen, die Molière in seiner Adaption des Plautus-Stücks "Amphitruo" vorgenommen hat und analysiert die Beweggründe hinter diesen Änderungen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Versionen, ausgehend von der mythologischen Grundlage der Geburt des Herakles. Die Analyse umfasst die Handlung, die Charakterisierung der Hauptfiguren und die allgemeine Umsetzung des Stoffes.
- Vergleich der Adaptionen des Mythos der Geburt des Herakles durch Plautus und Molière.
- Analyse der Unterschiede in der Handlungsführung beider Stücke.
- Untersuchung der Charakterentwicklung und -darstellung der Hauptfiguren.
- Erforschung der Gründe für Molières Änderungen an der Vorlage.
- Einordnung von Molières "Amphitryon" in sein Gesamtwerk.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext von Molières "Amphitryon" innerhalb seines Gesamtwerks. Sie benennt die beiden Hauptvorlagen – Rotrous "Les sosies" und Plautus' "Amphitruo" – und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einem Vergleich der beiden Adaptionen des Mythos basiert. Die Einleitung hebt die Bedeutung des Vergleichs für das Verständnis von Molières künstlerischem Schaffen hervor und benennt die einzelnen Schritte der Analyse: die mythologische Grundlage, die Handlungsunterschiede, die Charakterisierungen und abschließend allgemeine Schlussfolgerungen.
Der Mythos der Geburt des Herakles: Dieses Kapitel fasst den griechischen Mythos um die Geburt des Herakles zusammen. Es erläutert die Rolle von Zeus/Jupiter, Hera/Juno, Alkmene und Amphitryon und beschreibt die Ereignisse rund um die Geburt der Zwillinge Herakles und Iphikles, einschließlich der Interventionen Heras und der Rettung Alkmenes durch Zeus. Es werden auch unterschiedliche Interpretationen der Motivation des Zeus für die Zeugung Herakles vorgestellt, wie z.B. die Unterstützung der Götter im Kampf gegen die Titanen oder das Wohl der Menschheit. Das Kapitel betont die Anpassung der Götternamen durch Plautus an die römische Mythologie.
Die Umsetzung des Stoffes: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Unterschiede in der Umsetzung des Mythos durch Plautus und Molière. Es analysiert die Handlungsstruktur, den Prolog und die Rolle des zusätzlichen Charakters Cléanthis in Molières Stück. Hierbei werden die Veränderungen im Vergleich zu Plautus' Version detailliert untersucht und deren Bedeutung für die Gesamtkomposition und die Intention des Autors beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Molière den Stoff an seine Zeit und sein eigenes künstlerisches Verständnis angepasst hat.
Die Charakterisierung der Hauptakteure: Dieses Kapitel vergleicht die Darstellung der Hauptfiguren – Amphitryon, Alkmene, Sosie, Jupiter und Merkur – in den Stücken von Plautus und Molière. Es untersucht, wie die Charaktere in den beiden Adaptionen konzipiert und entwickelt werden und wie sich Molières Interpretation von den ursprünglichen Darstellungen unterscheidet. Der Vergleich hebt die Änderungen in den Motiven, Handlungen und Beziehungen der Figuren hervor und analysiert, wie diese Änderungen die Gesamtbedeutung der Stücke beeinflussen. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, wie Molière die Figuren für sein Publikum und seine Zeit relevant gestaltet.
Schlüsselwörter
Molière, Amphitryon, Plautus, griechische Mythologie, Herakles, Jupiter, Alkmene, Amphitryon, Komödie, Theater, Adaption, Vergleichende Literaturwissenschaft, Hofdichter, Absolutismus, Römische Mythologie.
Häufig gestellte Fragen zu Molières "Amphitryon"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Molières Adaption des Plautus-Stücks "Amphitruo" und vergleicht sie mit dem Original. Der Fokus liegt auf den Änderungen, die Molière vorgenommen hat, und den Beweggründen dahinter. Die Analyse umfasst die Handlung, die Charakterisierung der Hauptfiguren und die allgemeine Umsetzung des mythologischen Stoffes der Geburt des Herakles.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einem Vergleich von Molières "Amphitryon" und Plautus' "Amphitruo". Sie bezieht sich auch auf Rotrous "Les sosies", welches ebenfalls eine Vorlage für Molières Stück darstellt. Die Analyse berücksichtigt die mythologische Grundlage der Geburt des Herakles und bezieht verschiedene Interpretationen dieser mythologischen Erzählung mit ein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Vergleich der Adaptionen des Mythos durch Plautus und Molière; die Unterschiede in der Handlungsführung; die Charakterentwicklung und -darstellung der Hauptfiguren (Amphitryon, Alkmene, Sosie, Jupiter, Merkur); die Gründe für Molières Änderungen; und die Einordnung von Molières "Amphitryon" in sein Gesamtwerk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die den Kontext und den methodischen Ansatz beschreibt. Es folgt ein Kapitel zum Mythos der Geburt des Herakles, gefolgt von Kapiteln zur Umsetzung des Stoffes (Handlung, Prolog, Cléanthis), zur Charakterisierung der Hauptfiguren und abschließend einem Ergebnis. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Molière, Amphitryon, Plautus, griechische Mythologie, Herakles, Jupiter, Alkmene, Amphitryon, Komödie, Theater, Adaption, Vergleichende Literaturwissenschaft, Hofdichter, Absolutismus, Römische Mythologie.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Plautus' und Molières Version?
Die Arbeit untersucht detailliert die Unterschiede in der Handlungsführung, der Charakterisierung der Hauptfiguren und der allgemeinen Umsetzung des Stoffes. Sie analysiert, wie Molière den Mythos an seine Zeit und sein künstlerisches Verständnis angepasst hat und welche Beweggründe hinter diesen Änderungen stecken. Der Zusatzcharakter Cléanthis in Molières Version spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Intentionen Molières bei der Adaption des Stücks und wie er den ursprünglichen Stoff umgestaltet hat, um ihn für sein Publikum relevant zu machen. Sie analysiert, wie Molières Änderungen die Bedeutung des Stücks beeinflussen und seine Einordnung innerhalb seines Gesamtwerks beleuchten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Literaturwissenschaft, insbesondere der Vergleichenden Literaturwissenschaft, die sich mit dem Werk Molières und der Adaption antiker Stoffe im französischen Theater befassen. Sie bietet eine fundierte Analyse von Molières "Amphitryon" und seinen Beziehungen zu den Vorlagen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Bernd Leiendecker (Author), 2004, Absolutisme royal et mythologie antique - une comparaison entre l'Amphitryon de Molière et celui de Plaute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25000