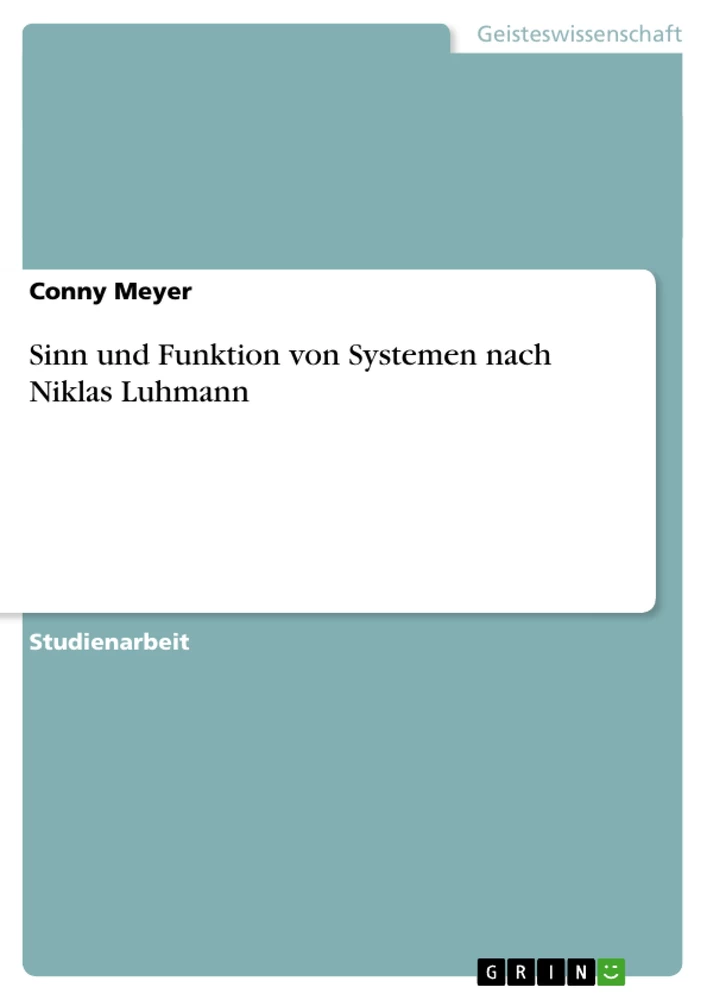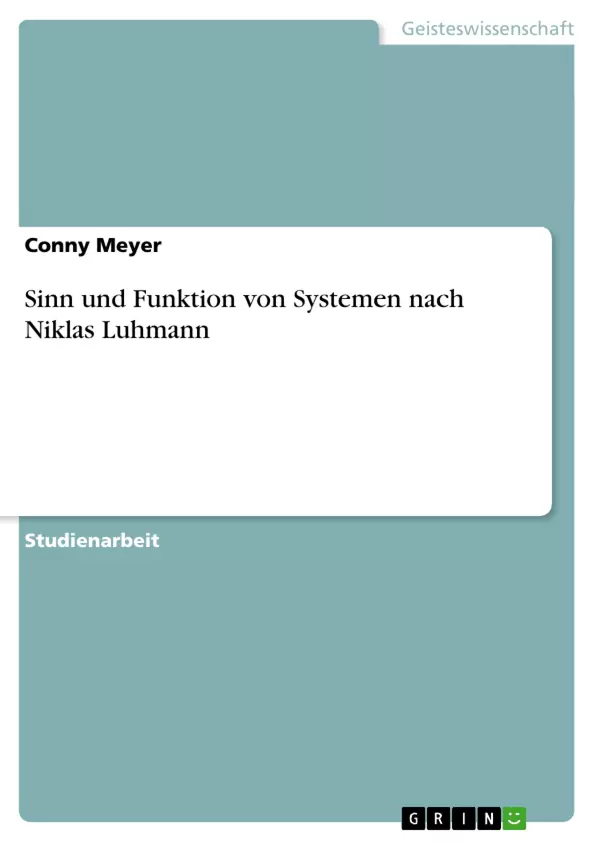In der Systemtheorie Niklas Luhmanns’ geht es vor allen Dingen darum, „eine
hochkomplexe Theorie zu bauen, mit deren Hilfe die soziale Welt besser beobachtet
werden kann.“1 Die Konzeption seiner Theorie beschreibt er ausführlich in seinem 1984
erschienenen Werk „Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie“. Anregen zu
dieser Theorie lies der 1927 geborene Wissenschaftler sich unter anderem von der
Thermodynamik, der Biologie (Organismus), der Neurophysiologie, der Zellen- und
Computertheorie und schließlich vom Gedankengut der Informationstheorie und der
Kybernetik.2
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nun darzustellen, welchen Sinn und welche Funktionen
Systeme nach dem Verständnis Niklas Luhmanns’ haben.
Dazu wird zunächst geklärt, was Systeme, ihre Grenzen und Strukturen sind und welcher
Art von Systemen die Gesellschaft entspricht, um dann herauszuarbeiten, welchen Sinn
die Organisation in Systemen für Menschen hat und wodurch ein System diesen Sinn
vermittelt bzw. aufrecht erhält.
1 Zitat aus „Soziologische Theorie“, S. 173
2 vgl. dazu „Luhmann zur Einführung“, S. 102
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Was sind Systeme?
- Soziale Systeme als selbstreferentielle Systeme
- Grenzen von Systemen
- Struktur und Funktionalität von Systemen
- Sinn im Zusammenhang mit sozialen Systemen
- Weshalb organisieren sich Menschen in Systemen?
- Subsysteme
- Stabilisierung von Verhaltenserwartungen
- Einführung von Routine
- Überlebenssicherung durch Machtpositionen
- Komplexitätsreduzierung durch bestehendes Vertrauen
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Sinn und die Funktionen von Systemen nach dem Verständnis Niklas Luhmanns. Sie untersucht die Struktur und Grenzen von Systemen sowie die Organisation von Menschen in sozialen Systemen. Im Fokus stehen die Mechanismen, durch die Systeme ihren Sinn vermitteln und aufrechterhalten.
- Definition und Charakteristika von Systemen
- Selbstreferentielle Natur sozialer Systeme
- Struktur und Funktionsweise von Systemen
- Sinnvermittlung und -erhalt in sozialen Systemen
- Bedeutung von Normen und Werten für die Systemstabilität
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Dieses Kapitel stellt die Systemtheorie Niklas Luhmanns und die Zielsetzung der Arbeit vor.
- Was sind Systeme?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "System" und erklärt, wie sich Systeme von ihrer Umwelt abgrenzen. Es werden die spezifischen Normen und Werte innerhalb eines Systems erläutert und die Bedeutung des Überlebens für die Systemstabilität hervorgehoben.
- Soziale Systeme als selbstreferentielle Systeme: Dieses Kapitel betrachtet soziale Systeme als selbstreferentielle Systeme, die sich durch eigene Reproduktion am Leben erhalten. Es werden Beispiele für soziale Systeme in der Gesellschaft aufgezeigt und das Prinzip der Selbstreferenz in Bezug auf die Reproduktion des Systems erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der Systemtheorie von Niklas Luhmann, darunter soziale Systeme, Selbstreferenz, Autopoiesis, Struktur, Funktion, Sinn, Normen, Werte, Stabilisierung, Komplexitätsreduzierung, und Überlebenssicherung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein soziales System nach Niklas Luhmann?
Ein soziales System besteht aus Kommunikationen und grenzt sich von seiner Umwelt ab, um Komplexität zu reduzieren und seine eigene Existenz zu stabilisieren.
Was bedeutet "Selbstreferenz" in der Systemtheorie?
Selbstreferenz bedeutet, dass ein System seine eigenen Elemente (z. B. Kommunikationen) durch die Verknüpfung mit bereits vorhandenen systemeigenen Elementen selbst produziert.
Warum organisieren sich Menschen in Systemen?
Systeme helfen dabei, Verhaltenserwartungen zu stabilisieren, Routinen einzuführen und die überwältigende Komplexität der Welt handhabbar zu machen.
Welche Rolle spielen Grenzen für ein System?
Grenzen definieren, was zum System gehört und was zur Umwelt. Ohne diese Abgrenzung könnte ein System keine eigene Identität oder Struktur aufrechterhalten.
Wie tragen Normen und Werte zur Systemstabilität bei?
Normen und Werte fungieren als Orientierungspunkte innerhalb des Systems, die das Überleben des Systems sichern und die Kommunikation kanalisieren.
- Quote paper
- Conny Meyer (Author), 2003, Sinn und Funktion von Systemen nach Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25036