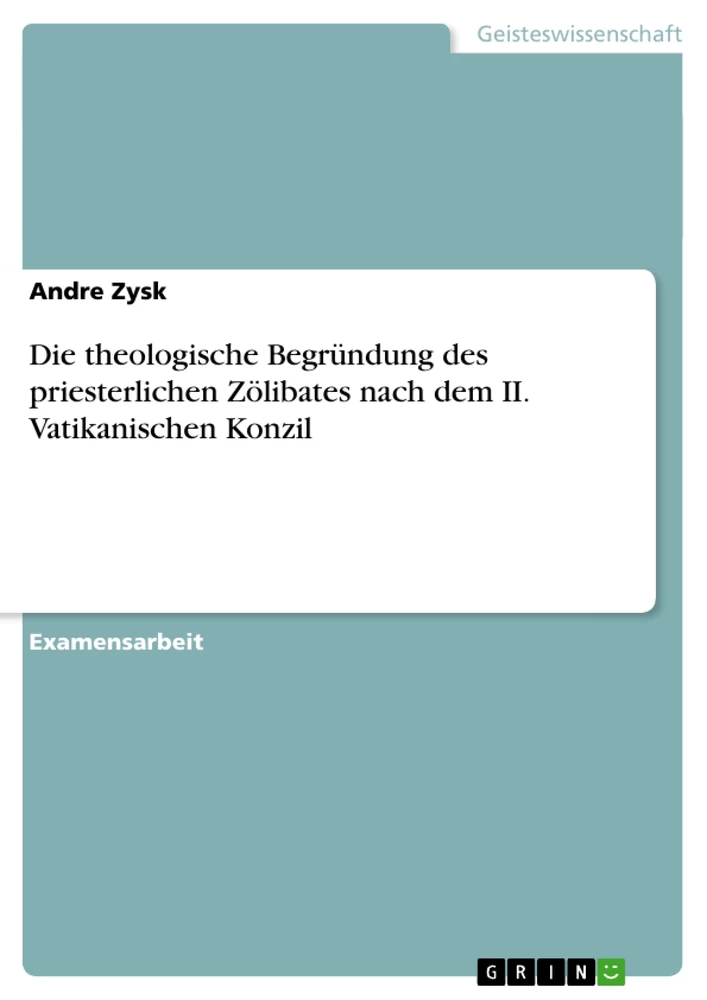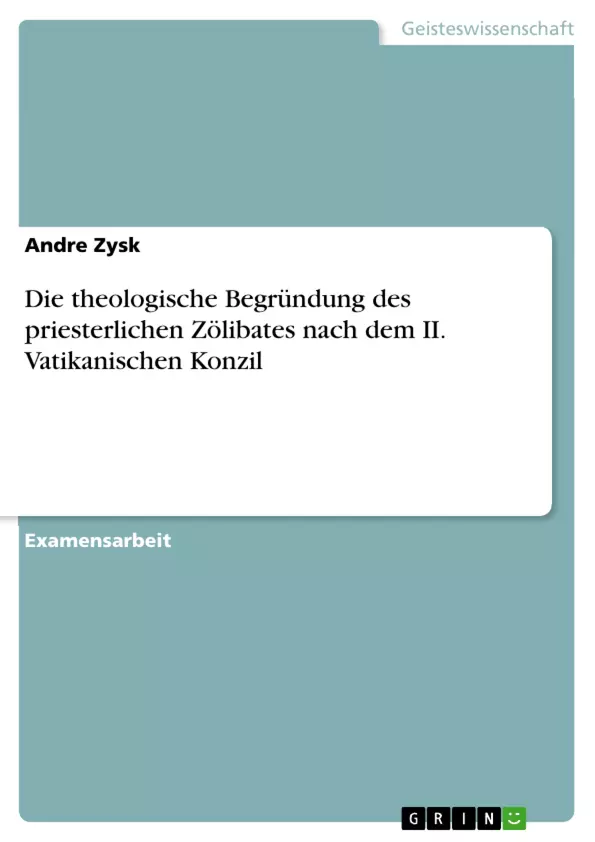Der Zölibat der katholischen Priester ist ein Gegenstand, der gerade in der Öffentlichkeit immer wieder, oftmals mit negativer Konnotation, zur Sprache kommt. Der Grund dafür liegt wohl nur zum Teil in der existentiellen Betroffenheit der daran direkt Beteiligten. In dieser Arbeit wird der priesterliche Zölibat, wie er in der römisch-katholischen Kirche praktiziert wird, fern von jeder Polemik und Unsachlichkeit kritisch hinterfragt. Dabei wird vor allem die theologisch-dogmatische Begründung des Zölibats nach dem II. Vatikanischen Konzil aufgezeigt und untersucht. Anhand dieser soll dann geprüft werden, ob die Verknüpfung des Zölibats mit dem priesterlichen Amt als notwendig und sinnvoll angesehen werden kann.
Wenn man den Gegenstand des Zölibats ganzheitlich erfassen will, kann man nicht an der Tatsache vorbei, daß dieser zwar keine direkte Grundlegung, aber dennoch Anhaltspunkte in der heiligen Schrift hat, die im Zeugnis der Aposteln vorliegt. Konsequent weitergedacht sollte dann auch die Entwicklungsgeschichte des Zölibats nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Der Hauptteil der Arbeit soll jedoch im systematischen Teil liegen. Die in der Arbeit entwickelte Argumentation geht von der Prämisse aus, daß es sich beim Zölibat um ein charismatisches Phänomen handelt. Die Frage, ob der Zölibat tatsächlich als Charisma angesehen werden kann und welche Folgen sich daraus ergeben, wird einen der Hauptgesichtspunkte dieser Arbeit darstellen. Zudem wird die Begründung der derzeit bestehenden Zölibatsvorschrift anhand der Beschlüsse des zweiten vatikanischen Konzils sowie der Enzyklika Sacerdotalis caelibatus untersucht und im Hinblick auf das Problem des für das Priesteramt notwendigen zweifachen Charismas befragt. Sodann werden die in der nachkonziliaren Zeit entwickelten Argumentationen darzustellen und zu prüfen sein. Am Schluß der Arbeit sollte dann die Frage zu beantworten sein, wie die Zölibatsverpflichtung als Weihebedingung für Priesteramtanwärter begründet wird und ob diese Begründung dogmatisch gesehen ausreichend ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitungsteil
- I. Einleitung
- II. Begriff des Zölibats
- II.1 Die Zwei Arten des Zölibats
- II.1.1 Der charismatische Zölibat
- II.1.2 Der obligatorische Zölibat
- III. Biblische Grundlage des Zölibats
- III.1 Die Enthaltsamkeit des Jesus von Nazareth und seiner Jünger
- III.2 Frühchristliche Tradition
- III.2.1 Die Apostel
- III.2.2 Die Gemeindevorsteher
- III.2.3 Das Verhältnis von Ehe und Ehelosigkeit
- III.3 Zusammenfassung
- IV. Historischer Teil
- IV.1 Die Herausbildung spezifischer Kirchenämter
- IV.2 Priesterliche Enthaltsamkeit im 4. und 5. Jahrhundert
- IV.3 Die Zölibatsgesetzgebung im Mittelalter
- IV.4 Der Priesterzölibat in der Reformationszeit
- IV.5 Geltendes Zölibatsrecht nach dem CIC von 1983
- IV.6 Zusammenfassung
- Hauptteil
- V. Begründung des Zölibats im 20. Jahrhundert
- V.1 Das II. Vatikanische Konzil
- V.1.1 Zölibat in Lumen Gentium
- V.1.2 Zölibat in Optatam Totius
- V.1.3 Zölibat in Presbyterorum Ordinis
- V.1.4 Abschluß des Konzils
- VI. Die Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“
- VII. Nachkonziliare Begründungen des Zölibats
- VIII. Der Zölibat als Charisma
- VIII.1 Begriff und Wesen des Charismas nach paulinisches Verständnis
- VIII.2 Die Vielfalt der Charismen
- VIII.3 Ist ein Charisma erbittbar?
- VIII.4 Kann der Zölibat Gesetz und Charisma zugleich sein?
- VIII.5 Zusammenfassung
- IX. Ist der Zölibat dem Priestertum angemessen?
- IX.1 Der Zölibat aus christologischer Sicht
- IX.1.1 Zölibat und Nachfolge Christi
- IX.1.2 Der Zölibat als Erleichterung der Beziehung zu Christus
- IX.2 Der Zölibat aus ekklesiologischer Sicht
- IX.2.1 Der Zölibat im Rahmen der Repräsentation Christi und der Kirche
- IX.2.2 Zölibat als Ganzhingabe an die Gemeinde
- IX.2.3 Der Zölibat als Zeugnis der Ganzhingabe
- IX.3 Der Zölibat aus eschatologischer Sicht
- IX.3.1 Der Zölibat als Vorwegnahme des engelgleichen Lebens
- IX.4 Zusammenfassung
- X. Die Zölibatsdiskussion nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
- X.1 Der Zölibat und die kirchliche Tradition
- X.1.1 Der Zölibat im Zusammenhang mit kultischer Reinheit
- X.2 Zölibat und Priestermangel
- X.3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die theologisch-dogmatische Begründung des priesterlichen Zölibats nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ziel ist es, die Verknüpfung von Zölibat und Priesteramt auf ihre Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit zu prüfen. Die Arbeit betrachtet den Zölibat nicht nur historisch, sondern auch unter theologischen Aspekten wie Christologie, Ekklesiologie und Pneumatologie.
- Theologische Begründung des Zölibats nach dem II. Vatikanischen Konzil
- Historische Entwicklung des Zölibats
- Der Zölibat als Charisma
- Die Angemessenheit des Zölibats für das Priestertum
- Die postkonziliare Zölibatsdiskussion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des priesterlichen Zölibats ein, beleuchtet dessen öffentliche Rezeption und die damit verbundenen kontroversen Diskussionen. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der eine kritische, aber unpolemische Auseinandersetzung mit der theologischen Begründung des Zölibats nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil anstrebt. Die Arbeit betont die Grenzen einer rein dogmatischen Beweisführung und kündigt die Einbeziehung pneumatologischer, christologischer, ekklesiologischer und eschatologischer Perspektiven an, um das Thema ganzheitlich zu erfassen. Die Notwendigkeit der Untersuchung biblischer Grundlagen und der historischen Entwicklung wird begründet.
II. Begriff des Zölibats: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Zölibats und differenziert zwischen charismatischem und obligatorischem Zölibat. Es legt die Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Ausprägungen und Begründungen des Zölibats im weiteren Verlauf der Arbeit.
III. Biblische Grundlage des Zölibats: Dieses Kapitel analysiert biblische Texte auf ihre Relevanz für die Frage des priesterlichen Zölibats. Es untersucht die Enthaltsamkeit Jesu und seiner Jünger sowie die frühchristliche Tradition, um mögliche historische und theologische Wurzeln des Zölibats zu identifizieren und zu bewerten. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis von Ehe und Ehelosigkeit im frühen Christentum.
IV. Historischer Teil: Der historische Teil zeichnet die Entwicklung des priesterlichen Zölibats von der Herausbildung spezifischer Kirchenämter bis zum geltenden Zölibatsrecht nach dem Codex Iuris Canonici von 1983 nach. Er beleuchtet die verschiedenen Epochen und deren jeweilige zölibatäre Praxis und Gesetzgebung, um ein umfassendes Verständnis der historischen Kontinuitäten und Brüche zu ermöglichen. Die Analyse der verschiedenen Phasen der Entwicklung liefert wichtige Kontextualisierungen für die theologische Diskussion.
V. Begründung des Zölibats im 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel widmet sich der Begründung des Zölibats im 20. Jahrhundert, vor allem im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es analysiert die relevanten konziliaren Dokumente (Lumen Gentium, Optatam Totius, Presbyterorum Ordinis) und untersucht, wie der Zölibat darin thematisiert und begründet wird. Die Analyse der Konzilsdokumente bildet die zentrale Grundlage für die weitere theologische Auseinandersetzung.
VI. Die Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“: Die Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“ wird hier eingehend untersucht, um ihre Bedeutung für die nachkonziliare Diskussion um den Zölibat zu verdeutlichen. Die Analyse deckt die darin enthaltenen Argumente und Begründungen auf und setzt diese in den Kontext der zuvor behandelten Konzilsdokumente und der historischen Entwicklung.
VII. Nachkonziliare Begründungen des Zölibats: Dieses Kapitel analysiert verschiedene nachkonziliare Begründungen des Zölibats und diskutiert deren jeweilige Stärken und Schwächen im Lichte der vorhergehenden Kapitel. Es zeigt die Vielfalt der theologischen Ansätze auf und trägt zum umfassenden Verständnis der aktuellen Debatte bei.
VIII. Der Zölibat als Charisma: Dieses Kapitel erörtert die These vom Zölibat als Charisma. Es analysiert den Begriff und das Wesen des Charismas nach paulinischem Verständnis und untersucht die Frage, ob der Zölibat als erbittbares Charisma verstanden werden kann und ob er gleichzeitig Gesetz und Charisma sein kann. Die Argumentation beleuchtet die theologischen Implikationen dieses Ansatzes für die Diskussion um den Zölibat.
IX. Ist der Zölibat dem Priestertum angemessen?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Angemessenheit des Zölibats für das Priestertum aus christologischer, ekklesiologischer und eschatologischer Perspektive. Es untersucht die verschiedenen theologischen Argumente und deren Bedeutung für die Bewertung des Zölibats.
X. Die Zölibatsdiskussion nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil: Dieses Kapitel analysiert die Zölibatsdiskussion nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, unter Berücksichtigung der kirchlichen Tradition, des Priestermangels und anderer relevanter Faktoren. Die Zusammenfassung der Diskussion in diesem Kapitel trägt zum Gesamtverständnis der komplexen Thematik bei.
Schlüsselwörter
Priesterzölibat, Zweites Vatikanisches Konzil, Theologie, Dogmatik, Pneumatologie, Christologie, Ekklesiologie, Eschatologie, Charisma, Kirchenrecht, kirchliche Tradition, Priestermangel, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theologische Begründung des priesterlichen Zölibats nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die theologisch-dogmatische Begründung des priesterlichen Zölibats nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Ziel ist die Prüfung der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Verknüpfung von Zölibat und Priesteramt.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit betrachtet den Zölibat nicht nur historisch, sondern auch unter theologischen Aspekten wie Christologie, Ekklesiologie und Pneumatologie. Sie geht über eine rein dogmatische Beweisführung hinaus und bezieht pneumatologische, christologische, ekklesiologische und eschatologische Perspektiven ein, um das Thema ganzheitlich zu erfassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in einen Einleitungsteil, einen Hauptteil und einen Schlussteil. Der Einleitungsteil beinhaltet die Definition des Zölibats (charismatisch und obligatorisch) und seine biblische Grundlage (Enthaltsamkeit Jesu, frühchristliche Tradition). Der Hauptteil befasst sich mit der historischen Entwicklung des Zölibats, seiner Begründung im 20. Jahrhundert (insbesondere im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“), dem Zölibat als Charisma, seiner Angemessenheit für das Priestertum und der postkonziliaren Diskussion.
Welche konkreten Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil analysiert die relevanten Konzilsdokumente (Lumen Gentium, Optatam Totius, Presbyterorum Ordinis), nachkonziliare Begründungen, den Zölibat als Charisma (seinen Begriff, Wesen, Erbittbarkeit und die Frage, ob er Gesetz und Charisma zugleich sein kann), die Angemessenheit des Zölibats aus christologischer, ekklesiologischer und eschatologischer Sicht und die Zölibatsdiskussion nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (inkl. Tradition, Priestermangel).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Priesterzölibat, Zweites Vatikanisches Konzil, Theologie, Dogmatik, Pneumatologie, Christologie, Ekklesiologie, Eschatologie, Charisma, Kirchenrecht, kirchliche Tradition, Priestermangel, historische Entwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit einer übersichtlichen Gliederung der einzelnen Kapitel und Unterkapitel. Zusätzlich enthält sie eine Zusammenfassung der Kapitel, die die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Kapitels prägnant wiedergibt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist die kritische, aber unpolemische Auseinandersetzung mit der theologischen Begründung des Zölibats nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es soll geprüft werden, ob die Verknüpfung von Zölibat und Priesteramt notwendig und sinnvoll ist.
Wie wird der Begriff des Zölibats definiert?
Der Begriff des Zölibats wird definiert und in charismatischen und obligatorischen Zölibat differenziert. Diese Unterscheidung ist Grundlage für das Verständnis der verschiedenen Ausprägungen und Begründungen des Zölibats.
Welche Rolle spielt das Zweite Vatikanische Konzil?
Das Zweite Vatikanische Konzil spielt eine zentrale Rolle, da die Arbeit die Begründung des Zölibats im 20. Jahrhundert, insbesondere im Kontext des Konzils, untersucht. Die relevanten Konzilsdokumente werden analysiert, um die dort enthaltenen Argumente zu verstehen.
Welche Bedeutung hat die Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“?
Die Enzyklika „Sacerdotalis caelibatus“ wird eingehend untersucht, um ihre Bedeutung für die nachkonziliare Diskussion um den Zölibat zu verdeutlichen. Ihre Argumente und Begründungen werden im Kontext der Konzilsdokumente und der historischen Entwicklung betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Andre Zysk (Autor:in), 2000, Die theologische Begründung des priesterlichen Zölibates nach dem II. Vatikanischen Konzil, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25054