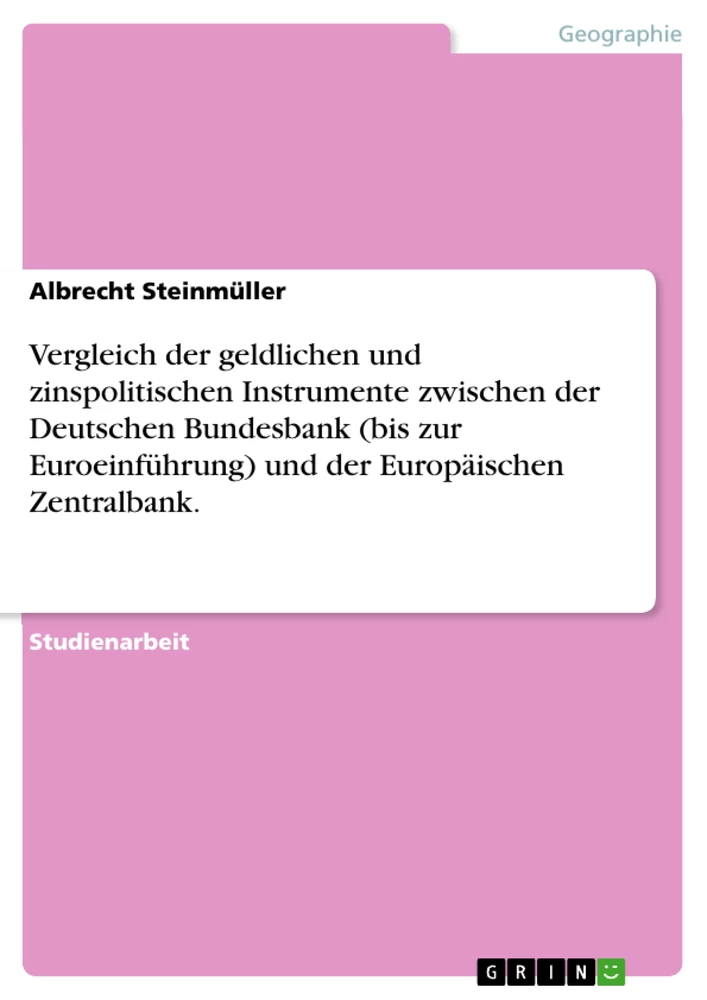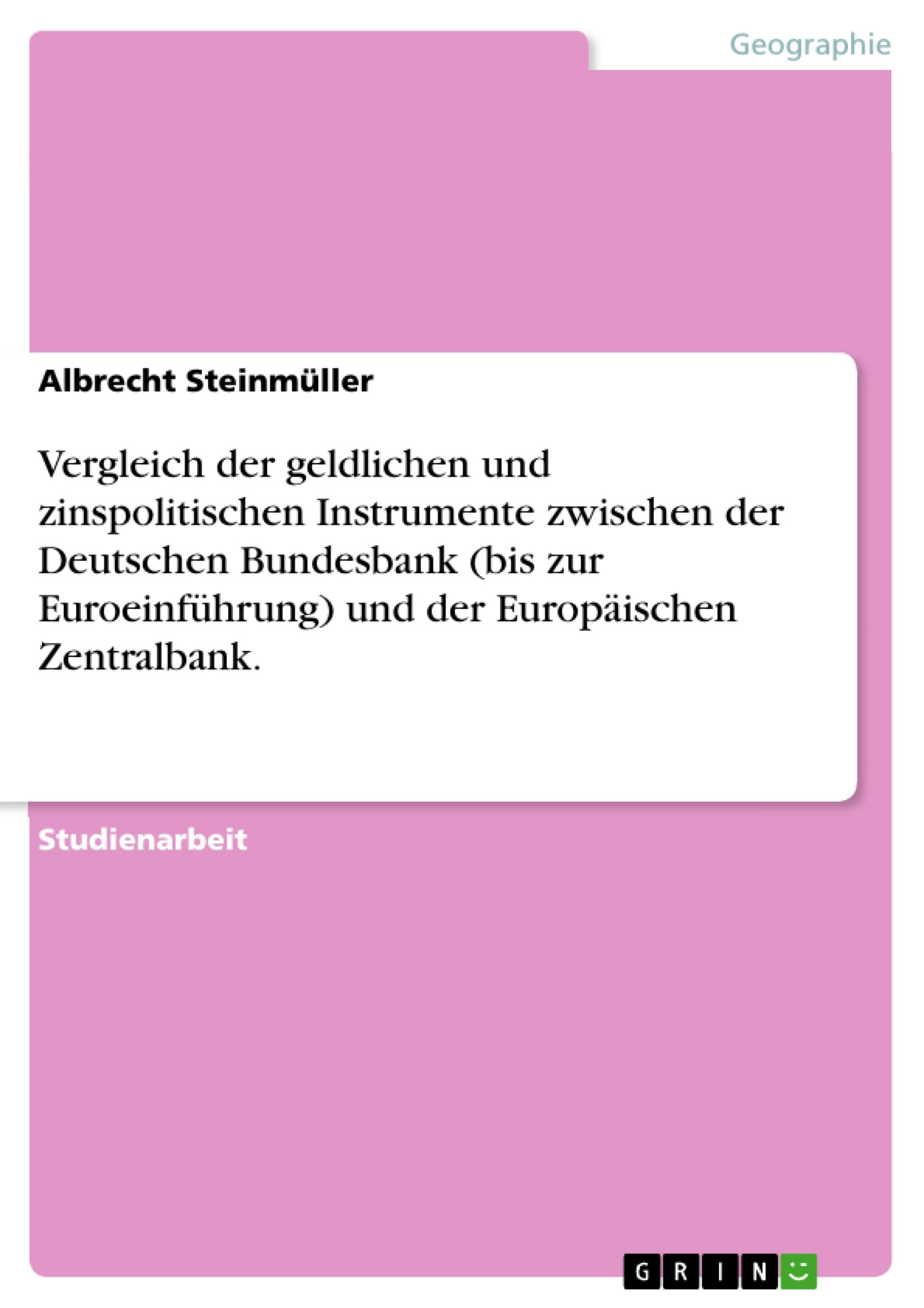1 Die (ehemaligen) Instrumente der Deutschen Bundesbank (Die Geldpolitik auf marktwirtschaftlicher Grundlage)
Im Bundesbankgesetz sind alle Instrumente, welche der Notenbank zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen, aufgelistet. Aufgrund der marktwirtschaftlichen Grundstruktur der deutschen Volkswirtschaft verzichtet das Gesetz dabei auf Instrumente, die der Bundesbank einen direkten Eingriff in das Geschäft der Banken erlauben würden. Somit ist die Bundesbank nicht in der Lage, die Kreditvergabe der Kreditinstitute direkt zu begrenzen. Auch kann sie keine Zinssätze am Geld -, Kredit - oder Kapitalmarkt unmittelbar festlegen. Man kann zwischen der geldpolitischen Regulierung des Kreditgeschäfts der Bankenaufsicht und den Vorschriften der Bankenaufsicht unterscheiden. Das Kreditwesengesetz regelt die Tätigkeit des Kreditgewerbes in Deutschland und seine Beaufsichtigung durch das Bundesaufsichtsamt. Dieses Kreditwesengesetz beschränkt den Kreditvergabespielraum auf ein bestimmtes Vielfaches ihrer haftenden Mittel. Diese Vorschrift dient nur der Sicherung der Einleger und hat nichts mit Geldpolitik zu tun. Die geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank wirken indirekt und sie zielen darauf ab, das Kreditangebotsverhalten der Kreditinstitute und die Kreditnachfrage zu beeinflussen. Zusätzlich beeinflussen diese Instrumente das Anlegerverhalten der Nichtbanken über eine Veränderung der Liquidität des Banksystems und mit Hilfe des Zinsmechanismus. Die Geldpolitik in Deutschland soll die Versorgung des Bankensystems mit Zentralbankgeld sicherstellen. Dieses gelangt in das Bankensystem, entweder indem die Bundesbank den Banken dauerhaft Zentralbankgeld zur Verfügung stellt, oder indem sie den Banken Kredite gewährt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die (ehemaligen) geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank
- 1.1 Die Mindestreservepolitik
- 1.1.1 Der Ablauf der Mindestreservepolitik
- 1.1.2 Die Wirkungen der Mindestreservepolitik
- 1.2 Die Refinanzierungspolitik
- 1.2.1 Der Rediskontsatz
- 1.2.2 Die Diskontpolitik
- 1.2.3 Die Lombardpolitik
- 1.2.4 Die Wirkungen der Refinanzierungspolitik
- 1.3 Die Offenmarktpolitik
- 1.3.1 Die Schatzwechsel des Bundes
- 1.3.2 Die Wertpapierpensionsgeschäfte
- 2 Die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB)
- 2.1 Die Mindestreserven
- 2.2 Die Offenmarktgeschäfte
- 2.2.1 Hauptrefinazierungsinstrument
- 2.2.2 Langfristige Refinanzierungsgeschäfte
- 2.2.3 Feinsteuerungsoperationen
- 2.2.4 Strukturelle Operationen
- 2.3 Ständige Fazilitäten
- 2.3.1 Spitzenrefinazierungsfazilität
- 2.3.2 Einlagefazilität
- 3 Vergleich der geldpolitischen Instrumente zwischen der Deutschen Bundesbank und der EZB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank (vor der Euro-Einführung) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Ziel ist es, die Ähnlichkeiten und Unterschiede der jeweiligen Strategien zur Steuerung der Geldmenge und der Zinssätze aufzuzeigen und zu analysieren.
- Geldpolitische Instrumente der Deutschen Bundesbank
- Geldpolitische Instrumente der Europäischen Zentralbank
- Vergleich der Mindestreservepolitik
- Vergleich der Refinanzierungspolitik
- Vergleich der Offenmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Die (ehemaligen) Instrumente der Deutschen Bundesbank (Die Geldpolitik auf marktwirtschaftlicher Grundlage): Das Kapitel beschreibt die geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank im Kontext der marktwirtschaftlichen Ordnung. Es betont den indirekten Einfluss der Bundesbank auf das Kreditangebot und die Kreditnachfrage, ohne direkte Eingriffe in die Kreditvergabe der Banken. Die beschriebenen Instrumente – Mindestreserve-, Refinanzierungs- und Offenmarktpolitik – zielen darauf ab, die Liquidität des Bankensystems und somit das Anleger- und Kreditverhalten zu beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Sicherstellung der Versorgung des Bankensystems mit Zentralbankgeld durch dauerhafte Bereitstellung oder Kreditvergabe.
1.1 Die Mindestreservepolitik: Dieses Kapitel detailliert die Mindestreservepolitik der Deutschen Bundesbank. Es erklärt den Ablauf, wie die Geschäftsbanken einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einlagen zinslos als Reserve bei der Bundesbank halten mussten. Der Einfluss auf die Geldschöpfung der Geschäftsbanken wird herausgestellt, sowie die Rolle der Mindestreserve als Stabilisierungsfaktor für die Nachfrage nach Zentralbankgeld. Die Ausnahmen von der Mindestreservepflicht für bestimmte Institute und die Berechnung der Reserve werden ebenfalls erläutert. Schließlich wird die doppelte Rolle der Mindestreserve als Zentralbankgeld-Nachfrage-Generator und als Liquiditätspuffer analysiert.
Schlüsselwörter
Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank, Geldpolitik, Mindestreservepolitik, Refinanzierungspolitik, Offenmarktpolitik, Zinssätze, Geldmenge, Kreditvergabe, Liquidität, Zentralbankgeld.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Dokument: Vergleich der geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank und der EZB
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument vergleicht die geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank (vor der Euro-Einführung) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Ähnlichkeiten und Unterschieden der Strategien zur Steuerung der Geldmenge und der Zinssätze beider Institutionen.
Welche geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank werden behandelt?
Das Dokument beschreibt die Mindestreservepolitik, die Refinanzierungspolitik (einschließlich Rediskontsatz, Diskontpolitik und Lombardpolitik) und die Offenmarktpolitik (mit Schatzwechseln des Bundes und Wertpapierpensionsgeschäften) der Deutschen Bundesbank.
Wie funktioniert die Mindestreservepolitik der Deutschen Bundesbank?
Die Mindestreservepolitik beschreibt die Pflicht der Geschäftsbanken, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einlagen zinslos als Reserve bei der Bundesbank zu halten. Dies beeinflusst die Geldschöpfung der Geschäftsbanken und dient als Stabilisierungsfaktor für die Nachfrage nach Zentralbankgeld. Ausnahmen von der Pflicht und die Berechnungsweise der Reserve werden ebenfalls erläutert.
Welche geldpolitischen Instrumente der EZB werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Mindestreserven, die Offenmarktgeschäfte (Hauptrefinanzierungsinstrument, langfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen) und die ständigen Fazilitäten (Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagefazilität) der EZB.
Wie werden die Instrumente der Deutschen Bundesbank und der EZB verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Mindestreservepolitik, der Refinanzierungspolitik und der Offenmarktpolitik beider Institutionen. Das Dokument analysiert, wie beide Zentralbanken die Geldmenge und die Zinssätze steuern und welche Mechanismen sie dafür einsetzen.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Das Dokument bietet Zusammenfassungen zu den (ehemaligen) Instrumenten der Deutschen Bundesbank, wobei der indirekte Einfluss auf das Kreditangebot und die Kreditnachfrage im Kontext der marktwirtschaftlichen Ordnung hervorgehoben wird. Eine detaillierte Zusammenfassung der Mindestreservepolitik der Deutschen Bundesbank ist ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank, Geldpolitik, Mindestreservepolitik, Refinanzierungspolitik, Offenmarktpolitik, Zinssätze, Geldmenge, Kreditvergabe, Liquidität, Zentralbankgeld.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung besteht darin, die Ähnlichkeiten und Unterschiede der geldpolitischen Instrumente der Deutschen Bundesbank und der EZB aufzuzeigen und zu analysieren, um ein besseres Verständnis der Strategien zur Steuerung der Geldmenge und der Zinssätze zu ermöglichen.
- Quote paper
- Albrecht Steinmüller (Author), 2004, Vergleich der geldlichen und zinspolitischen Instrumente zwischen der Deutschen Bundesbank (bis zur Euroeinführung) und der Europäischen Zentralbank., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25153