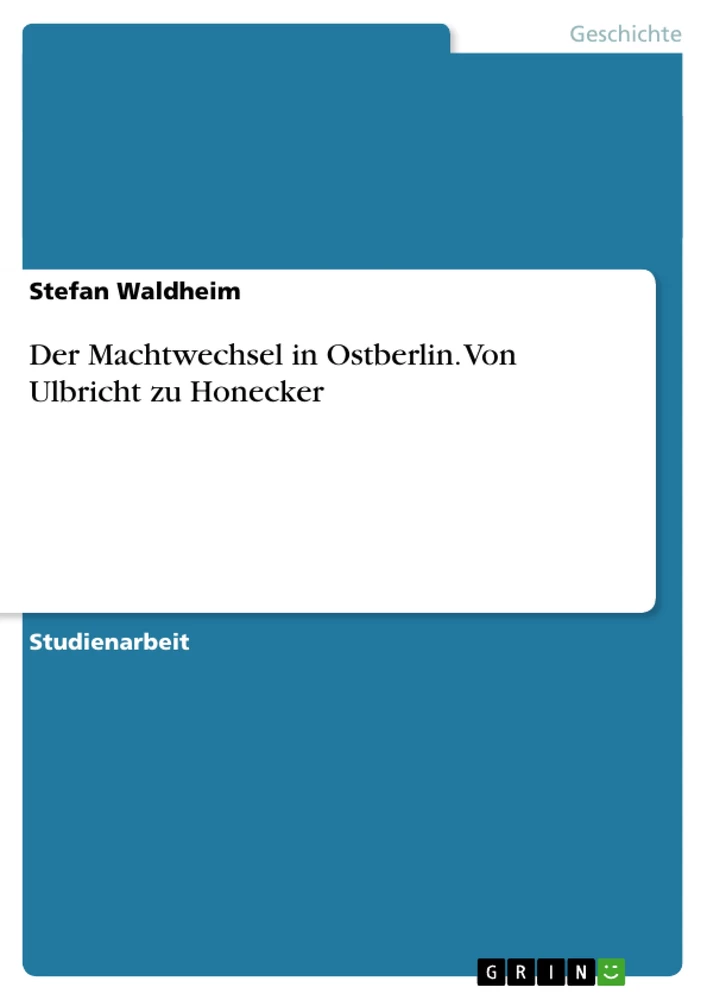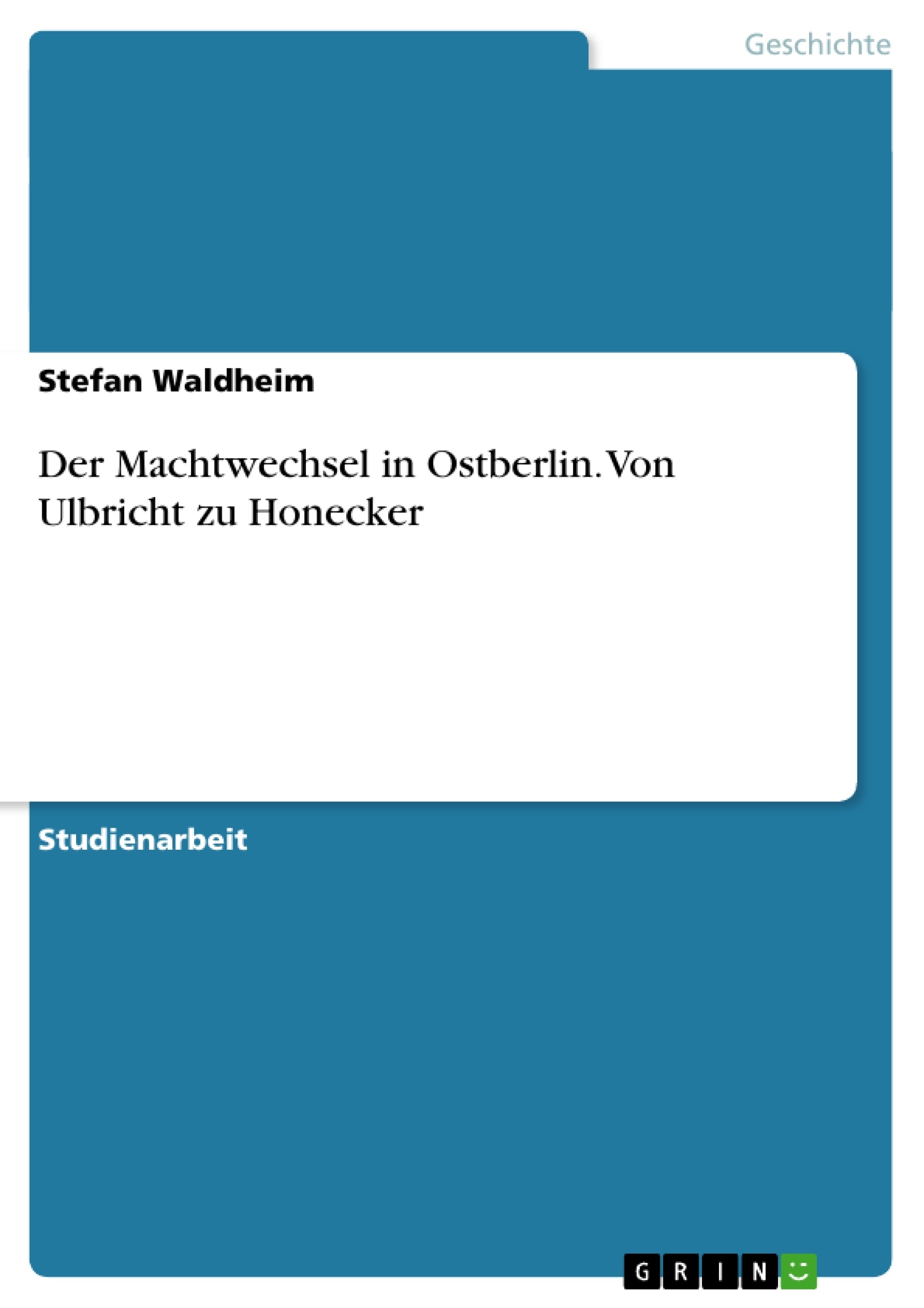Von Ulbricht zu Honecker: Schlicht ein Austausch des mächtigsten Mannes der DDR? Wohl kaum. Die Geschehnisse unmittelbar vor und nach dem Mai 1971 müssen betrachtet werden, sollen Gründe, Vorraussetzungen und Auswirkungen des Machtwechsels adäquat reflektiert werden. Eine solche Perspektive schließt die Analyse der politischen Ereignisse mit ein, welche dem Machtwechsel vorausgingen sowie die Betrachtung der Neuakzentuierungen im Zuge der teilweisen Revision Ulbricht’scher Politik zu Beginn der Ära Honecker. Der Mangel an Kontinuität in der Herrschaft der SED im Zeitraum von Mitte der 60er bis Anfang der 70er Jahre offenbarte den Bürgern vor dem Hintergrund sich verändernder wirtschaftlicher Prozesse, jugend- und kulturpolitischen Reformen und deren Überarbeitung sowie der stets im Wandel begriffenen deutsch-deutschen Beziehungen, inwiefern ostdeutsche Liberalisierungstendenzen ausgelebt und letztendlich seitens der politischen Führung doch beschränkt wurden. Dies charakterisiert das Leben in der DDR der 60er und 70er Jahre maßgeblich – trotzdem unterscheiden sich die Politiken der beiden einstigen Machthaber evident.
Im Mittelpunkt steht daher nicht nur die Frage nach dem Wie, sondern auch dem Warum des Machtwechsels. Gerade im Zuge der Beantwortung der Frage nach dem Warum sind die Politikbereiche näher zu betrachten, bei deren Gestaltung Ulbricht scheiterte. Dazu wurden diejenigen Gebiete ausgewählt, deren offensichtliche Defizite seine Gegner im Zuge der Entmachtung argumentativ bekräftigten. Im Innern beispielsweise das Scheitern der Wirtschaftsreformen der 60er und ihre Folgen. Dabei stellt sich die Frage, welche DDR Ulbricht seinem Nachfolger hinterlassen hat: Welche Maßnahmen ergriff Honecker, so dass es tatsächlich zu einer Zäsur in der Politik der SED nach dem Machtwechsel kam? Auch das Verhältnis der Machthabenden zur Bevölkerung spielt hier eine nicht unerhebliche Rolle. In diesem Zusammenhang soll fortwährend auch der Frage nachgegangen werden, inwiefern die Bürger der DDR in Folge Ulbricht’scher Innen- und Außenpolitik letztendlich den Amtsantritt Honeckers mit berechtigten Hoffnungen verbanden: Welche Veränderungen der Lebensverhältnisse durch eine Umgestaltung der SED-Politik wurden ermöglicht und in welcher Form gestaltete sich das deutschdeutsche Verhältnis nach dem Machtwechsel?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorbereitung des Machtwechsels - Das Verhältnis Ulbricht - Honecker
- Im Vorfeld des Machtwechsels - die Politik Ulbrichts in den 60er Jahren im Innern und ihre Auswirkungen
- Das wirtschaftspolitische Scheitern Ulbrichts
- Das massive Versorgungsproblem im Winter 1969/70
- Die neue Verfassung und das neue Strafgesetzbuch der DDR aus dem Jahr 1968 als Beispiele der Abgrenzungspolitik gegenüber der BRD
- Die außenpolitische Situation um 1970 – Entspannung im Ost-West Konflikt nach dem Machtwechsel
- Die Ära Honecker beginnt
- Der 8. Parteitag der SED – Programmatische Grundlage der neuen Ära
- Die Einleitung der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“
- Die liberalisierte Kultur- und Jugendpolitik Anfang der 70er Jahre
- Das Verhältnis SED – KPdSU
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Machtwechsel in Ostberlin von Walter Ulbricht zu Erich Honecker im Mai 1971. Sie befasst sich mit den Ursachen und den Folgen dieses Wechsels, insbesondere in Bezug auf die Innen- und Außenpolitik der DDR. Die Arbeit untersucht die Hintergründe für Ulbrichts Sturz, die Politik seiner Ära, die Reaktionen der Bevölkerung und die Auswirkungen des Machtwechsels auf die deutsch-deutschen Beziehungen.
- Die Vorbereitung des Machtwechsels durch Honecker
- Das Scheitern Ulbrichts in den 60er Jahren im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik
- Die Auswirkungen des Machtwechsels auf die Politik, Kultur und die Lebensverhältnisse in der DDR
- Die Veränderungen im deutsch-deutschen Verhältnis nach dem Machtwechsel
- Die Rolle der Sowjetunion in Bezug auf den Machtwechsel und die Politik der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Vorgeschichte des Machtwechsels und beleuchtet das schwierige Verhältnis zwischen Ulbricht und Honecker. Kapitel 2 befasst sich mit den innenpolitischen Problemen Ulbrichts in den 60er Jahren, insbesondere mit dem Scheitern seiner Wirtschaftsreformen und den daraus resultierenden sozialen Spannungen. Das dritte Kapitel betrachtet die außenpolitische Situation um 1970 und den Einfluss des Machtwechsels auf die Ost-West Beziehungen. Kapitel 4 analysiert die ersten Jahre der Ära Honecker, insbesondere die programmatischen Neuerungen und die Einführung einer neuen Politik in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Kultur und Jugend. Die Arbeit untersucht auch das Verhältnis der SED zur KPdSU während dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Der Machtwechsel in Ostberlin, Walter Ulbricht, Erich Honecker, SED, DDR, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Kulturpolitik, Außenpolitik, deutsch-deutsche Beziehungen, Ost-West Konflikt, Sowjetunion, KPdSU, Neue Ökonomische System der Planung und Leitung (NÖSPL/NÖS), Ökonomisches System des Sozialismus (ÖSS).
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde Walter Ulbricht 1971 entmachtet?
Gründe waren unter anderem das Scheitern seiner Wirtschaftsreformen, Versorgungsprobleme und Differenzen mit der sowjetischen Führung sowie seinem Nachfolger Honecker.
Was änderte sich unter Erich Honecker in der DDR?
Honecker führte die „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ ein und verfolgte Anfang der 70er Jahre eine liberalere Kultur- und Jugendpolitik.
Welche Rolle spielte die Sowjetunion beim Machtwechsel?
Die KPdSU entzog Ulbricht die Unterstützung und stützte Honecker, um eine stabilere politische Führung in Ostberlin zu gewährleisten.
Wie beeinflusste der Wechsel das deutsch-deutsche Verhältnis?
Der Machtwechsel fiel in eine Zeit der Entspannung im Ost-West-Konflikt, was neue Möglichkeiten für Verhandlungen zwischen der DDR und der BRD eröffnete.
Was war das „Ökonomische System des Sozialismus“ (ÖSS)?
Es war Ulbrichts Versuch, die Planwirtschaft durch mehr Eigenverantwortung der Betriebe zu reformieren, was letztlich jedoch scheiterte.
- Arbeit zitieren
- M.A. Stefan Waldheim (Autor:in), 2004, Der Machtwechsel in Ostberlin. Von Ulbricht zu Honecker, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25218