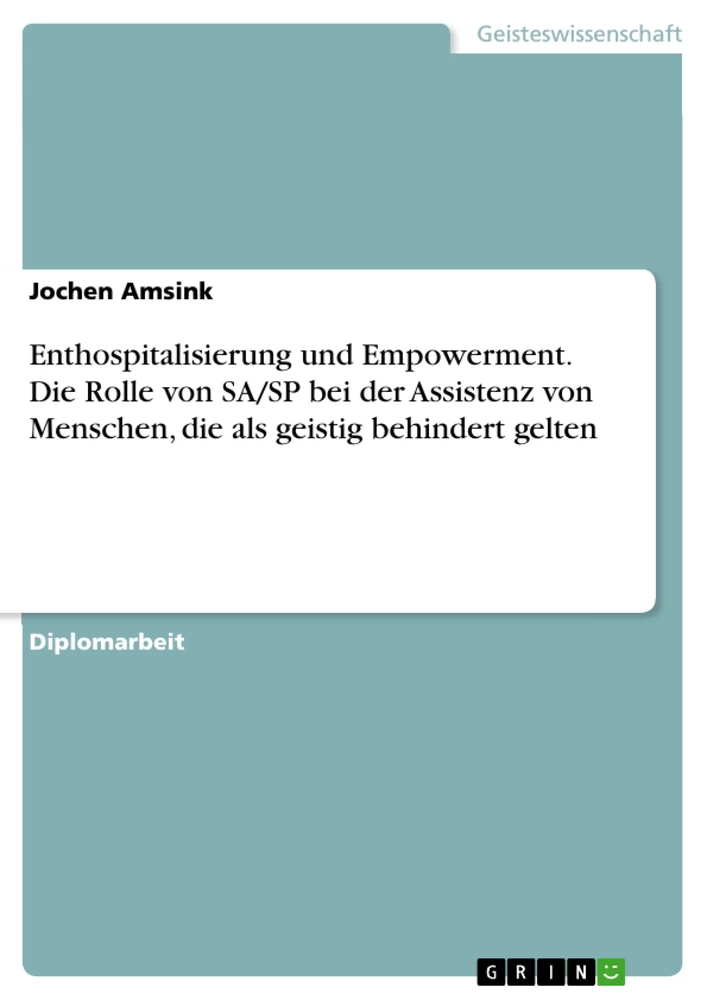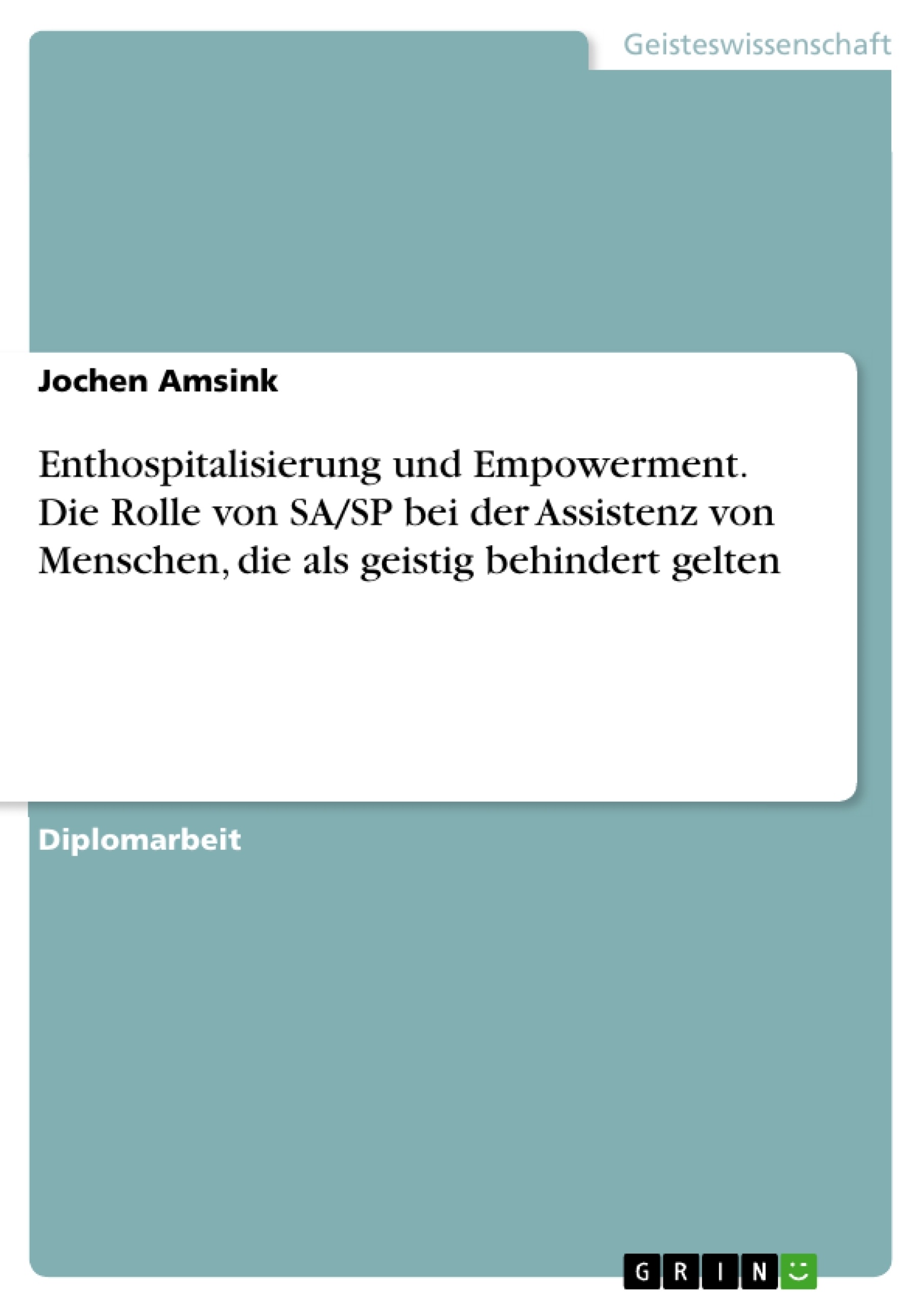Die vorliegende Arbeit entstand anläßlich meines Studiums zum Diplom-Sozialpädagogen an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach.
Diese Arbeit handelt von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, neue Wege in der Arbeit mit Menschen, die als geistig behindert gelten, zu erschließen.
Empowerment halte ich für eine Chance, neue Sichtweisen in der Behindertenhilfe und von den Menschen, die dort betreut werden, zu ermöglichen. Menschen mit Behinderung sind Menschen und erst dann behindert. Diese Erkenntnis hat sich bis heute noch nicht durchgesetzt.
Mit meiner Arbeit möchte ich darstellen, daß es viele Bereiche gibt, in denen Menschen mit einer geistigen Behinderung selbstbestimmt und autonom handeln können. Bevor das aber soweit ist, müssen die Faktoren bekämpft werden, die zur Hospitalisierung der Menschen mit geistiger Behinderung geführt haben.
Die Rolle der Sozialarbeit muß sich ändern. Sozialarbeit wird als Assistent des Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten. Daß das eine Veränderung des Rollenverständnisses beinhaltet, werde ich darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 MENSCHEN, DIE ALS GEISTIG BEHINDERT GELTEN
- 2.1 GEISTIGE BEHINDERUNG AUS GESETZLICHER UND LEISTUNGSRECHTLICHER SICHT
- 2.1.1 Eingliederungshilfe
- 2.1.1.1 Wohnen
- 2.1.1.2 Arbeit
- 2.1.1.3 Frühförderung
- 2.1.2 Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
- 2.2 GEISTIGE BEHINDERUNG AUS SICHT DER BETROFFENEN PERSON
- 3 HOSPITALISIERUNG VON MENSCHEN, DIE ALS GEISTIG BEHINDERT GELTEN
- 3.1 IDEOLOGISCHE BZW. KONZEPTIONELLE GRÜNDE FÜR HOSPITALISIERUNG
- 3.2 STRUKTURELLE (ORGANISATORISCHE) GRÜNDE FÜR HOSPITALISIERUNG
- 3.3 MITARBEITERBEZOGENE GRÜNDE FÜR HOSPITALISIERUNG
- 3.4 AUSWIRKUNG VON HOSPITALISIERUNG AUF DEN MENSCHEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG
- 3.5 FAZIT
- 4 ENTHOSPITALISIERUNG VON MENSCHEN, DIE ALS GEISTIG BEHINDERT GELTEN
- 5 DIE EMPOWERMENT-IDEE
- 5.1 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DES EMPOWERMENT
- 5.2 EBENEN DES EMPOWERMENT
- 5.2.1 Individuelle Ebene
- 5.2.2 Gruppen- und Organisationsebene
- 5.2.3 Strukturelle Ebene
- 5.2.4 Fazit
- 5.3 INHALTLICHE SCHWERPUNKTE DES EMPOWERMENT
- 5.3.1 Wichtige Werte bzw. die Philosophie des Empowerment
- 5.3.2 Methoden, die Empowerment ermöglichen
- 5.3.2.1 Beratung für einzelne Personen
- 5.3.2.2 Soziale Gruppenarbeit
- 5.4 EMPOWERMENT UND SOZIALE ARBEIT
- 5.5 PROBLEME/KRITIK
- 6 EMPOWERMENT UND GEISTIGE BEHINDERUNG
- 6.1 SELBSTBESTIMMUNG
- 6.2 CHANCENGLEICHHEIT UND GERECHTIGKEIT SOWIE DEMOKRATISCHE PARTIZIPATION
- 6.3 ASSISTENZ
- 6.4 EMPOWERMENT UND PEOPLE FIRST GRUPPEN
- 7 MÖGLICHKEITEN, UM EMPOWERMENT FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG ZU REALISIEREN
- 7.1 INDIVIDUELLE ZUKUNFTSPLANUNG
- 7.1.1 Individuelle Entwicklungsplanung der Lebenshilfe Wien
- 7.1.2 „I want my Dream!“ Persönliche Zukunftsplanung zusammengestellt von S. Doose
- 7.2 ERWACHSENENBILDUNG
- 7.3 SELBSTHILFEGRUPPEN
- 8 KONSEQUENZEN FÜR DIE ENTHOSPITALISIERUNG - SCHLUBWORT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Rolle von Sozialarbeit und Sozialpädagogik bei der Assistenz von Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext der Enthospitalisierung und Empowerment. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Hospitalisierung und die Herausforderungen der Enthospitalisierung, sowie die Bedeutung des Empowerment-Konzepts für die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung.
- Die Entwicklung und Auswirkungen der Hospitalisierung von Menschen mit geistiger Behinderung.
- Die Bedeutung der Enthospitalisierung und die Herausforderungen, die mit der Integration in die Gesellschaft verbunden sind.
- Das Empowerment-Konzept und seine Anwendung im Kontext der Assistenz für Menschen mit geistiger Behinderung.
- Die Rolle von Sozialarbeit und Sozialpädagogik bei der Unterstützung der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung.
- Möglichkeiten der individuellen Zukunftsplanung und des Zugangs zu Bildung und Selbsthilfe für Menschen mit geistiger Behinderung.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in die Thematik und beschreibt die historische Entwicklung der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der geistigen Behinderung aus unterschiedlichen Perspektiven, sowohl aus gesetzlicher und leistungsrechtlicher Sicht als auch aus der Sicht der betroffenen Person. Kapitel 3 analysiert die Gründe und Auswirkungen der Hospitalisierung von Menschen mit geistiger Behinderung, während Kapitel 4 die Enthospitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen behandelt.
Kapitel 5 widmet sich dem Empowerment-Konzept und seinen geschichtlichen Wurzeln. Es werden verschiedene Ebenen des Empowerment erläutert, sowie wichtige Werte und Methoden, die zur Stärkung der Selbstbestimmung beitragen. Kapitel 6 befasst sich mit der Bedeutung des Empowerment für Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf Selbstbestimmung, Chancengleichheit, Assistenz und die Rolle von „People First“-Gruppen.
Kapitel 7 zeigt Möglichkeiten zur Realisierung von Empowerment für Menschen mit geistiger Behinderung auf, wie z.B. individuelle Zukunftsplanung, Erwachsenenbildung und Selbsthilfegruppen. Das Kapitel 8 zieht abschließende Schlussfolgerungen und diskutiert die Bedeutung der Enthospitalisierung für die Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Enthospitalisierung, Empowerment, Selbstbestimmung, Teilhabe, Assistenz, Menschen mit geistiger Behinderung, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Lebenshilfe, individuelle Zukunftsplanung, Erwachsenenbildung und Selbsthilfe.
- Arbeit zitieren
- Jochen Amsink (Autor:in), 1998, Enthospitalisierung und Empowerment. Die Rolle von SA/SP bei der Assistenz von Menschen, die als geistig behindert gelten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2521