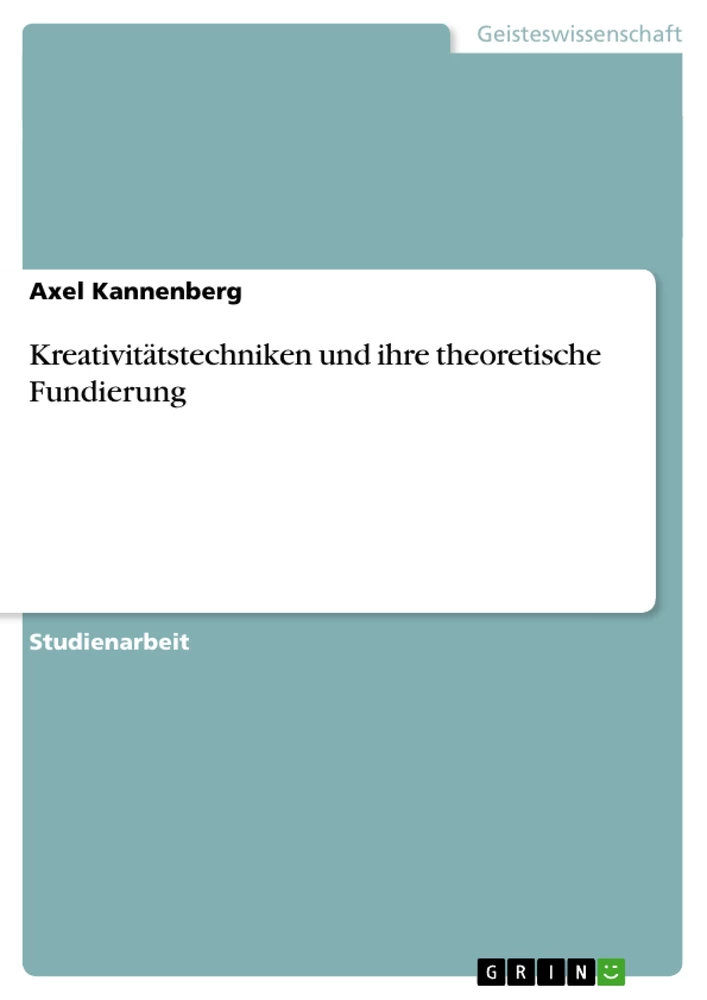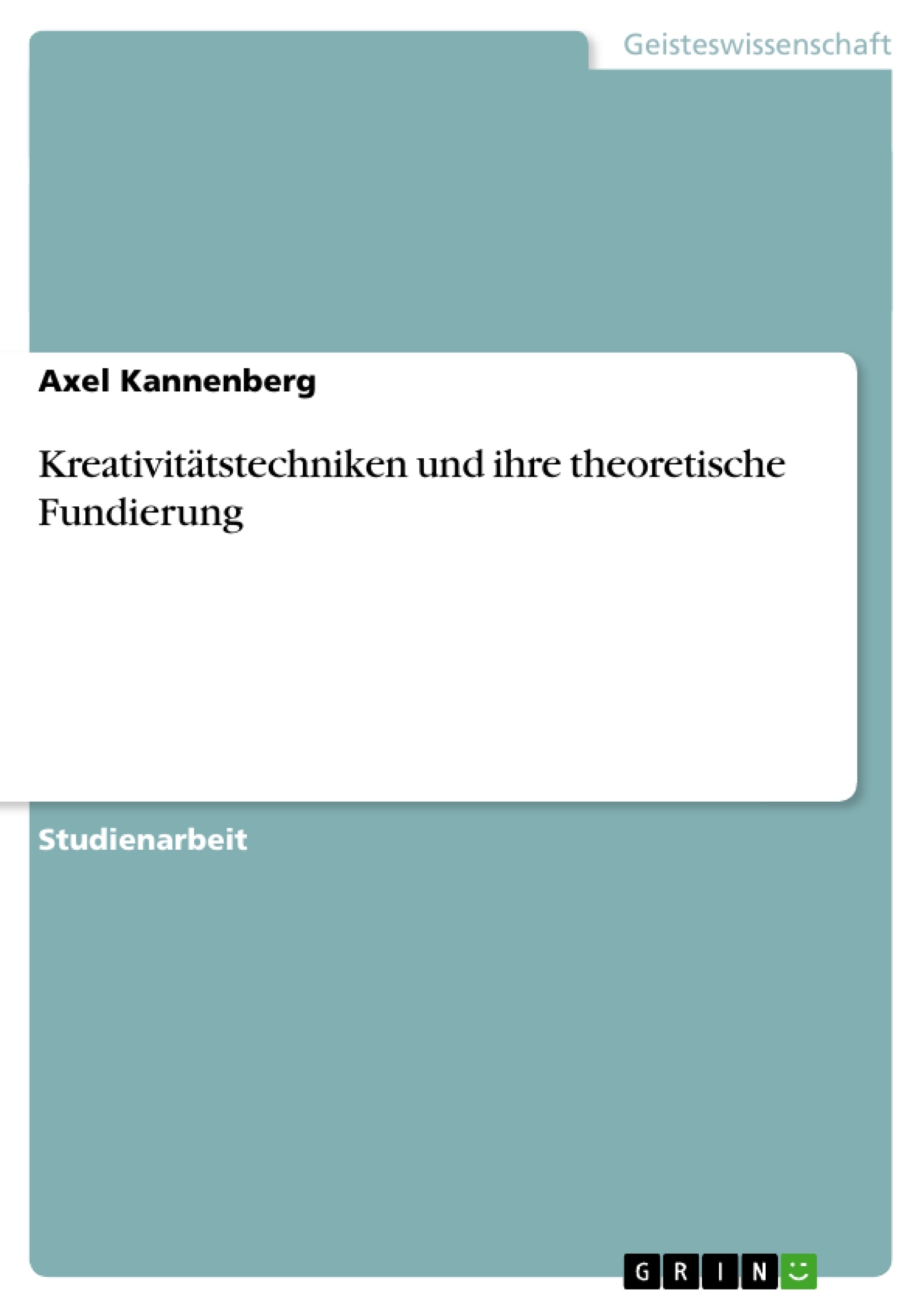Gibt es überhaupt ein philosophisches Problem, zu dem sich kein Gleichnis bei Platon findet? Für die hier vorliegende Arbeit muss die Antwort lauten: Nein. Das hier behandelte Problem ist Kreativität; wir wollen darunter, ohne große definitorische Ansprüche, das Finden von Ideen verstehen. Zwei Leitfragen führen uns das Problem vor: Wie kommt es zur Inspiration, dem sprichwörtlichen Moment der Kreativität, in dem uns plötzlich etwas einfällt, das uns so auch nach stundenlangem Grübeln nicht einfiel? Ist es möglich, diese Plötzlichkeit gewollt herbeizuführen?
Platons Gleichnis macht uns dies anschaulich. 1 Er lässt seinen Sokrates das Bild eines Taubenschlags formulieren, anhand dessen sich zwischen „besitzen“ und „haben“ ein Unterschied zeigt. Zwar „besitze“ ich alle Tauben innerhalb meines Taubenschlags, aber ich kann über die einzelne Taube nur verfügen, wenn ich sie in der Hand halte. Nur dann „habe“ ich die Taube auch, die ich schon „besitze“.
Der Taubenschlag symbolisiert unser Bewusstsein und die umherflatternden Tauben sind die Ideen darin. Und natürlich schließt sich die Frage an: Wie mache ich die Ideen aus meinem mentalen Taubenschlag verfügbar? Warte ich, bis sie mir in den Schoß flattern, oder gibt es Jagdtechniken, derer ich mich bedienen kann?
Solche Jagdtechniken gibt es und sie kommen dem modernen Bedürfnis nach Wettbewerbs-vorteilen entgegen: „Kreativität ist natürlich mehr als nur die zündende, die zukunftsweisende Idee. Wirtschaftsunternehmen müssen die Kreativität gewissermaßen institutionalisieren, in ritualisierten Prozessen auffangen, aus denen eine Vielzahl kleiner Verbesserungen und Verfeinerungen für Produkte und Dienstleistungen hervorgeht.“ 2
Inhaltsverzeichnis
- 0. Präambel
- 1. Einleitung
- 2. Suspendierte Evaluation
- 2.1. Brainstorming
- 2.2. Brainwriting
- 2.3. Wie man sein Evaluationsvermögen suspendiert
- 2.4. Suspendierte Evaluation als erfüllte Leere
- 2.5. Erfüllte Leere im Brainstorming
- 2.6. Die Notwendigkeit der Evaluation
- 3. Kombinationen
- 3.1. Kombinationstechniken
- 3.1.1. Analogie und Bisoziation
- 3.1.2. Reizwortanalyse
- 3.1.3. Semantische Intuition
- 3.1.4. Morphologie
- 3.2. Arthur Koestlers Bisoziationstheorie
- 3.2.1. Formen der Bisoziation
- 3.3. Synektik
- 3.4. Eine weitergefasste Metapherntheorie
- 3.1. Kombinationstechniken
- 4. Visualität
- 4.1. Visuelle Techniken
- 4.1.1. Varianten bekannter Techniken
- 4.1.2. Mindmapping
- 4.2. Hemisphärenmodelle
- 4.2.1. Der Ansatz von Glenda und Joseph Bogen
- 4.2.2. Übertragung auf das Mindmapping
- 4.2.3. Vertiefung des Hemisphärenmodells
- 4.1. Visuelle Techniken
- 5. Fazit und Abschlussdiskussion
- 5.1. Summe
- 5.2. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Kreativitätstechniken und ihre theoretische Fundierung. Ziel ist es, eine Brücke zwischen praxisorientierten Ratgebern und wissenschaftlichen Untersuchungen zu kreativen Prozessen zu schlagen. Die Arbeit analysiert ausgewählte Techniken aus der Ratgeberliteratur und ordnet sie theoretischen Ansätzen zu.
- Suspendierte Evaluation als Methode zur Ideenfindung
- Kombinationstechniken und ihre Anwendung
- Die Rolle der Visualität in kreativen Prozessen
- Theoretische Fundierung von Kreativitätstechniken
- Die Frage nach der "echten" Kreativität vs. Automatisierungsroutinen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Möglichkeit, Kreativität – verstanden als das Finden von Ideen – gezielt herbeizuführen. Sie nutzt Platons Gleichnis vom Taubenschlag als Metapher für das menschliche Bewusstsein und die darin enthaltenen Ideen. Die Arbeit untersucht, ob es „Jagdtechniken“ gibt, um diese Ideen verfügbar zu machen, und verweist auf den wirtschaftlichen Bedarf an institutionalisierter Kreativität. Der methodische Ansatz der Arbeit besteht darin, Techniken aus der Praxis mit theoretischen Ansätzen zu verknüpfen und diese systematisch zu kategorisieren.
2. Suspendierte Evaluation: Dieses Kapitel behandelt Techniken, die auf einer zeitweiligen Aufhebung der Evaluation beruhen, um intuitive Ideenfindung zu fördern. Es wird der Zusammenhang zwischen der bewussten Analyse und dem intuitiven „Bauchgefühl“ beleuchtet. Das Beispiel von Henri Poincaré veranschaulicht, wie Phasen intensiver, bewusster Arbeit mit Ruhepausen kombiniert werden können, um neue Ideen zu generieren. Die "schöpferische Pause" wird als wichtiger Aspekt dieser Methode hervorgehoben.
3. Kombinationen: Kapitel 3 fokussiert auf Kombinationstechniken, die die Verbindung getrennter Bereiche ermöglichen. Es werden diverse Ansätze wie Analogie, Bisoziation, Reizwortanalyse, semantische Intuition und Morphologie diskutiert und im Kontext der Bisoziationstheorie von Arthur Koestler eingeordnet. Der Begriff der Synektik und eine weiter gefasste Metapherntheorie werden ebenfalls behandelt, um das Spektrum der Kombinationstechniken zu verdeutlichen.
4. Visualität: Dieses Kapitel befasst sich mit visuellen Techniken der Ideenfindung, darunter Varianten bekannter Techniken und insbesondere Mindmapping. Die Diskussion bezieht Hemisphärenmodelle des Gehirns mit ein, um die Wirkungsweise visueller Methoden zu erklären. Der Ansatz von Glenda und Joseph Bogen wird als Grundlage zur Erklärung der Funktion von Mindmapping im Hinblick auf die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften herangezogen. Die Interaktion zwischen den Gehirnhälften wird im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Kreativität, Kreativitätstechniken, Suspendierte Evaluation, Brainstorming, Brainwriting, Kombination, Bisoziation, Synektik, Visualität, Mindmapping, Hemisphärenmodelle, Intuition, Ideenfindung, Theorie, Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit über Kreativitätstechniken
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Kreativitätstechniken und ihre theoretische Fundierung. Ziel ist es, praxisorientierte Ratgeber mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kreativen Prozessen zu verbinden, indem ausgewählte Techniken analysiert und theoretischen Ansätzen zugeordnet werden.
Welche Kreativitätstechniken werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Techniken, darunter die „suspendierte Evaluation“ (mit Brainstorming und Brainwriting), diverse Kombinationstechniken (Analogie, Bisoziation, Reizwortanalyse, semantische Intuition, Morphologie, Synektik), und visuelle Techniken wie Mindmapping. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle der Metapher und verweist auf die Bisoziationstheorie von Arthur Koestler.
Was versteht die Arbeit unter „suspendierter Evaluation“?
„Suspendierte Evaluation“ beschreibt Techniken, die eine zeitweilige Aussetzung der Bewertung von Ideen ermöglichen, um intuitive Ideenfindung zu fördern. Es wird der Zusammenhang zwischen bewusster Analyse und intuitivem „Bauchgefühl“ beleuchtet, wobei die „schöpferische Pause“ als wichtiger Aspekt hervorgehoben wird. Das Beispiel von Henri Poincaré veranschaulicht die Kombination intensiver Arbeitsphasen mit Ruhepausen.
Welche Rolle spielt die Visualität in der Ideenfindung?
Das Kapitel zur Visualität behandelt visuelle Techniken wie Mindmapping und bezieht Hemisphärenmodelle des Gehirns ein, um die Wirkungsweise dieser Methoden zu erklären. Der Ansatz von Glenda und Joseph Bogen dient als Grundlage, um die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften im Kontext von Mindmapping zu verstehen.
Wie werden die verschiedenen Techniken theoretisch fundiert?
Die Arbeit ordnet die praxisorientierten Techniken systematisch theoretischen Ansätzen zu. Sie diskutiert beispielsweise die Bisoziationstheorie von Arthur Koestler im Zusammenhang mit Kombinationstechniken und analysiert die Interaktion der Gehirnhälften im Kontext visueller Methoden. Die Arbeit strebt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis an.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind suspendierte Evaluation, Brainstorming, Brainwriting, Kombinationstechniken (inklusive Bisoziation und Synektik), Visualisierungstechniken (insbesondere Mindmapping), Hemisphärenmodelle, Intuition, Ideenfindung und die theoretische Fundierung kreativer Prozesse. Die Arbeit thematisiert auch die Frage nach der "echten" Kreativität im Gegensatz zu Automatisierungsroutinen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Suspendierter Evaluation, Kombinationstechniken, Visualität und ein abschließendes Fazit mit Ausblick. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterkapitel, die die jeweiligen Techniken und theoretischen Konzepte vertiefen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz beschreibt. Die folgenden Kapitel behandeln die einzelnen Kreativitätstechniken jeweils mit theoretischer Einordnung. Ein abschließendes Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschung.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für Kreativitätstechniken, deren Anwendung und theoretische Grundlagen interessieren. Sie richtet sich an Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die an der Verbesserung ihrer Ideenfindung und der Entwicklung innovativer Lösungen interessiert sind.
Wo finde ich die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Kreativität, Kreativitätstechniken, Suspendierte Evaluation, Brainstorming, Brainwriting, Kombination, Bisoziation, Synektik, Visualität, Mindmapping, Hemisphärenmodelle, Intuition, Ideenfindung, Theorie, Praxis.
- Arbeit zitieren
- Axel Kannenberg (Autor:in), 2003, Kreativitätstechniken und ihre theoretische Fundierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25254