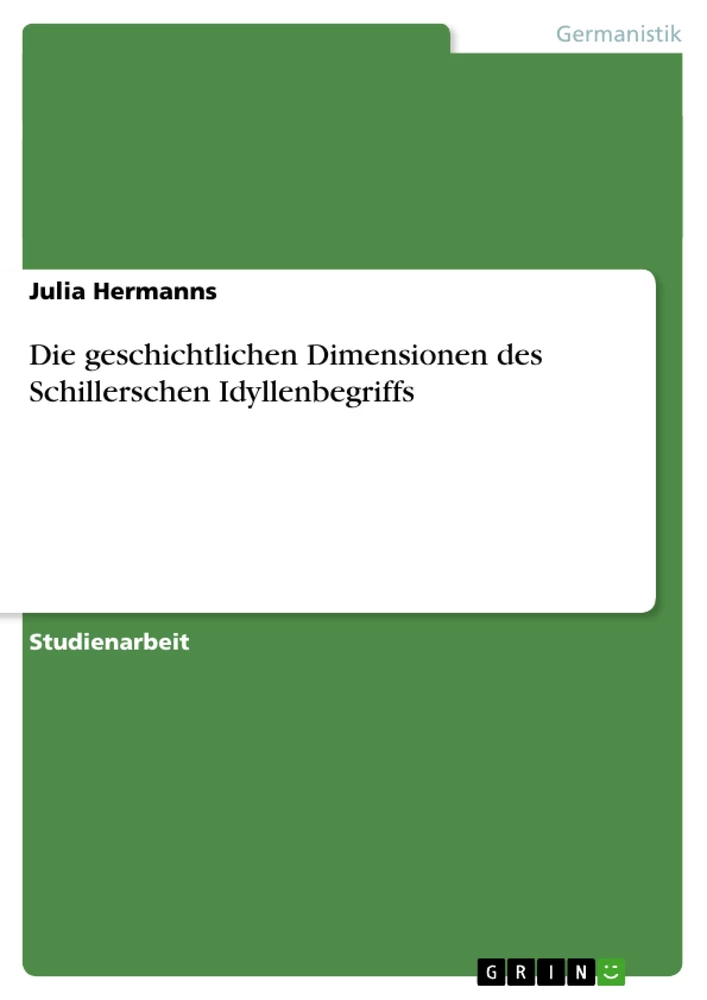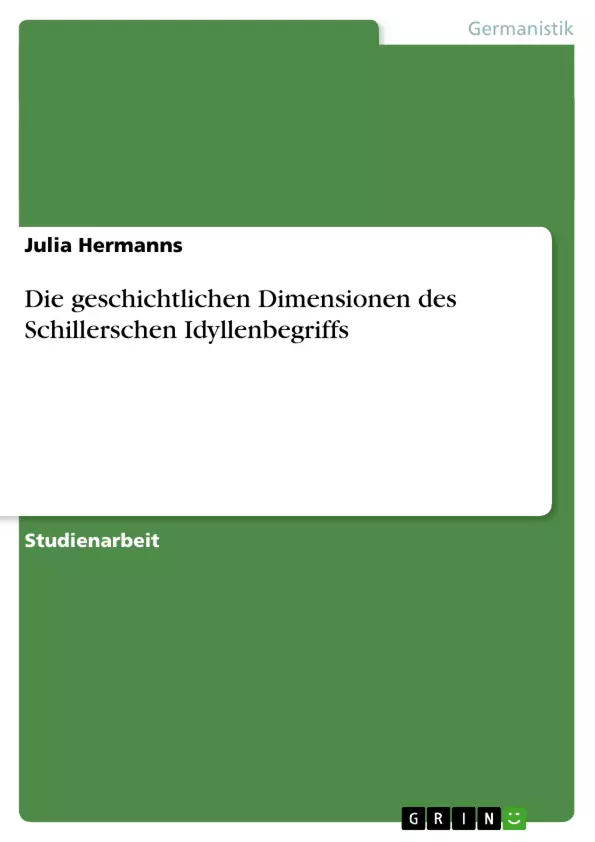Der Verlauf der Französischen Revolution ließ Schiller über die Idee eines politischen
Fortschritts resignieren. Er erkannte, dass das ideale Geschichtsziel vom „Paradies der
Erkenntnis und der Freiheit“2 auf dem gesellschaftlichen Weg nicht herbeizuführen sei.
Schiller gab jedoch seine Idee vom idealen Staat nicht auf, sondern verlegte ihre
Verwirklichung ins Ästhetische. In seinen philosophischen Schriften sah sich Schiller dazu
veranlaßt, diesen idealen Staat zu entwerfen, um den Menschen die `Veredelung ihres
Charakters` zu ermöglichen. Denn nur so bestehe überhaupt die Möglichkeit einer
„Annäherung an eine paradiesische Vollendung der Geschichte“.3
In seinen großen philosophischen Schriften verbindet Schiller Anthropologie, Geschichte und
Ästhetik miteinander. Vor allem seine Abhandlungen Über die ästhetische Erziehung des
Menschen4 und Über naive und sentimentalische Dichtung5 können als Antwort auf die
Begebenheiten der Französischen Revolution und als Auseinandersetzung mit seiner eigenen
Dichtungsweise gelesen werden.
Für das Ende des 18. Jahrhunderts – einer Zeit grundlegender und radikal tiefgreifender
Veränderungen - ist es sehr kennzeichnend, nach dem Sinn der Kunst überhaupt zu fragen.
Schiller sucht in seinen ästhetischen Schriften die Wirksamkeit der Dichtung in dieser ganz
bestimmten historischen Situation zu ermitteln, indem er der modernen Gesellschaft einen
Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Ideal diagnostiziert. Die ursprüngliche Einheit von
Natur und Kultur existiere nicht mehr. Die sentimentalische Dichtung beruhe auf dieser
gegenwärtigen Trennung zwischen Natur und Kultur und beziehe sich aus der Besinnung auf
ihre ehemalige arkadische Ausgewogenheit auf ihren zukünftigen elysischen Zusammenschluß.
Auf den Widerspruch der modernen Gesellschaft könne der moderne Dichter in dreifacher
Weise reagieren. Diesen drei möglichen Beziehungen zwischen Ideal und Wirklichkeit
entsprächen die drei sentimentalischen Dichtungsarten Satire, Elegie und Idylle. [...]
2 Eduard von der HELLEN (Hg,): Schillers sämtlichen Werke. Säkularausgabe in 16. Bdn , Bd. 13, Stuttgart 1904-1906, S. 25.
3 Gert SAUTERMEISTER: Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Zum geschichtlichen Ort seiner klassischen
Dramen, Stuttgart 1971, S. 23.
4 Friedrich SCHILLER: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. In: Schillers
Werke. Nationalausgabe, Bd. 20, Weimar 1987, S. 309-412.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- I. Die gesellschaftskritische Funktion der Kunst
- II. Die Autonomie der Kunst
- Ausblick
- Literatur
- I. Primärliteratur
- II. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, welche Funktion Schillers Entwurf eines ästhetischen Staates vor dem Hintergrund der Französischen Revolution in Verbindung mit seiner Gattungspoetik der utopischen Idylle hat. Dabei werden insbesondere die Konzeptionen von Gethmann-Siefert, Sautermeister, Karthaus und Kaiser aufgezeigt und diskutiert, die sich mit der gesellschaftskritischen Funktion und der Autonomie von Schillers Kunst auseinandersetzen.
- Die gesellschaftskritische Funktion der Kunst in Schillers Werken
- Die Autonomie der Kunst und ihre Trennung von der Realität
- Schillers Rezeption der Französischen Revolution und dessen Einfluss auf seine Schriften
- Die Verbindung von Geschichte, Ästhetik und künstlerischer Praxis
- Die Bedeutung der Idylle als utopisches Konzept in Schillers Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet Schillers kritische Haltung gegenüber der Französischen Revolution und seine Verlagerung des idealen Staates ins Ästhetische. Sie stellt Schillers philosophische Schriften, insbesondere „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ und „Über naive und sentimentalische Dichtung“, als Antwort auf die Ereignisse der Revolution und als Auseinandersetzung mit seiner eigenen Dichtungsweise dar.
Hauptteil
I. Die gesellschaftskritische Funktion der Kunst
Dieses Kapitel analysiert die Argumentation von Gethmann-Siefert, Sautermeister und Karthaus, die Schillers Entwurf der Idylle als gesellschaftskritische Alternative zu den realen historischen Umständen interpretieren. Es wird untersucht, ob Schillers Kunst eine zeitgemäße Reaktion auf die Mängel der Gesellschaft darstellt.
II. Die Autonomie der Kunst
Dieses Kapitel analysiert die Argumentation von Kaiser, der Schillers Entwurf der Idylle als zeitlose, unpolitische Idee interpretiert. Es wird diskutiert, ob Schillers Kunst eine unabhängige ästhetische Sphäre darstellt, die von der Realität getrennt ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schillers Entwurf des ästhetischen Staates, Idylle, Französische Revolution, gesellschaftskritische Funktion, Autonomie der Kunst, Gattungspoetik, Utopieforschung, Philosophie der Geschichte, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte Friedrich Schiller auf die Französische Revolution?
Schiller resignierte angesichts des Verlaufs der Revolution und suchte die Verwirklichung des idealen Staates nicht mehr im Politischen, sondern im Ästhetischen.
Was versteht Schiller unter dem "ästhetischen Staat"?
Es ist ein Entwurf in seinen philosophischen Schriften, der durch die Veredelung des menschlichen Charakters eine Annäherung an ein paradiesisches Geschichtsziel ermöglichen soll.
Welche Bedeutung hat die "Idylle" in Schillers Werk?
Die Idylle fungiert als utopisches Konzept und eine der drei sentimentalischen Dichtungsarten, die den Widerspruch zwischen Natur und Kultur thematisieren.
Was ist der Unterschied zwischen naiver und sentimentalischer Dichtung?
Naive Dichtung stellt eine ursprüngliche Einheit mit der Natur dar, während sentimentalische Dichtung auf der modernen Trennung von Natur und Kultur beruht.
Wird Schillers Kunst als autonom oder gesellschaftskritisch angesehen?
Die Arbeit diskutiert beide Positionen: die Idylle als gesellschaftskritische Alternative (Sautermeister) versus die Idylle als zeitlose, unpolitische Idee (Kaiser).
- Quote paper
- Julia Hermanns (Author), 2003, Die geschichtlichen Dimensionen des Schillerschen Idyllenbegriffs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25309