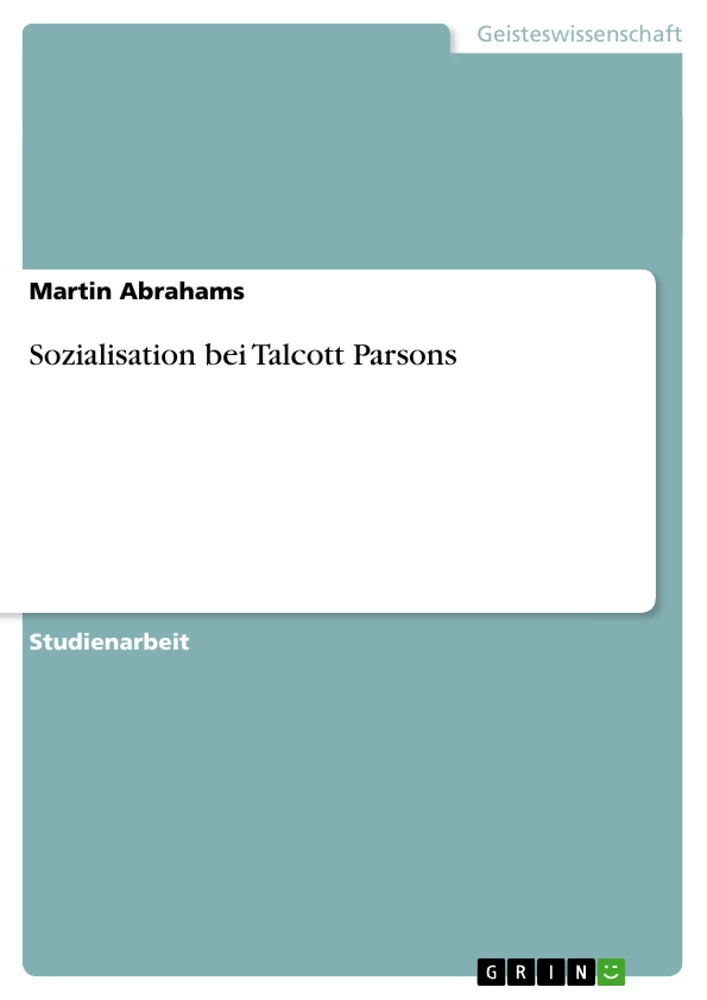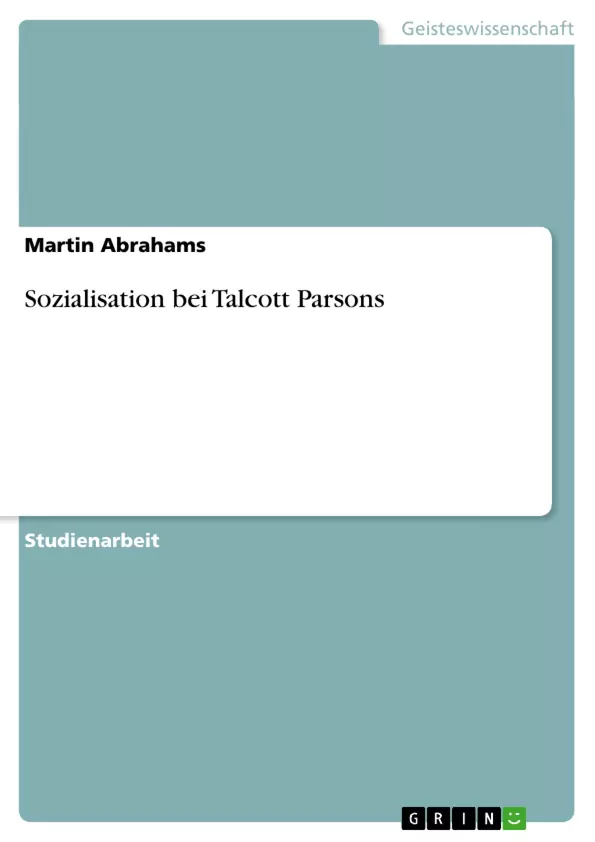Talcott Parsons hatte den Weg zur Soziologie über die ökonomische Theorie gefunden. Vor dem Hintergrund des Börsencrashs von 1929 schien das liberalistische Modell des entstaatlichten, nur durch Angebot und Nachfrage regulierten Marktes nicht mehr zu funktionieren, sondern vielmehr Not und Armut zu steigern. Erst als es der amerikanischen Regierung Mitte der 30er Jahre gelang, mit Hilfe einer neuen Kreditpolitik die Konjunktur anzukurbeln und ihre wirtschaftliche Steuerungskompetenz unter Beweis zu stellen, schienen die Folgen der Welwirtschaftskrise aufgefangen werden zu können.
Anders als in den USA waren die europäischen Staaten nach dem ersten Weltkrieg nicht nur wirtschaftlich unter Druck geraten, sondern auch durch die politische Frontstellung zur sozialistischen Sowjetunion bedroht. Während in den USA die Präsidialdemokratie, der Parsons uneingeschränkt positiv gegenüberstand, gestärkt aus der Krise hervorging, versuchte man in einigen europäischen Staaten, den inneren und äußeren Bedrohungen mit faschistischen Herrschaftskonzepten zu begegnen. Vor diesem Hintergrund wurde für Parsons das Ordnungsproblem zur zentralen Frage der Soziologie.
Parsons war überzeugt, dass die uneingeschränkte Durchsetzung privater Interessen auf Dauer destabilisierend wirken muss, genauso wie diktatorische Gewalt zur Durchsetzung von Ideologien, die nur mit Hilfe äußerer Zwangsmittel soziale Ordnung gewährleisten, keine Lösung darstellen kann. Er steht für ein voluntaristisches Modell, verbunden mit der Auffassung, dass im besten Fall die Akteure von der Durchsetzung individueller Machtinteressen Abstand nehmen und stattdessen ihr Handeln freiwillig an kollektiv verbindlichen, in der Gemeinschaft verankerten Werten orientieren.
Vor diesem Hintergrund muss eine Theorie der Sozialisation darüber Auskunft geben können, wie und in welchen gesellschaftlichen Kontexten sich autonome und zugleich verantwortungsvolle Persönlichkeiten entwickeln können. Talcott Parsons war der erste, der eine Sozialisationstheorie in einer systematischen Form als Bestandteil einer Gesellschaftstheorie ausarbeitete; mit Hilfe der Begriffe ‚Sozialisation‘ und ‚Internalisierung‘ verknüpfte er die Frage nach der Stabilität sozialer Ordnungen mit der nach dem Ursprung von subjektiven Handlungsorientierungen. Dabei versuchte er unterschiedliche kulturanthropologische, interaktionistische und vor allem psychoanalytische Theorien zu integrieren (vgl. Veith 1996: 403 f.). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systemtheorie
- Sozialisation als Handeln in Rollen
- Sozialisation und Internalisierung
- Parsons' Adaption der psychosexuellen Entwicklungsstufen nach Freud
- Die Bedeutung und Verinnerlichung von Kultur nach Parsons
- Außerfamiliäre Sozialisationsinstanzen
- Pattern variables
- Die Schulklasse als Sozialisationsinstanz
- Die sozialisatorische Funktion der peer-groups
- Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Sozialisationstheorie von Talcott Parsons und untersucht, wie sich in seinen Augen autonome und zugleich verantwortungsvolle Persönlichkeiten entwickeln können.
- Die Systemtheorie von Parsons und deren Anwendung auf gesellschaftliche Strukturen
- Die Rolle von Sozialisation und Internalisierung in der Entwicklung von Individuen
- Die Bedeutung von Rollenmustern und institutionellen Strukturen für die Stabilität der Gesellschaft
- Die verschiedenen außerfamiliären Sozialisationsinstanzen und ihre spezifischen Funktionen
- Die Kritik an Parsons' Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt die Motivation für Parsons' Sozialisationstheorie im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Krisen der 1930er Jahre vor. Er betont das Ordnungsproblem und die Notwendigkeit einer Theorie, die die Entwicklung autonomer und verantwortungsvoller Persönlichkeiten erklärt.
- Systemtheorie: Parsons' Systemtheorie wird eingeführt, die Gesellschaften als komplexe Systeme betrachtet, die zur Erhaltung ihrer Stabilität bestimmte Funktionen erfüllen. Der Text beleuchtet die Struktur und Funktion des Gesellschaftssystems, die verschiedenen Subsysteme und deren Interaktion.
- Sozialisation als Handeln in Rollen: Parsons' Auffassung von Sozialisation als ein Prozess der Einbindung in Rollenmuster und institutionelle Strukturen wird erläutert. Die Verinnerlichung von Mustern der Rollen-Interaktion ermöglicht die Übernahme eigener und fremder Rollen.
- Sozialisation und Internalisierung: Die Adaption von Freuds psychosexuellen Entwicklungsstufen durch Parsons wird beschrieben. Der Text analysiert die Bedeutung und Verinnerlichung von Kultur nach Parsons und dessen Theorie der Internalisierung von Normen und Werten.
- Außerfamiliäre Sozialisationsinstanzen: Der Text behandelt die verschiedenen außerfamiliären Sozialisationsinstanzen, wie die Schulklasse und peer-groups. Die Rolle der "Pattern variables" in der Sozialisation und ihre Funktion in verschiedenen Institutionen wird erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes sind Systemtheorie, Sozialisation, Internalisierung, Rollen, Institutionen, Pattern variables, außerfamiliäre Sozialisationsinstanzen, Schulklasse, peer-groups, Kritik.
- Arbeit zitieren
- Martin Abrahams (Autor:in), 2003, Sozialisation bei Talcott Parsons, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25337