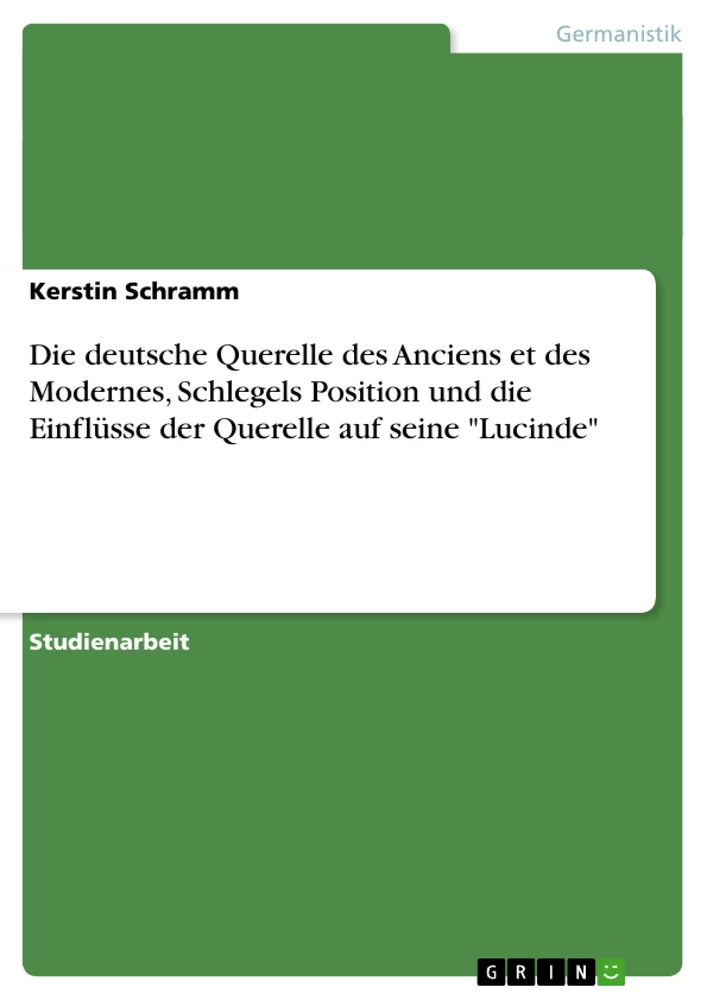Der Querelle des Anciens et des Modernes hat in der Literaturgeschichte
vergleichsweise wenig Beachtung gefunden, obwohl seine Wirkung auf unser
gegenwärtiges Kunst- und Ästhetikkonzept sowie die Perspektive unserer
heutigen Geschichtsbetrachtung von großer Bedeutung ist.
Mit der Querelle des Anciens et des Modernes beginnt sich das, für uns
heute selbstverständliche lineare, diachronisch-historische Geschichtsdell
durchzusetzen. Weiterhin setzt sich das systemtheoretische BasisÜberbau-
ModellA durch, das heißt, Entwicklungen und Neuerungen künstlerischer
Bereiche werden im Zusammenhand sozialer und politischer Veränderungen
begriffen. Ohne die Querelle wäre unser heutiges Kunstverständnis
autonomer Kunst undenkbar. Die Legitimation der epochalen nationalen
Kunst als Ergebnis der Querelle führte überdies zur Stärkung des nationalen
Selbstwertgefühls und zur Rückbesinnung auf die eigene Kultur. Eigene
Brauchtümer und Traditionen werden wieder entdeckt. Die sogenannte
Deutschtümelei findet Ausdruck in deutschen Märchen (Grimms Märchensammlung),
Sagen und Volksliedern. Hier sind auch die Anfänge der deutschen
Literaturwissenschaften zu finden.
Auf die Literatur der Romantik hatte die Querelle großen Einfluss und in
vielen frühromantischen Werken werden die Fragen der Querelle implizit
eingeflochten und bearbeitet. Insbesondere Schlegel war maßgeblich an der
deutschen Querelle beteiligt und auch sein Roman „Lucinde“ spiegelt die
Fragen der Querelle wieder. Ohne das Wissen um die Querelle würde ein
wichtiger Zugang zu diesem frühen Werk Schlegels fehlen.
Ich werde in der folgenden Arbeit nach dem geistesgeschichtlichen Ansatz
vorgehen und versuchen die Hintergründe und Ursachen des Querelles darzulegen.
Weiter möchte ich auf die deutsche Querelle und ihre Vertreter,
insbesondere auf Schlegels Position und die Wirkung des Streites auf seine
Philosophie und Poesie eingehen.
Die Gründe für die Querelle, ihre Durchführung und Folgen sind allerdings
so vielfältig und komplex, daß es mir im Rahmen dieser Hausarbeit nicht
möglich sein wird den Streit in seiner Universalität darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Vorraussetzungen und Ergebnisse der Querelle des Anciens et des Modernes in Frankreich und Deutschland
- Vorraussetzungen der Querelle
- Die französische Querelle
- Die deutsche Querelle
- Die Fragen der Querelle
- Die Vertreter der deutschen Querelle
- Herders Briefe „Zur Beförderung der Humanität“
- Schillers Abhandlung „Über naive und sentimentale Kunst“
- Die Querelle als Missverständnis?
- Das Zeit- und Geschichtsverständnis als Problem der Querelle
- Qualitativer versus quantitativer Zeitbegriff
- Synchrone versus diachrone Geschichtsauffassung
- Die Ästhetikkonzepte als Problem der Querelle
- Das Zeit- und Geschichtsverständnis als Problem der Querelle
- Teil II: Friedrich Schlegel Position in der Querelle des Anciens et des Modernes und Einflüsse auf seine Philosophie und Poesie
- Schlegels Position in der Querelle: „Über das Studium der griechischen Poesie”
- Schlegels Universalphilosophie und -poesie als Produkt der Querelle
- Schlegels Theorie der Naturpoesie als Sublimation und Substitution gesellschaftlicher und religiöser Funktionen, der Entzweiung von Mensch und Natur, von natürlicher und künstlicher Kunst
- Die Wirkung der Querelle des Anciens et des Modernes auf Schlegels Lucinde
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Querelle des Anciens et des Modernes, einem literarhistorischen Streit, der unsere heutige Kunst- und Ästhetikauffassung maßgeblich beeinflusst hat. Ziel ist es, die Hintergründe und Ursachen des Streits zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Querelle, sowie Schlegels Position und die Auswirkungen des Streits auf seine Philosophie und Poesie.
- Die Entstehung und Entwicklung des Streits zwischen Anciens und Modernen
- Die Rolle der deutschen Querelle und ihrer Vertreter, insbesondere Herder und Schiller
- Schlegels Auseinandersetzung mit der Querelle und seine Position im Streit
- Der Einfluss der Querelle auf Schlegels Philosophie und Poesie, insbesondere auf seine „Lucinde“
- Das Zeit- und Geschichtsverständnis im Kontext der Querelle
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und führt in das Thema der Querelle des Anciens et des Modernes ein, wobei die Bedeutung des Streits für die gegenwärtige Kunst- und Ästhetikauffassung hervorgehoben wird. Die Kapitel zwei und drei befassen sich mit den Vorraussetzungen und dem Verlauf der Querelle in Frankreich und Deutschland. Hierbei wird der Fokus auf den Streit zwischen den Vertretern des Anciens und den Modernen gelegt, insbesondere auf die Thesen von Charles Perrault. Das vierte Kapitel untersucht die deutschen Vertreter der Querelle, insbesondere Herder und Schiller. Die Frage nach dem Zeit- und Geschichtsverständnis im Kontext der Querelle wird im fünften Kapitel beleuchtet. Das sechste Kapitel analysiert Schlegels Position in der Querelle, insbesondere seine Universalphilosophie und -poesie sowie seine Theorie der Naturpoesie. Schließlich wird im siebten Kapitel die Wirkung der Querelle auf Schlegels „Lucinde“ diskutiert.
Schlüsselwörter
Querelle des Anciens et des Modernes, deutsche Querelle, Friedrich Schlegel, Lucinde, Zeitverständnis, Geschichtsauffassung, Ästhetik, Naturpoesie, Universalphilosophie, Kunst, Literatur, Antik, Moderne, Tradition, Fortschritt, Humanität.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Querelle des Anciens et des Modernes“?
Es war ein literarischer Streit, der im 17. Jahrhundert in Frankreich begann und die Überlegenheit der antiken Autoren gegenüber den modernen Schriftstellern (und umgekehrt) thematisierte.
Welchen Einfluss hatte die Querelle auf Friedrich Schlegel?
Die Fragen der Querelle beeinflussten maßgeblich Schlegels Universalphilosophie und spiegeln sich in seinem Roman „Lucinde“ wider.
Wer waren die Vertreter der deutschen Querelle?
Wichtige Vertreter waren Herder (Briefe zur Beförderung der Humanität) und Schiller (Über naive und sentimentale Dichtung).
Wie veränderte die Querelle unser Geschichtsverständnis?
Mit der Querelle begann sich das lineare, diachronisch-historische Geschichtsmodell durchzusetzen, das Entwicklungen im Kontext sozialer und politischer Veränderungen begreift.
Was bedeutet „Naturpoesie“ bei Schlegel?
Es ist ein theoretisches Konzept zur Sublimation der Entzweiung von Mensch und Natur und stellt eine Verbindung zwischen natürlicher und künstlicher Kunst her.
Warum ist das Wissen um die Querelle wichtig für das Verständnis der Romantik?
Viele frühromantische Werke verarbeiten implizit die Fragen nach Tradition versus Fortschritt und der Legitimation nationaler, zeitgenössischer Kunst.
- Arbeit zitieren
- Kerstin Schramm (Autor:in), 2004, Die deutsche Querelle des Anciens et des Modernes, Schlegels Position und die Einflüsse der Querelle auf seine "Lucinde", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25482