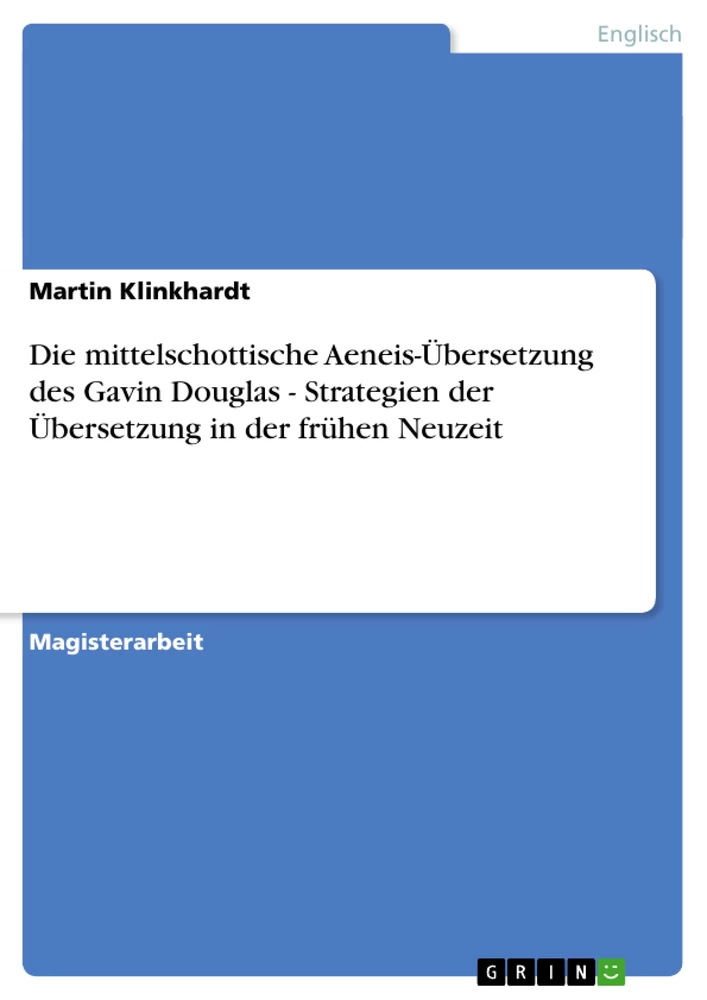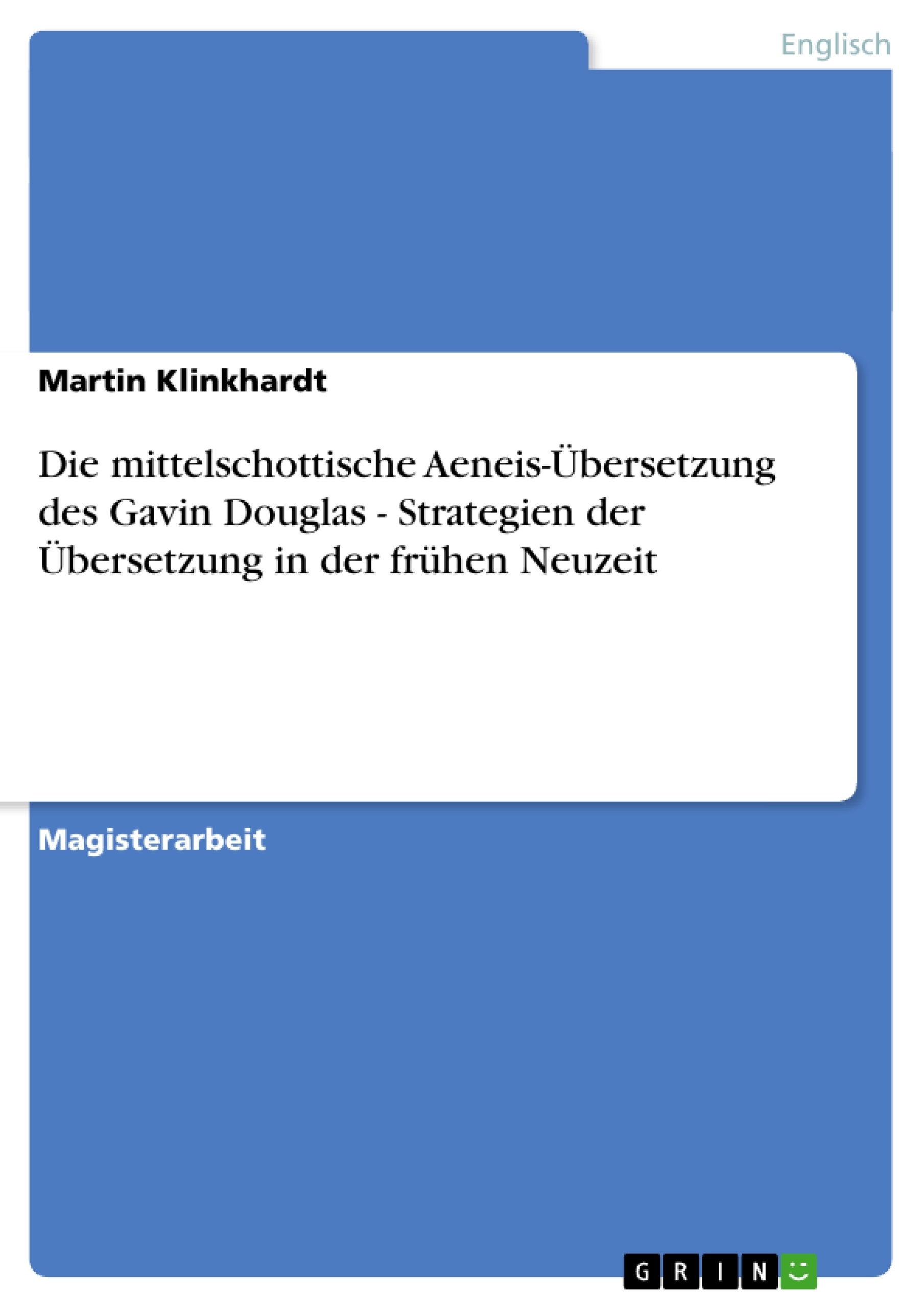Was macht eine gute Übersetzung aus? Wer diese Frage gestellt bekommt, wird zunächst meist antworten, sie müsse richtig sein. Diese scheinbar triviale Antwort ist jedoch nur schwer genauer auszuführen. Ein breites Spektrum von Kriterien zeigt sich, das von der möglichst genauen Wiedergabe von Wortlaut, Satzstruktur und Stil über die umfassende Vermittlung des Sinns bis hin zur Bewahrung der Sprachmelodie reicht. Was davon als besonders wichtig erachtet wird, variiert nicht nur von einem Befragten zum nächsten, sondern auch zwischen verschiedenen Textgattungen.
Aus dieser überall leicht nachprüfbaren Tatsache erwachsen zwei Schlußfolgerungen: Jeder Mensch legt - erstens - andere Maßstäbe an die Qualität einer Übersetzung an und übersetzt dementsprechend anders. Daraus folgt auch, daß es - zweitens - keine absolut unübertreffliche Übersetzung gibt. Es gibt jedoch einen Konsens darüber, wie eine solche optimale Version beschaffen sein soll. Sie muß den Sinn des Originals richtig wiedergeben, also die Aussage jedes einzelnen Satzes und des Ganzen hinsichtlich Kommunikationsintention, literarischen Anspielungen, Konnotationen,
Denotationen und weiterer Kriterien getreu vermitteln. Daneben soll sie die Wortwahl, den Bau und die Melodie des Satzes bewahren, damit die Akzentuierung der Satzbestandteile und eventuelle Wortspiele erhalten bleiben. Schließlich sollen die Stilebene, die Klarheit und, wo möglich, auch die Länge des Satzes gewahrt werden.
Eine solche ideale Übertragung, die all dies berücksichtigt, ist unerreichbar. Der Übersetzer steht vor der Aufgabe, die verschiedenen Anforderungen so zu gewichten, daß eine Version entsteht, die möglichst viele der genannten Kriterien möglichst gut erfüllt. Dabei kann er (in der heutigen Zeit) auf Modelle zurückgreifen, die Andere für frühere Übersetzungen benutzt haben. Im ausgehenden Mittelalter gab es überaus wenige solcher Modelle, und sie waren in aller Regel auf die Version ins Lateinische ausgerichtet. Die Übersetzung eines
Textes in die Volkssprachen war ein unerhört neuer Gedanke. Wer sich damit befaßte, war gezwungen, eigene Kriterien für die Übertragung zu entwickeln. Einer dieser frühen Übersetzer in die Volkssprache ist der schottische Adlige und Bischof Gavin Douglas.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Editionsgeschichte und Forschungsbericht
- Editionsgeschichte
- Forschungsbericht
- Vergil und Gavin Douglas – ihr Leben und Werk
- Leben und Werk Vergils
- Leben und Werk des Gavin Douglas
- Die schottische Sprache des Gavin Douglas
- Geschichtlicher Abriß
- Die sprachliche Entwicklung des Schottischen im Mittelalter
- Unterschiede zwischen Inglis und Scottis
- Gavin Douglas' Begriff des Scottis
- Die Strukturen von Aeneis und Eneados im Vergleich
- Die Gestalt der Aeneis
- Die Struktur der Eneados und ihre Abweichungen von der Aeneis
- Die Übersetzungsstrategie des Gavin Douglas
- Einleitung: Metrum und formale Aspekte
- Douglas' Übersetzungsprinzipien im literaturhistorischen Kontext
- Übersetzen in der klassischen Antike: Cicero und Horaz
- Übersetzen von der Spätantike bis zur Neuzeit: Hieronymus, Luther
- Douglas' Prinzipien der Übersetzung
- Verbum pro verbo und sensus ad sensum
- Erweiterungen des Textes
- Sprachliches: Douglas' Anreicherung des Scottis
- Zusammenfassung
- Die Übersetzung des Gavin Douglas
- Auslassungen
- Erweiterungen
- Füllmaterial für Verslängen und Reimwörter
- Hendiadyoin
- Kommentare und Erklärungen
- Patronymika und Toponymika
- Sacherklärungen
- Auflösung von Implikaturen
- Abweichungen und Fehler
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Übersetzung des Gavin Douglas, der die Aeneis von Vergil ins Schottische übertrug. Die Arbeit analysiert die Übersetzungsstrategie von Douglas und beleuchtet die sprachlichen und formalen Aspekte seiner Arbeit. Des Weiteren untersucht die Arbeit, wie Douglas die Prinzipien der Übersetzung im Kontext der damaligen Zeit umsetzte und welche Einflüsse auf seine Arbeit wirkten.
- Analyse der Übersetzungsstrategie des Gavin Douglas
- Untersuchung der sprachlichen und formalen Aspekte der Eneados
- Bewertung von Douglas' Umsetzung der Prinzipien der Übersetzung im Kontext der frühen Neuzeit
- Beurteilung des Einflusses klassischer und mittelalterlicher Übersetzer auf Douglas' Arbeit
- Vergleich der Strukturen von Aeneis und Eneados
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema der Arbeit und legt die Forschungsfrage fest. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Editionsgeschichte und der bisherigen Forschung zur Eneados. Das dritte Kapitel widmet sich der Biographie und dem Werk von Vergil und Gavin Douglas. Kapitel 4 untersucht die schottische Sprache des Gavin Douglas und die sprachliche Entwicklung des Schottischen im Mittelalter. Kapitel 5 analysiert die strukturellen Unterschiede zwischen Aeneis und Eneados. Kapitel 6 befasst sich mit den Übersetzungsstrategien des Gavin Douglas, indem es seine Prinzipien im Kontext der literaturhistorischen Entwicklung betrachtet. Kapitel 7 untersucht die konkrete Umsetzung von Douglas' Prinzipien in seiner Übersetzung. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Übersetzen, Übersetzungsstrategien, Literaturgeschichte, Schottland, die schottische Sprache, Gavin Douglas, Vergil, Aeneis, Eneados, klassische Antike, Mittelalter, Formale Aspekte, Sprachliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Gavin Douglas?
Gavin Douglas war ein schottischer Bischof und Dichter, der im frühen 16. Jahrhundert die erste vollständige Übersetzung der Aeneis in eine Volkssprache schuf.
In welche Sprache übersetzte Douglas die Aeneis?
Er übersetzte sie ins Mittelschottische (Scottis), wobei er den Begriff "Scottis" bewusst zur Abgrenzung vom Englischen nutzte.
Was ist das Prinzip "sensus ad sensum"?
Es bedeutet die sinngemäße Übersetzung statt einer rein wortwörtlichen Übertragung (verbum pro verbo), um die Botschaft des Originals zu bewahren.
Warum fügte Douglas dem Text Erweiterungen hinzu?
Er nutzte Erweiterungen für Kommentare, Sacherklärungen und zur Einhaltung des Metrums und Reims in seiner "Eneados".
Wie beeinflusste Douglas die schottische Sprache?
Durch seine Übersetzung bereicherte er das Schottische mit neuen Begriffen und literarischen Ausdrucksformen.
- Citar trabajo
- Martin Klinkhardt (Autor), 2003, Die mittelschottische Aeneis-Übersetzung des Gavin Douglas - Strategien der Übersetzung in der frühen Neuzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25503