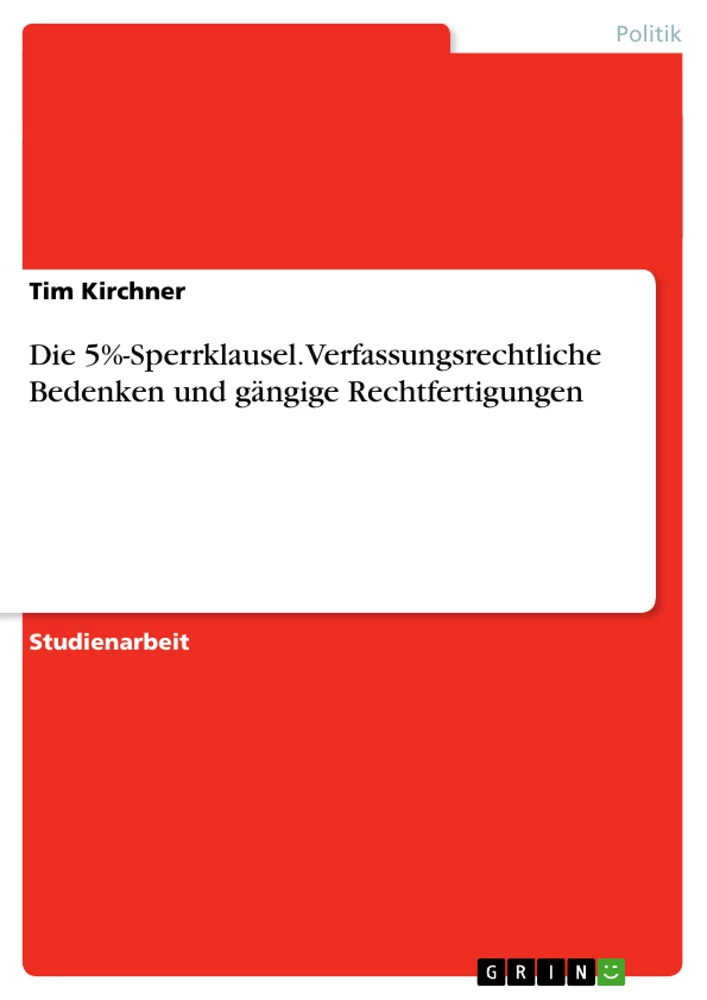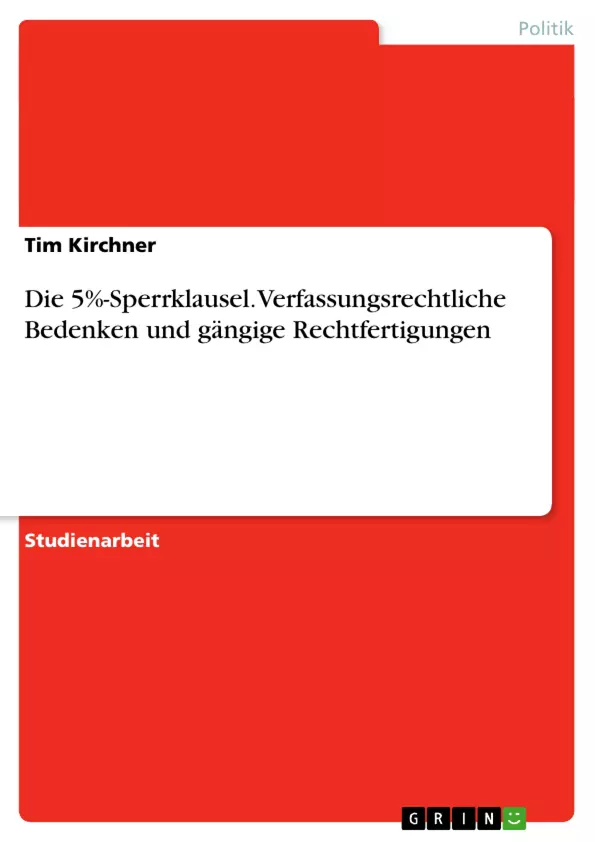[...]
Ausgangspunkt und somit der Beginn jedweder Diskussion um die 5%-
Sperrklausel ist die nichtvorhandene verfassungsrechtliche Ermächtigung, die
der Parlamentarische Rat2 1949 noch als notwendig erachtet hatte.3
Auch die Einführung des „gemeindeutschen Satzes“, welcher ein Quorum4 von
maximal 5% festlegte, konnte nicht dafür sorgen, dass die Sperrklausel als
fester Bestandteil des deutschen Wahlgesetzes in allen Bevölkerungskreisen
akzeptiert wurde.
Zur Rechtfertigung der Sperrklausel werden häufig die selben Argumente
vorgebracht. In jeder Konsolidierung des Urteils zur Rechtmäßigkeit der
Sperrklausel betonte das Bundesverfassungsgericht die Gefahr der
„Splitterparteien“. Sowohl die Verhältnisse zu Zeiten der Weimarer Republik als
auch die Garantie für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments werden oft als
Rechtfertigungsgründe für die Sperrklausel ins Feld geführt.
Diese und andere Gründe bedürfen einer genaueren Betrachtung ihrer
Argumentationsweise und es wird sich zeigen, dass die genannten
Begründungen zu einseitig und teilweise auch falsch sind.
Diese Arbeit wird einen kurzen Abriss über die „Entstehung“ der Sperrklausel im
deutschen Wahlrecht liefern und sich anschließend mit den in der heutigen Zeit
noch immer aktuellen kontroversen Meinungen und Fragen beschäftigen.
2 Der Parlamentarische Rat ist die „[...] zur Ausarbeitung des Grundgesetzes am 1.9.1948
zusammengekommene Versammlung, die aus 65 von den elf Landtagen der Westzonen
gewählten Abgeordneten bestand, zu denen fünf Vertreter Berlins mit beratender Stimme
hinzukamen. [...] Präsident des Parlamentarischen Rats war der spätere Bundeskanzler K.
Adenauer (CDU).“ Schmidt. Seite 692
3 Hierauf wird in Punkt 2 (Die 5%-Sperrklausel) noch näher eingegangen.
4 Quorum „(von lat. Quorum = derer, von denen), die satzungsrechtlich oder gesetzlich
vorgeschriebene Zahl anwesender stimmberechtigter Mitglieder oder abgegebener Stimmen,
die zur Beschlussfähigkeit einer Vereinigung [...] führen“ Schmidt. Seite 787.
Bezogen auf Wahlen bedeutet dies, dass nur Parteien am Verhältnisausgleich teilnehmen
können, die ein bestimmtes Quorum von vorher festgelegter Höhe erreicht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die 5%-Sperrklausel
- Die Konsolidierung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der 5%-Sperrklausel
- Argumente des Bundesverfassungsgerichts für die Verfassungsmäßigkeit der Sperrklausel
- Häufige Rechtfertigungsversuche für die Zulässigkeit der Sperrklausel
- Die Verhältnisse in der Weimarer Republik als gängige Rechtfertigung für die Sperrklausel
- Die Gefahr der „Splitterparteien“ als gängige Rechtfertigung für die Sperrklausel
- Die Arbeitsfähigkeit des Parlaments als Rechtfertigung für die 5%-Sperrklausel
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der kontroversen Frage der Verfassungsmäßigkeit der 5%-Sperrklausel im deutschen Wahlrecht. Sie analysiert die Argumente für und gegen die Sperrklausel, insbesondere die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, und hinterfragt die gängigen Rechtfertigungsversuche. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung der Sperrklausel in der Nachkriegszeit und untersucht die aktuellen Debatten zu diesem Thema.
- Die Rechtsgeschichte der 5%-Sperrklausel im deutschen Wahlrecht
- Die Argumente des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der Sperrklausel
- Häufige Rechtfertigungsversuche für die Sperrklausel
- Kritik an den Argumenten für die Sperrklausel
- Die aktuelle Debatte um die 5%-Sperrklausel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der 5%-Sperrklausel im deutschen Wahlrecht und skizziert die historische Entwicklung und die aktuelle Debatte zu diesem Thema.
- Die 5%-Sperrklausel: Dieses Kapitel erläutert die Entstehung der Sperrklausel im deutschen Wahlrecht, insbesondere den Herrenchiemseer Entwurf und die Rolle der Alliierten bei deren Einführung. Es beschreibt die verschiedenen Gesetzesänderungen und die damit verbundenen Kontroversen.
- Die Konsolidierung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der 5%-Sperrklausel: Hier werden die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der Sperrklausel zusammengefasst. Es werden die Argumente des Gerichts und deren Kritikpunkte erläutert.
- Häufige Rechtfertigungsversuche für die Zulässigkeit der Sperrklausel: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Argumente, die häufig zur Rechtfertigung der Sperrklausel vorgebracht werden, wie die Gefahr der „Splitterparteien“ oder die Notwendigkeit für ein stabiles und arbeitsfähiges Parlament.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem deutschen Wahlrecht, der 5%-Sperrklausel, dem Bundesverfassungsgericht, der Rechtsgeschichte, der Verfassungsmäßigkeit, der Verhältnisauswahl, den „Splitterparteien“, der Arbeitsfähigkeit des Parlaments und der Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Ursprung der 5%-Sperrklausel in Deutschland?
Die Sperrklausel entstand in der Nachkriegszeit, beeinflusst durch den Herrenchiemseer Entwurf und die Alliierten, um eine Zersplitterung des Parlaments wie in der Weimarer Republik zu verhindern.
Warum gibt es verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 5%-Hürde?
Kritiker bemängeln die fehlende explizite verfassungsrechtliche Ermächtigung im Grundgesetz und die potenzielle Verletzung der Wahlrechtsgleichheit durch den Ausschluss kleiner Parteien.
Wie rechtfertigt das Bundesverfassungsgericht die Sperrklausel?
Das Gericht betont die Notwendigkeit, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu sichern und eine instabile Regierungsbildung durch zu viele kleine Parteien zu vermeiden.
Was versteht man unter der Gefahr der "Splitterparteien"?
Damit ist die Befürchtung gemeint, dass ein Parlament mit vielen kleinen Fraktionen keine stabilen Mehrheiten finden kann, was zu politischer Handlungsunfähigkeit führen könnte.
Gilt die Sperrklausel für alle Wahlen in Deutschland?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Bundeswahlgesetz, thematisiert aber auch die Entwicklung des „gemeindeutschen Satzes“ als Standard für das Quorum.
- Arbeit zitieren
- Tim Kirchner (Autor:in), 2004, Die 5%-Sperrklausel. Verfassungsrechtliche Bedenken und gängige Rechtfertigungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25531