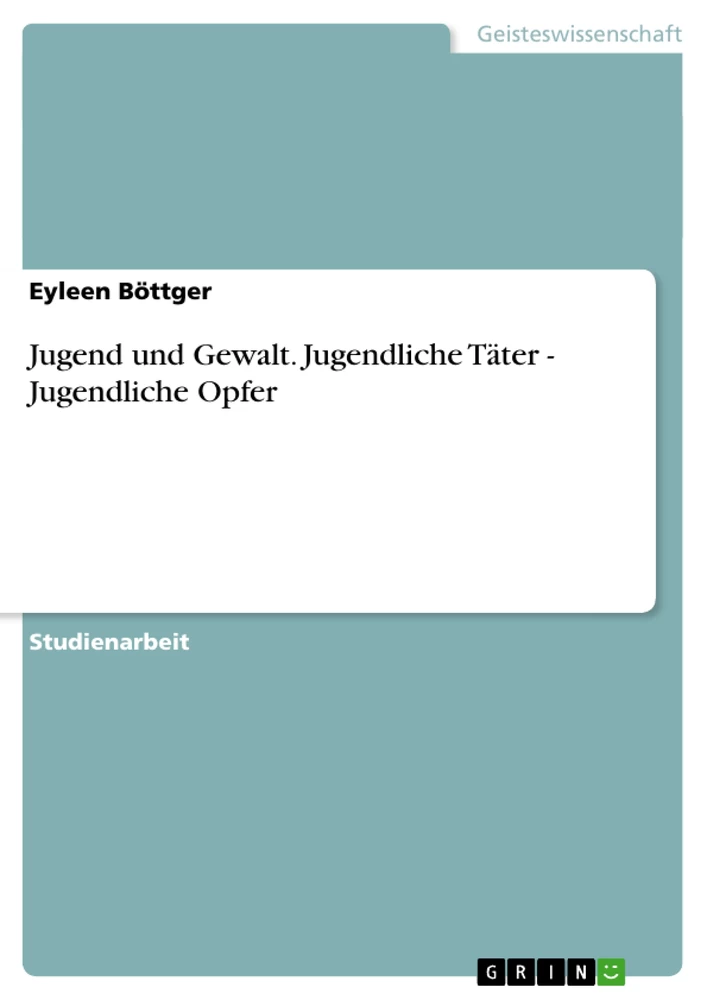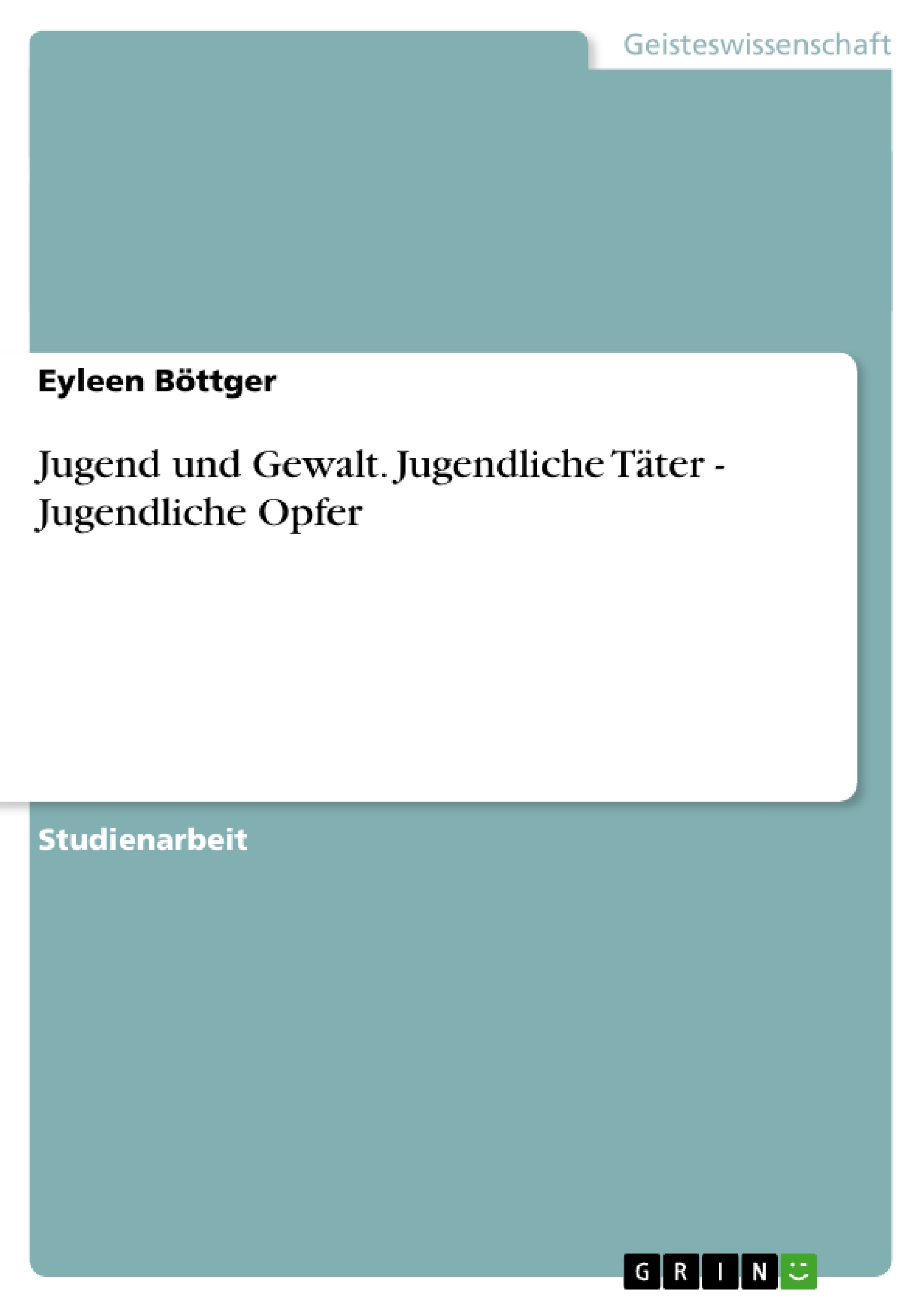Aus historischer und aktueller Sicht gesehen zeigt sich, daß vor allem männliche Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren gewaltförmiges Verhalten aufweisen. Mädchen dagegen befinden sich häufig eher unter den Opfern und nicht unter den Tätern. Diese Tatsache läßt sich dadurch erklären, daß die Jungen schon in den ersten Lebensjahren keine direkte Person (ihres Geschlechtes) zum Anlehnen haben, es sei denn, der Vater hat genauso viel Zeit, wie die Frau und kann somit die positiven männlichen Eigenschaften an den Jungen weitergeben. Dadurch herrscht meistens eine gewisse Beziehungslosigkeit der Jungen untereinander. Einen besten Freund, wie es bei den Mädchen die beste Freundin ist, gibt es nur zu selten. Für die Jungen zählen Macht, Dominanz und Positionskämpfe. Meist stammen die Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten, Armutsverhältnissen oder sind verwöhnte Muttersöhnchen mit materiell eingestellten Eltern, die ihre verlorengegangene Zeit z.B. durch den Beruf und die dadurch ausbleibende Zuwendung und Liebe für ihre Kinder mit Geschenken und Geld ersetzen. Fallstudien zeigen, „...daß Jugendliche aus diesen sozialen Zusammenhängen `Träger` von gewaltförmigen Verhaltensweisen sind, die als Ausdruck ihrer Alltagserfahrungen und von labilisierten Lebensverhältnissen, von strukturellen Gewalterfahrungen und Integrationsproblemen in die Gesellschaft (...) begriffen werden können“ (Hafeneger, 1994, S.11). In der modernen Industriegesellschaft ist der Übergang vom Kind zum Erwachsen schwieriger. Die gesellschaftlichen Institutionen, wie z.B. Familie, Beruf und Nachbarschaft bieten keine sozialen und biographischen Sicherheiten mehr. Die Aufgabe der Jugendphase ist es, neue Verhaltensweisen unter veränderten sozialstrukturierten Bedingungen zu suchen. Durch die Sozialstrukturierten Bedingungen werden Kinder und Jugendliche zu den Opfern. Sie erleben ständig Gewalt durch die Familie, Gewalt durch die Schule, Gewalt durch die Medien und Gewalt durch die Gesellschaft. Die Grenze zwischen Opfern und Tätern ist fließend. Gewalttätige Jugendliche empfinden ihr Verhalten als „normal“. Sie haben gelernt, daß in dieser Gesellschaft das Recht des Stärkeren zählt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Definition Gewalt
- 1.2 Definition Aggression
- 2. Erklärungsansätze zur Gewalt
- 2.1 soziale Lerntheorie
- 3. Ursachen und Bedingungsfaktoren für Gewalt
- 3.1 Familie
- 3.2 Persönlichkeit
- 3.3 Gleichaltrigengruppe
- 3.4 Schule
- 3.5 Medien
- 3.6 situative Einflüsse
- 3.7 gesellschaftliche Rahmenbedingung
- 4. Präventionen/ Interventionen
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik von Gewalt in Erziehungsinstitutionen, insbesondere im Kontext Jugendlicher als Opfer und Täter. Das Ziel ist es, verschiedene Erklärungsansätze für gewalttätiges Verhalten zu beleuchten und die Ursachen sowie Bedingungsfaktoren zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung von Gewalt und Aggression
- Soziologische und psychologische Erklärungsmodelle für Jugendgewalt
- Einflussfaktoren wie Familie, Peergroup und Gesellschaft
- Analyse der Rolle von Medien und situativen Einflüssen
- Präventive und interventive Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Gewalt bei Jugendlichen, insbesondere im Alter zwischen 12 und 20 Jahren, vor. Sie hebt den Unterschied zwischen männlichen Jugendlichen als Täter und weiblichen Jugendlichen als Opfer hervor und deutet auf soziale und familiäre Faktoren als mögliche Ursachen hin. Der Text verweist auf Studien, die den Zusammenhang zwischen Gewalt und schwierigen sozialen Verhältnissen aufzeigen und den Übergang vom Kind zum Erwachsenen in der modernen Gesellschaft als herausfordernd beschreiben.
1.1 Definition Gewalt: Dieses Kapitel definiert Gewalt als ein äußeres Verhalten, das Personen, Objekten oder Systemen psychischen, physischen oder sozialen Schaden zufügt. Gewalt wird als Teilmenge von Aggressionen beschrieben, die mit dem Ziel der Schädigung übereinstimmen. Es wird betont, dass Gewalt oft eine Reaktion auf erlittene Gewalt oder Unrecht ist und Dominanz, Überlegenheit und die Befriedigung von Bedürfnissen nach Körperlichkeit und Bewegung ausdrücken kann. Schließlich werden die wesentlichen Merkmale gewalttätigen Verhaltens zusammengefasst: schwere Schädigung mit erheblichen Konsequenzen, Verstoß gegen juristische Normen, instrumenteller Charakter und oftmals berechnende, kalte Ausführung.
1.2 Definition Aggression: Hier wird Aggression als ein meist affektbedingtes Angriffsverhalten oder eine feindselige Haltung definiert, die darauf abzielt, die eigene Macht zu steigern und die des Gegners zu mindern. Die Motive reichen von der Kontrolle über andere bis zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit und der Darstellung der eigenen Macht. Es wird unterschieden zwischen motorischer, verbaler, verhaltener und indirekter Aggression. Der Unterschied zu Gewalt wird in Bezug auf den Grad der Schädigung und den Charakter der Handlung (feindselig vs. instrumentell) hervorgehoben.
2. Erklärungsansätze zur Gewalt: Dieses Kapitel präsentiert das von Doise entwickelte und von Bierhoff/Wagner aufgegriffene System zur Erklärung aggressiven und gewalttätigen Verhaltens. Es unterscheidet zwischen intraindividuellen, interpersonalen, intergruppalen und ideologischen Erklärungsebenen. Intraindividuelle Erklärungen fokussieren auf intrapsychische Ursachen wie physiologische Erregung oder Ärger. Interpersonale Erklärungen betonen Missverständnisse und unterschiedliche Interpretationen von Handlungen. Intergruppale Erklärungen sehen Aggression im Kontext von Gruppenkonflikten, während ideologische Erklärungen den gesellschaftlichen Kontext und die vorherrschenden Ideologien als Einflussfaktoren hervorheben. Das Kapitel beleuchtet die Vielschichtigkeit der Ursachen von Gewalt und betont den Einfluss verschiedener Ebenen.
Schlüsselwörter
Jugendgewalt, Aggression, Gewaltprävention, soziale Lerntheorie, Erziehungsinstitutionen, Familie, Gleichaltrigengruppe, Medien, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewalt in Erziehungsinstitutionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Problematik von Gewalt in Erziehungsinstitutionen, insbesondere im Kontext Jugendlicher als Opfer und Täter. Sie analysiert verschiedene Erklärungsansätze für gewalttätiges Verhalten und die dazugehörigen Ursachen und Bedingungsfaktoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung von Gewalt und Aggression, soziologische und psychologische Erklärungsmodelle für Jugendgewalt, den Einfluss von Familie, Peergroup und Gesellschaft, die Rolle von Medien und situativen Einflüssen sowie präventive und interventive Maßnahmen.
Wie wird Gewalt definiert?
Gewalt wird als äußeres Verhalten definiert, das Personen, Objekten oder Systemen psychischen, physischen oder sozialen Schaden zufügt. Sie ist eine Teilmenge von Aggressionen mit dem Ziel der Schädigung. Gewalt kann eine Reaktion auf erlittene Gewalt sein und Dominanz, Überlegenheit und die Befriedigung von Bedürfnissen ausdrücken. Wesentliche Merkmale sind schwere Schädigung, Verstoß gegen juristische Normen, instrumenteller Charakter und oft berechnende Ausführung.
Wie wird Aggression definiert?
Aggression wird als meist affektbedingtes Angriffsverhalten oder feindselige Haltung definiert, die die eigene Macht steigern und die des Gegners mindern soll. Motive reichen von der Kontrolle über andere bis zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Es wird zwischen motorischer, verbaler, verhaltener und indirekter Aggression unterschieden. Der Unterschied zu Gewalt liegt im Grad der Schädigung und dem Charakter der Handlung (feindselig vs. instrumentell).
Welche Erklärungsansätze für Gewalt werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert ein System zur Erklärung aggressiven und gewalttätigen Verhaltens (Doise, Bierhoff/Wagner), das intraindividuelle (intrapsychische Ursachen), interpersonale (Missverständnisse), intergruppale (Gruppenkonflikte) und ideologische (gesellschaftlicher Kontext) Erklärungsebenen unterscheidet. Es wird die Vielschichtigkeit der Ursachen betont.
Welche Einflussfaktoren auf Gewalt werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf Gewalt, darunter Familie, Persönlichkeit, Gleichaltrigengruppe, Schule, Medien, situative Einflüsse und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss dieser Faktoren auf Jugendliche.
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden angesprochen?
Die Arbeit erwähnt präventive und interventive Maßnahmen, geht aber nicht im Detail darauf ein. Dies ist ein Bereich, der in weiterer Forschung vertieft werden könnte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Jugendgewalt, Aggression, Gewaltprävention, soziale Lerntheorie, Erziehungsinstitutionen, Familie, Gleichaltrigengruppe, Medien, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und soziale Ungleichheit.
- Citar trabajo
- Diplom-Pädagogin Eyleen Böttger (Autor), 1999, Jugend und Gewalt. Jugendliche Täter - Jugendliche Opfer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25689