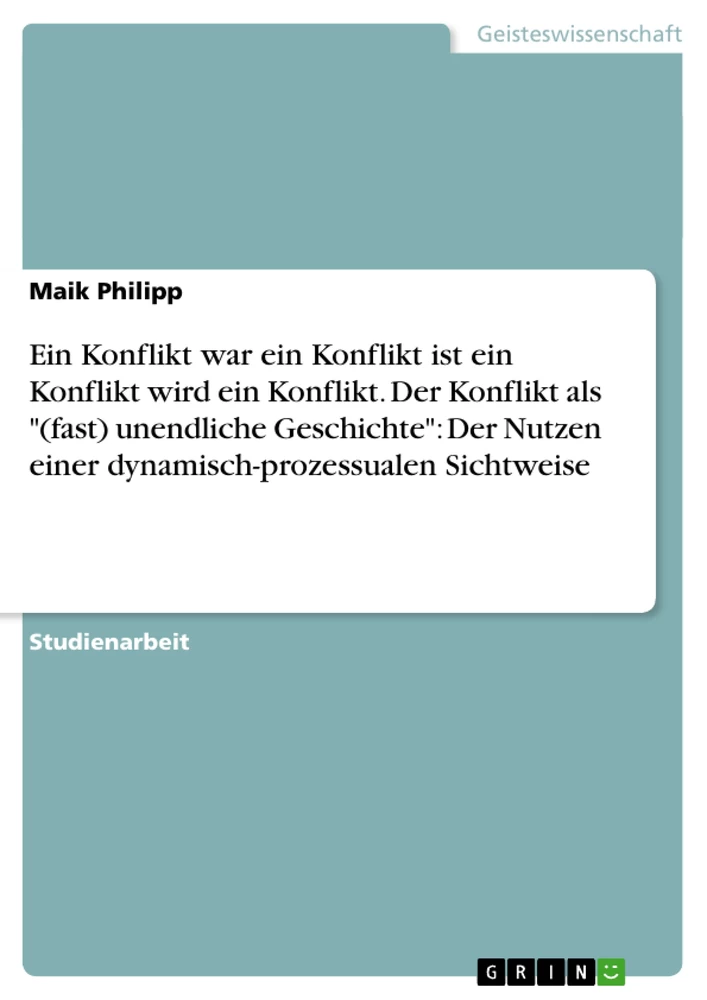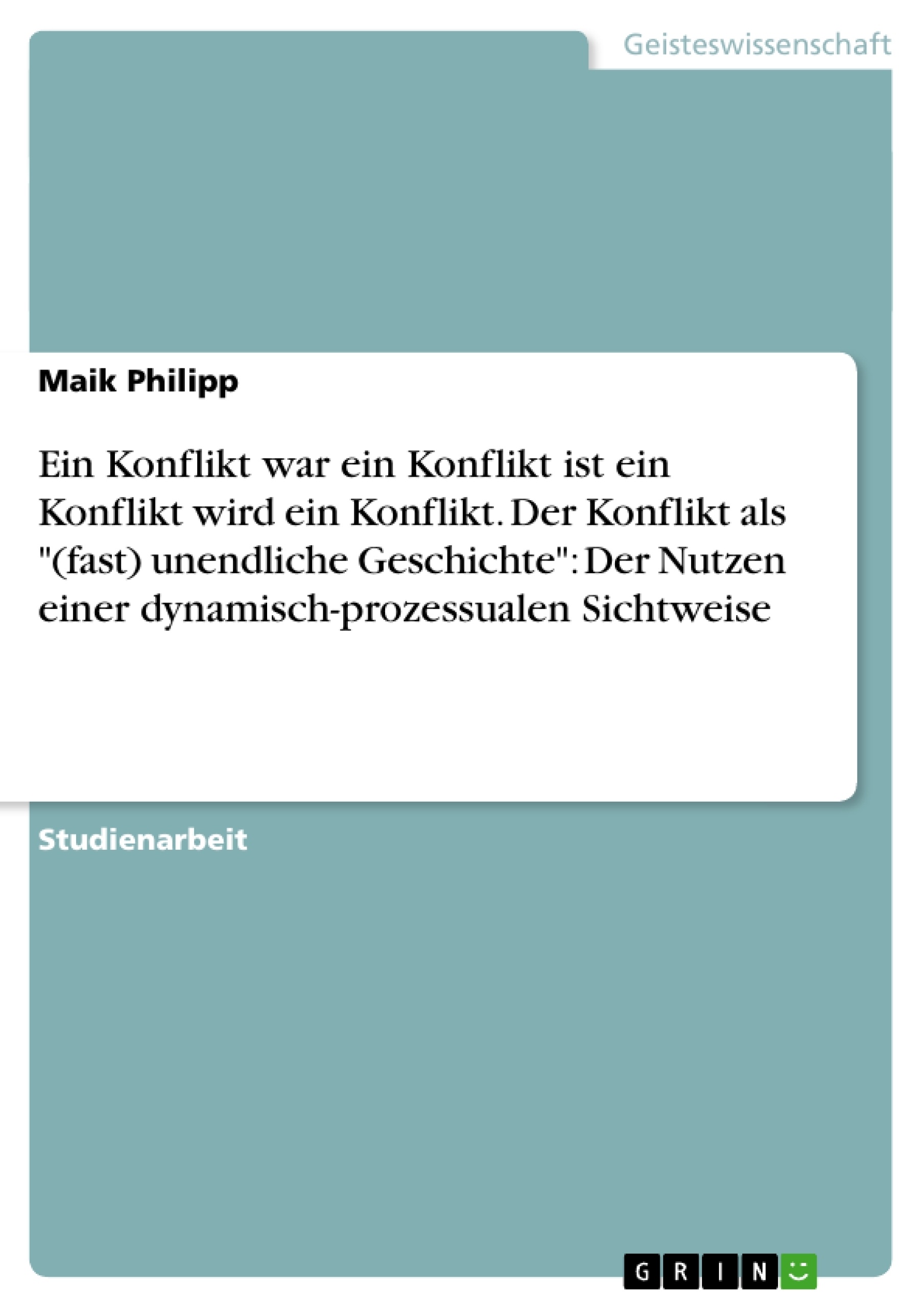In der berühmten und mit viel Ironie gespickten „Anleitung zum Unglücklichsein“ gibt der österreichische Psychotherapeut Paul Watzlawick seinen Lesern diverse Verhaltensanweisungen, wie sie ihr eigenes empfundenes und tatsächliches Unglück maximieren und mit ihrer Umwelt in stetem Clinch liegen können. Aus dem äußerst amüsant geschriebenen Werk ist ein Beispiel für das selbstgemachte Unglück sehr bekannt: die Geschichte mit dem Hammer.
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Er hat bereits einen Nagel; was ihm fehlt, ist der Hammer. Der Mann weiß, dass der Nachbar einen besitzt, und will ihn sich borgen. Plötzlich
„kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war seine Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s mir wirklich.“
Der Mann stürmt nun hinüber und klingelt, der Nachbar öffnet, „doch bevor er ‚Guten Tag‘ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: ‚Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!‘“ Man kann sich ausmalen, wie diese Geschichte weitergehen wird. Ein Nachbarschaftskrieg scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen.
Watzlawicks Geschichte, in der ein Hammer bzw. die Gedanken, die sich um den Nachbarn drehen, zu einem Konflikt führen dürften, soll als Illustration zu dieser Referatsausarbeitung dienen. Das Exempel bietet sich aus mehreren Gründen an: Es ist erstens evident, dass hier ein Eskalationsprozess stattgefunden hat, der maßgeblich den weiteren Verlauf des Konflikts determinieren wird. Zweitens liegt der Fokus auf den sich ändernden Perzeptionen des Mannes, der das Bild aufhängen will. Drittens verdeutlicht es, wie wenig es objektiver bzw. Sachprobleme bedarf, um einen Konflikt auszulösen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Annäherungsversuche an den Konfliktbegriff
- Konflikt eine unendliche Geschichte?
- ,,Die Hölle, das sind die anderen“: Was Konflikte in uns bewirken.
- Der Blick mit Scheuklappen: Reduzierte Perzeption.….….……………………..\n
- Abgeschnitten von der Außenwelt: Beeinträchtigungen im Gefühlsleben...........
- ,,Jetzt erst recht“: Das versteinernde Willensleben.........\n
- Verheerender Minimalismus: Veränderungen im Verhalten und dessen Effekte\n
- Drallkräfte der Zuspitzung: Glasls Basismechanismen der Eskalation..............
- Kampf gegen das Ich: Zunehmende Projektion bei wachsender Selbstfrustration\n
- Immer weniger Verständnis für immer mehr Disput: Ausweitung der\nStreitthemen bei zeitgleicher kognitiver Komplexitätsreduktion
- Vereinnahmung durch den Anderen: Wechselseitige Verflechtung von\nUrsachen und Wirkungen bei gleichzeitiger Simplifizierung der\nKausalitätsbeziehungen..........\n
- Ausweitung der Kampfzone: Expansion des sozialen Rahmens bei\ngleichzeitiger Tendenz zum Personifizieren\n
- Der Konflikt als Wettbewerb: Beschleunigung durch pessimistische Antizipation\n
- Von der kleinen Flamme zum Flächenbrand: Die Eskalationsstufen des Konflikts
- Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der dynamischen und prozessualen Natur von Konflikten. Sie untersucht die Auswirkungen von Konflikten auf Individuen und ihre Beziehungen und beleuchtet die Mechanismen der Eskalation.
- Der Konfliktbegriff und seine verschiedenen Perspektiven
- Die Auswirkungen von Konflikten auf Individuen und ihre Beziehungen
- Die Mechanismen der Eskalation und ihre Eskalationsstufen
- Die Bedeutung einer dynamisch-prozessualen Sichtweise auf Konflikte
- Die Möglichkeit zur Konfliktlösung und -bewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des Referats vor und führt den Leser in die Thematik der dynamisch-prozessualen Sichtweise auf Konflikte ein. Das erste Kapitel beleuchtet verschiedene Annäherungsversuche an den Konfliktbegriff und untersucht unterschiedliche Perspektiven auf Konflikte. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Konflikte als "unendliche Geschichten" betrachtet werden können. Im dritten Kapitel werden die Auswirkungen von Konflikten auf Individuen untersucht, wobei auf die Bereiche Perzeption, Gefühlsleben, Willensleben und Verhalten eingegangen wird. Das vierte Kapitel analysiert die Basismechanismen der Eskalation nach Glasl, die den Konflikt immer weiter zuspitzen. Das fünfte Kapitel untersucht die Eskalationsstufen des Konflikts und zeigt, wie Konflikte sich von kleinen Flammen zu Flächenbränden entwickeln können.
Schlüsselwörter
Konflikt, Eskalation, Konfliktlösung, Konfliktbewältigung, dynamisch-prozessuale Sichtweise, Perzeption, Gefühlsleben, Willensleben, Verhalten, Basismechanismen der Eskalation, Eskalationsstufen, "unendliche Geschichte", Reduzierte Perzeption, Beeinträchtigungen im Gefühlsleben, Versteinerndes Willensleben, Verheerender Minimalismus, Kampf gegen das Ich, Ausweitung der Streitthemen, Vereinnahmung durch den Anderen, Ausweitung der Kampfzone, Der Konflikt als Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Was illustriert die "Geschichte mit dem Hammer" von Paul Watzlawick?
Sie zeigt, wie interne Gedankenprozesse und falsche Annahmen über andere Menschen zu einem unnötigen Eskalationsprozess und einem handfesten Konflikt führen können.
Wie verändern Konflikte unsere Wahrnehmung?
Konflikte führen oft zu einer "reduzierten Perzeption" (Scheuklappenblick), bei der Informationen gefiltert werden und nur noch das Negative am Gegenüber wahrgenommen wird.
Was sind die Basismechanismen der Eskalation nach Glasl?
Dazu gehören zunehmende Projektion, kognitive Komplexitätsreduktion (Schwarz-Weiß-Denken), Ausweitung der Streitthemen und die Tendenz zur Personifizierung des Konflikts.
Warum wird ein Konflikt oft als "unendliche Geschichte" bezeichnet?
Wegen der wechselseitigen Verflechtung von Ursachen und Wirkungen, bei der jede Reaktion wiederum als neue Ursache für die nächste Eskalationsstufe dient.
Was versteht man unter "versteinerndem Willensleben" in einem Konflikt?
Es beschreibt die Haltung "Jetzt erst recht", bei der die Parteien starr an ihren Positionen festhalten, selbst wenn dies für beide Seiten schädlich ist.
- Arbeit zitieren
- Maik Philipp (Autor:in), 2004, Ein Konflikt war ein Konflikt ist ein Konflikt wird ein Konflikt. Der Konflikt als "(fast) unendliche Geschichte": Der Nutzen einer dynamisch-prozessualen Sichtweise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25709