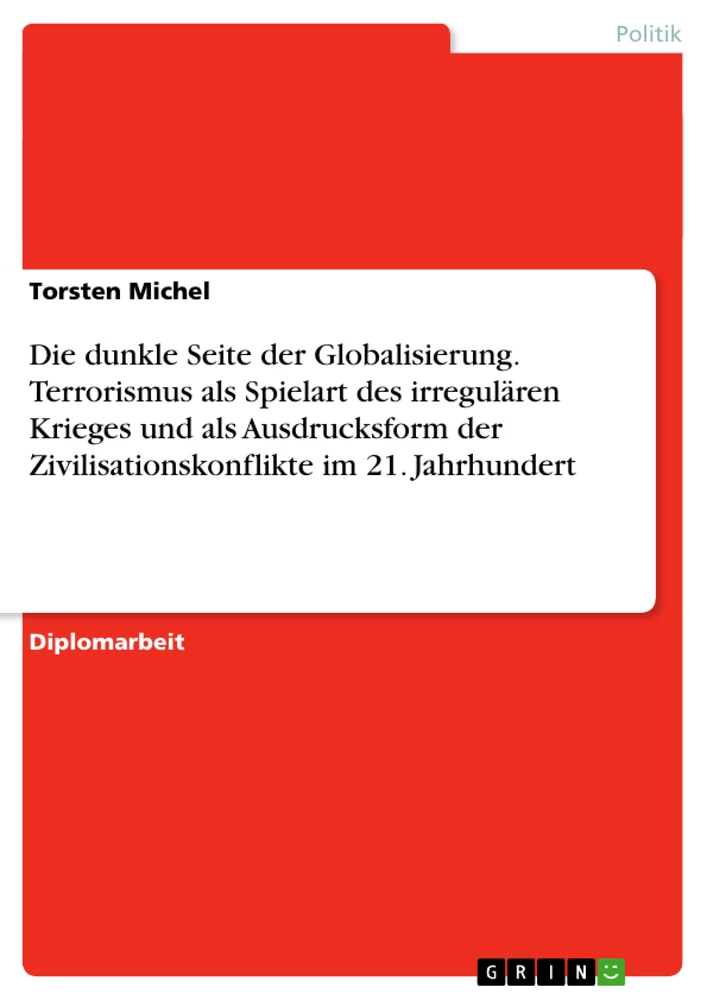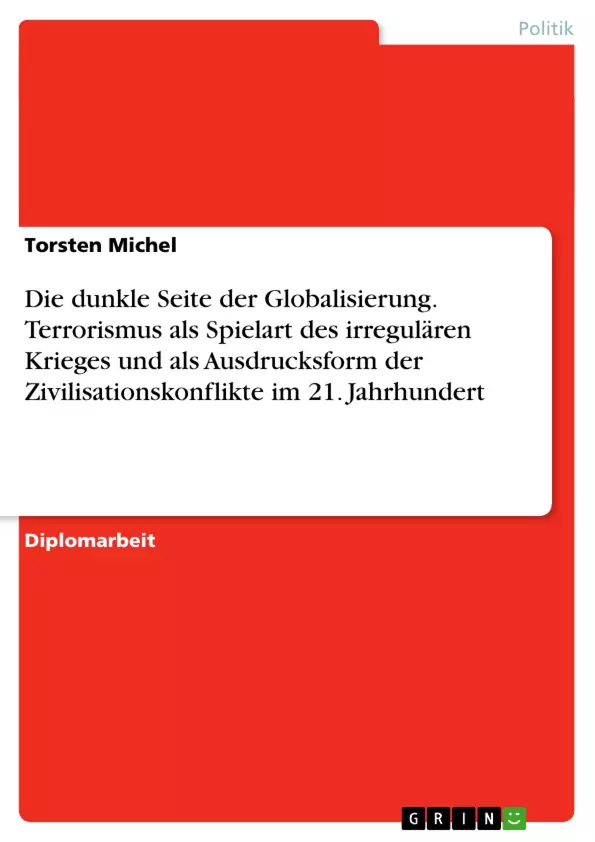Am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Menschheit mit zwei parallel zueinander ablaufenden Prozessen konfrontiert. Zum einen mit einer Entwicklung, die durch das schon inflationär verwendete Wort Globalisierung beschrieben wird. Technik, Wissenschaft, Wirtschaft und Telekommunikation vernetzen die einzelnen Kontinente der Erde immer mehr, und der Begriff vom 'global village' wird zunehmend Realität. Auf der anderen Seite sind die Linien in der Weltpolitik nach dem Ende der Bipolarität unklarer als je zuvor. Präsident George Bush sen. verkündete noch am Vorabend des zweiten Golfkrieges 1991, dass sich nun eine neuen Weltordnung konstituiere, an deren Ende ein geeintes, unipolares System unter Führung der einzig verbliebenen Weltmacht USA stehen sollte. FRANCIS FUKUYAMA sprach vom 'Ende der Geschichte' und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass nach dem Fall des Sowjetunion nun die für die Menschheitsgeschichte typischen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Machtblöcken an ihrem Ende angelangt seien und 'das Gute' schließlich triumphiert habe. Ebenso sprach HUNTINGTON nach dem Zusammen-bruch der Sowjetunion von einer 'dritten Welle' der Demokratisierung, in der die bisher kommunistischen Staaten und ihre Verbündeten nun auch zur Demokratie gelangen würden. All diese teilweise sehr euphorisch anmutenden Visionen und Einschätzungen erwiesen sich im Nachhinein als nicht zutreffend.
So war es auch SAMUEL HUNTINGTON, der 1993 gerade einmal zwei Jahre nach seinem eben angeführten Buch The Third Wave, den bis heute kontrovers diskutierten Artikel The Clash of Civilizations? in der Fachzeitschrift für Internationale Beziehungen Foreign Affairs veröffentlichte, dem 1996 das gleichnamige Buch folgte. Darin schätzt HUNTINGTON die kommende weltpolitische Situation durchaus kritisch ein, und entwickelt die These, dass nach dem Ende der Bipolarität und dem Zusammenbruch eines der beiden Blöcke nun andere Konfliktmuster auftauchen werden. Diese seien nicht mehr ideologisch begründet, sondern würden sich vielmehr an Religion und Ethnizität orientieren. Die Welt würde nicht als friedliche Einheit unter der Führung der USA fortbestehen, sondern es würden sich im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte Zivilisationen herausbilden, die größtenteils unterschiedliche Interessen verfolgen würden und somit die neuen Konfliktmuster in einer nun multipolaren Welt bestimmen sollten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE STRUKTUR DES POSTBIPOLAREN INTERNATIONALEN SYSTEMS
- Realistische Ansätze zur Struktur des Internationalen Systems
- The Clash of Civilizations – Samuel Huntingtons Theorie zur Struktur des Internationalen Systems nach dem Ende der Bipolarität
- Eine Neubewertung des realistischen Ansatzes unter Berücksichtigung der Thesen Huntingtons - Der Weg zu einem kulturellen Realismus
- DIE ENTWICKLUNG DES KRIEGES UND DIE ENTSTEHUNG NEUER KRIEGSFORMEN NACH DEM ENDE DER BIPOLARITÄT
- Die klassische Form des zwischenstaatlichen trinitarischen Krieges
- Neue Formen des Krieges – vom totalen Krieg zum 'Krieg der dritten Art'
- Terrorismus als eine Ausdrucksform des irregulären Krieges
- Die Genese des islamistischen Terrorismus – Islamischer Fundamentalismus als Urheber des islamistischen Terrorismus
- FALLSTUDIEN
- Al-Qaida - Die Basis
- Sudan – Das Scheitern eines nation-building Prozesses
- Afghanistan – Zwischen ethnischer Segmentierung und islamischem Fundamentalismus
- ANALYSE: DAS SICH IM UMBRUCH BEFINDENDE INTERNATIONALE SYSTEM UND DIE ROLLE UND POTENTIALE DES TERRORISMUS
- SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Terrorismus im Kontext der Globalisierung und dem Wandel des internationalen Systems nach dem Ende der Bipolarität. Sie analysiert den Terrorismus als eine neue Form des Krieges, die sich durch die zunehmende Bedeutung von nicht-staatlichen Akteuren und die Verlagerung von Konflikten auf eine transnationale Ebene auszeichnet.
- Die Rolle des Terrorismus im internationalen System im Kontext der Globalisierung
- Die Entstehung und Entwicklung neuer Kriegsformen, insbesondere des "Krieges der dritten Art", und der Zusammenhang mit Terrorismus
- Die Analyse der Rolle von Zivilisationskonflikten im internationalen System und deren Einfluss auf den Terrorismus
- Die Untersuchung des islamistischen Terrorismus und seiner Wurzeln im islamischen Fundamentalismus
- Die Fallbeispiele Sudan und Afghanistan, die die Komplexität von Ethnizität, Religion und Identität im Kontext von Terrorismus und irregulären Kriegen veranschaulichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des postbipolaren internationalen Systems. Sie untersucht verschiedene Ansätze zur Beschreibung der internationalen Ordnung, insbesondere die realistische Theorie und die These des "Clash of Civilizations" von Samuel Huntington. Anschließend wird die Entwicklung des Krieges und die Entstehung neuer Kriegsformen nach dem Ende der Bipolarität behandelt, wobei der Fokus auf den Terrorismus als Ausdrucksform des irregulären Krieges liegt. Die Arbeit untersucht die Genese des islamistischen Terrorismus und seine Beziehung zum islamischen Fundamentalismus. Im Anschluss daran werden zwei Fallstudien vorgestellt: Sudan und Afghanistan. Beide Beispiele demonstrieren die Komplexität von Ethnizität, Religion und Identität im Kontext von Terrorismus und irregulären Kriegen. Abschließend analysiert die Arbeit die Rolle und die Potentiale des Terrorismus im sich im Umbruch befindenden internationalen System.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Globalisierung, Terrorismus, irregulärer Krieg, "Krieg der dritten Art", Zivilisationskonflikt, islamischer Fundamentalismus, islamistischer Terrorismus, Ethnizität, Religion, Identität, nation-building, Sudan, Afghanistan.
Häufig gestellte Fragen zu Globalisierung und Terrorismus
Was ist die zentrale These von Samuel Huntington?
Huntington entwickelte die These vom „Clash of Civilizations“, wonach Konflikte nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr ideologisch, sondern entlang kultureller, religiöser und ethnischer Linien verlaufen.
Was bedeutet der Begriff „Global Village“?
Der Begriff beschreibt die zunehmende Vernetzung der Kontinente durch Technik, Wissenschaft, Wirtschaft und Telekommunikation, wodurch die Welt wie ein einziges Dorf zusammenrückt.
Wie wird Terrorismus in dieser Arbeit definiert?
Terrorismus wird als eine Ausdrucksform des irregulären Krieges und als „Krieg der dritten Art“ analysiert, der oft durch nicht-staatliche Akteure auf transnationaler Ebene geführt wird.
Welche Rolle spielt der islamistische Terrorismus?
Die Arbeit untersucht die Genese des islamistischen Terrorismus und sieht dessen Wurzeln im islamischen Fundamentalismus sowie in kulturellen Identitätskonflikten.
Welche Fallstudien werden zur Analyse herangezogen?
Es werden die Beispiele Al-Qaida, Sudan (gescheitertes Nation-Building) und Afghanistan (ethnische Segmentierung) untersucht, um die Komplexität moderner Konflikte zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Torsten Michel (Author), 2002, Die dunkle Seite der Globalisierung. Terrorismus als Spielart des irregulären Krieges und als Ausdrucksform der Zivilisationskonflikte im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25717