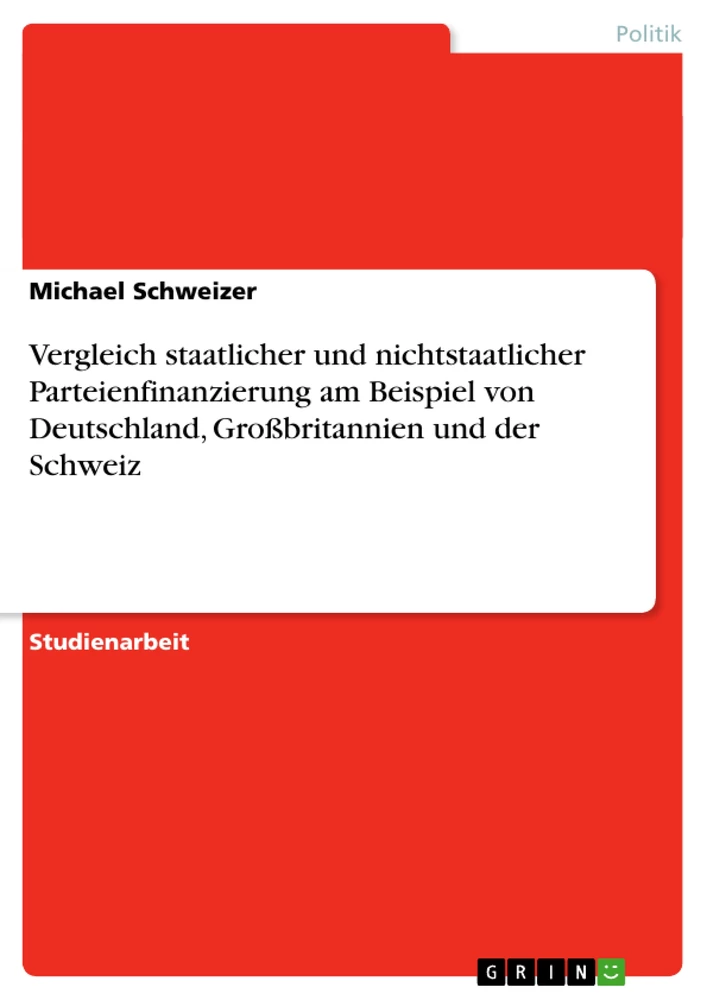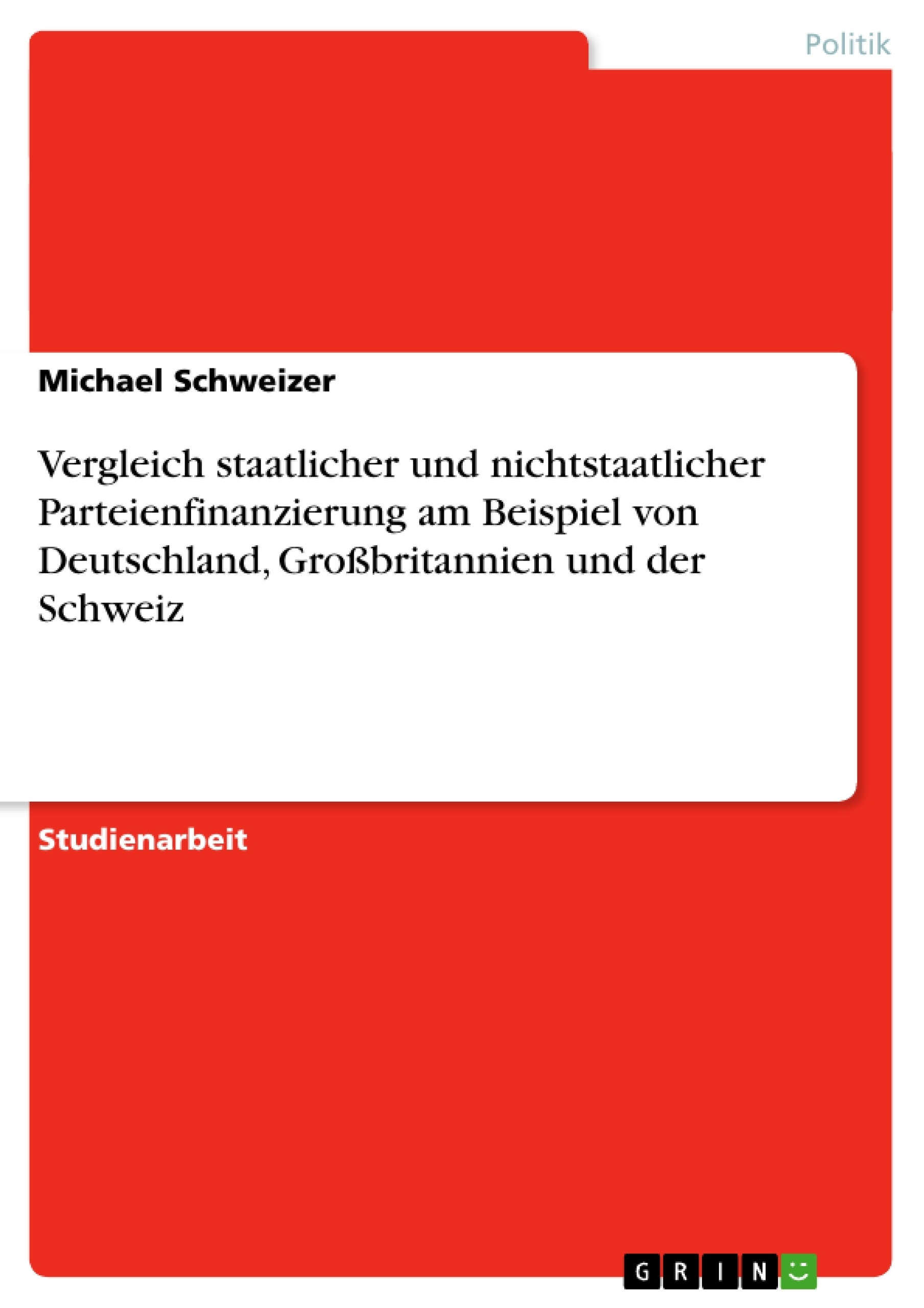Deutschland wird oft als Parteienstaat bezeichnet. Die staatliche Unterstützung der Parteien ist dessen Basis. Diese Form der Finanzierung steht im starken Kontrast zu der staatsfreien Parteienfinanzierung in zahlreichen europäischen Ländern.
Die Aufwendungen der Steuerzahler für die deutschen Parteien haben einstweilen einen Umfang von mehreren hundert Millionen Euro errreicht. Anerkannt ist dabei, dass der Parteienwettbewerb zu den selbstverständlichen Merkmalen moderner Demokratien gehört. Es stellt sich aber die Fage, welche Kosten für den Parteienwettbewerb gerechtfertigt sind. Anhand des Vergleiches Deutschlands mit Großbritannien und der Schweiz sollen in dieser Arbeit die Vorteile und Nachteile staatlicher und nichtstaatlicher Parteienfinanzierung herausgearbeitet werden und eine Aussage zur Frage nach der Rechtfertigung der Finanzierung der Parteien durch den Steuerzahler gegeben werden.
Im ersten Schritt erfolgt eine Einführung in die Begrifflichkeiten. Im Anschluss werden die Parteiensysteme der drei Vergleichsländer vorgestellt. Auf diesen schließt sich der eigentliche Vergleich an, auf welchem der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt. Den Abschluss bildet die Auswertung der Ergebnisse nach Kriterien und die sich hieraus ergebenden Antworten auf die Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Parteienfinanzierung
- Der Begriff
- Historische Einordnung
- Traditionen
- Konfliktlinien
- Rechtliche Regelungen
- Deutschland
- Großbritannien
- Schweiz
- Vergleichende Analyse
- Kosten der politischen Systeme
- Legitimität
- Chancengleichheit
- Korruptionsneigung
- Schlussbetrachtung
- Fazit
- Lösungsvorschläge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Finanzierung von Parteien in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der staatlichen und nichtstaatlichen Finanzierungsmodelle und der damit verbundenen Vor- und Nachteile. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Definition des Begriffs "Parteienfinanzierung" und untersucht die historischen Entwicklungen der Finanzierungssysteme in den drei Ländern. Darüber hinaus werden die rechtlichen Regelungen zur Parteienfinanzierung in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz vorgestellt und analysiert.
- Definition und Systematisierung des Begriffs "Parteienfinanzierung"
- Historische Entwicklung der Parteienfinanzierung in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Regelungen zur Parteienfinanzierung in den drei Ländern
- Vergleich der staatlichen und nichtstaatlichen Finanzierungsmodelle in Bezug auf Kosten, Legitimität, Chancengleichheit und Korruptionsneigung
- Bewertung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Themenfeld der Parteienfinanzierung. Es umfasst die Definition des Begriffs, eine kurze historische Einordnung, die Darstellung der europäischen Traditionen und das Aufzeigen von Konfliktlinien. Im zweiten Kapitel werden die Parteiensysteme der drei Vergleichsländer vorgestellt. Das dritte Kapitel enthält die rechtlichen Regelungen zur Parteienfinanzierung in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz. Das vierte Kapitel bietet eine vergleichende Analyse der drei Systeme, wobei die Kosten der politischen Systeme, die Legitimität, die Chancengleichheit und die Korruptionsneigung betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Parteienfinanzierung, staatliche Finanzierung, nichtstaatliche Finanzierung, Parteienwettbewerb, Legitimität, Chancengleichheit, Korruption, Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Parteienfinanzierungen in DE, GB und CH?
Die Arbeit vergleicht die stark staatlich geprägte Finanzierung in Deutschland mit den eher privat oder traditionell orientierten Modellen in Großbritannien und der Schweiz.
Was sind die Vorteile staatlicher Parteienfinanzierung?
Staatliche Mittel können die Unabhängigkeit von privaten Großspendern fördern und für mehr Chancengleichheit im politischen Wettbewerb sorgen.
Erhöht private Finanzierung das Korruptionsrisiko?
Die Analyse untersucht die Korruptionsneigung in Systemen, die stark auf nichtstaatliche Spenden angewiesen sind, und beleuchtet die notwendigen Transparenzregeln.
Was bedeutet „Legitimität“ im Kontext der Parteienfinanzierung?
Es geht um die Frage, ob die Bürger die Art der Finanzierung (z. B. durch Steuergelder) als gerechtfertigt und demokratisch sinnvoll ansehen.
Welche Lösungsvorschläge bietet die Arbeit für Finanzierungsprobleme?
In der Schlussbetrachtung werden Reformansätze diskutiert, um Kosten zu begrenzen und die Transparenz in allen drei untersuchten Ländern zu erhöhen.
- Citation du texte
- Michael Schweizer (Auteur), 2004, Vergleich staatlicher und nichtstaatlicher Parteienfinanzierung am Beispiel von Deutschland, Großbritannien und der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25770