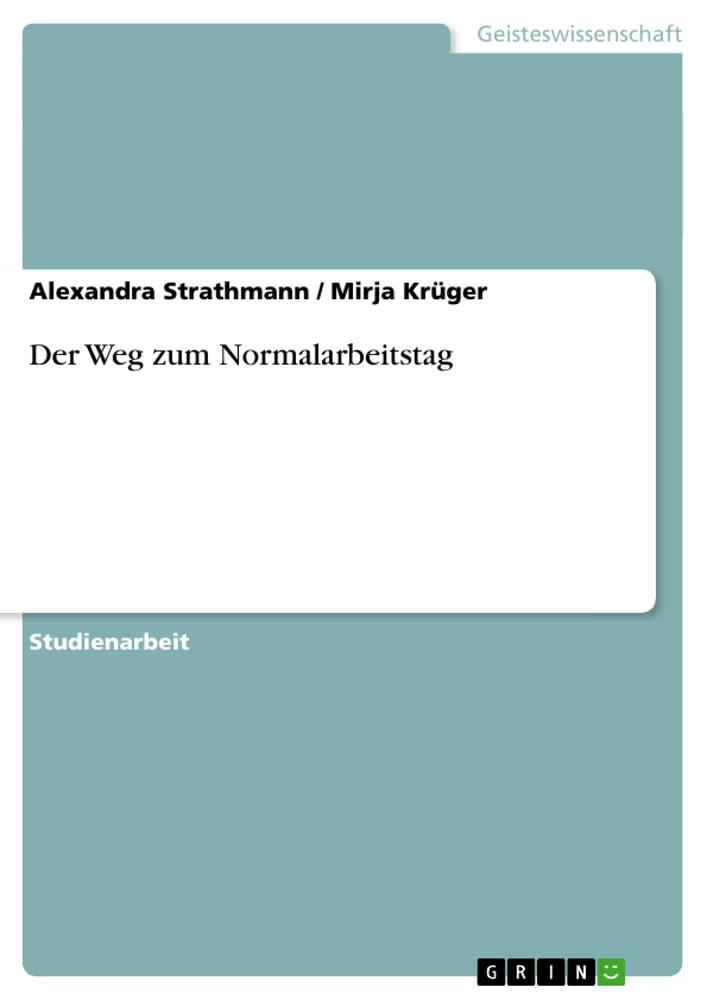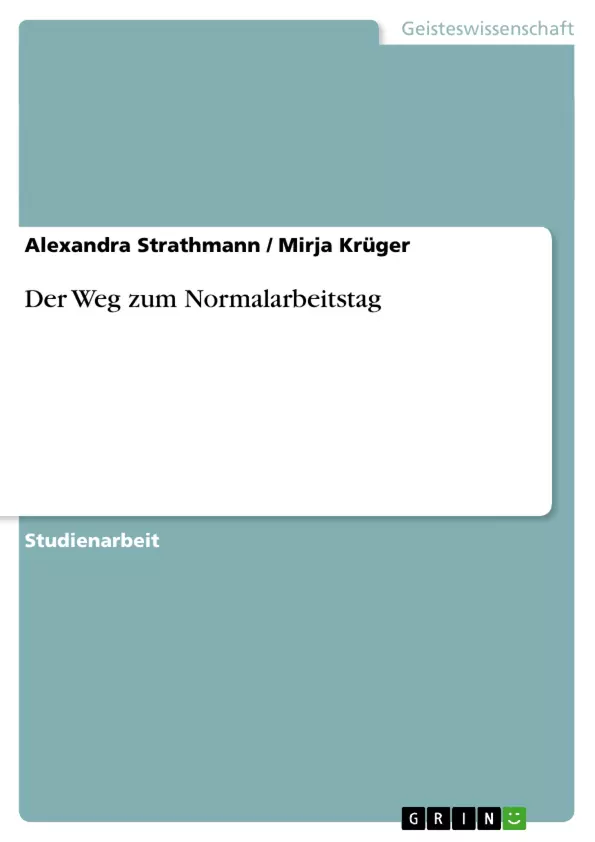Thema dieser Hausarbeit ist die Entwicklung des Normalarbeitstages in Deutschland. Unter einem „Normalarbeitstag“ verstehen wir heute in Deutschland eine Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Werktag, das heißt von Montag bis einschließlich Freitag. Eine andere Verteilung der Wochenarbeitszeit ist dabei zulässig, solange eine Arbeitszeit von zehn Stunden täglich nicht überschritten wird (vgl. GLAUBRECHT 1984, 63-64). Bis zu dieser heutigen Regelung war es allerdings ein langer Weg, in dessen Verlauf die Arbeitszeiten erst ins Unermessliche gesteigert wurden, um dann Schritt für Schritt auf den jetzigen Stand gebracht zu werden. Dieser Prozess, der mit der Industrialisierung um 1850 begann und mit der gesetzlichen Vorschreibung des Normalarbeitstages 1918 endete, soll nachgezeichnet werden. Dabei ist zu beachten, dass sich während des gesamten Prozesses die ursprüngliche Betriebszeit immer stärker in Arbeitszeit und Freizeit aufgespalten wurde. Während es in der Phase der Frühindustrialisierung noch so war, dass in den langen Betriebszeiten sowohl Arbeit als auch Freizeit stattfand, wurden die Betriebszeiten im Laufe der industriellen Phase mehr und mehr komprimiert, sodass Arbeitszeit und Freizeit schließlich zeitlich und räumlich getrennt waren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Veränderung der Betriebszeiten in Stunden, sondern auch die Veränderung in der Wahrnehmung von Zeit von etwas Organischem bis hin zur reflektierbaren Zeit, die das Individuum selbst füllen und gestalten kann. In der vorliegenden Arbeit orientieren wir uns vor allem an der Studie zur Entwicklung des Normalarbeitstages, die 1985 von Christoph Deutschmann veröffentlicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Studie von Christoph Deutschmann
- 2. Die organische Zeitstruktur der Arbeit
- 3. Das frühindustrielle Zeitarrangement
- 3.1 Datierung
- 3.2 Begriffsinhalte
- 3.3 Betriebszeit und alltägliches Arbeitszeitverhalten
- 3.3.1 Der „blaue Montag“
- 3.3.2 Alkohol
- 3.3.3 Unpünktlichkeit
- 3.4 Arbeitszeit im Bereich der Frauenarbeit
- 3.5 Betriebszeit und Erwerbsleben
- 3.5.1 Unternehmenspolitik
- 3.5.2 Erwerbsorientierung der Arbeiter
- 3.6 Das frühindustrielle Zeitarrangement: Fazit
- 4. Das industrielle Zeitarrangement
- 4.1 Der Begriff des industriellen Zeitarrangements
- 4.2 Arbeitszeit und Arbeitsintensität
- 4.3 Zwei Bewegungen zur Arbeitszeitverkürzung
- 4.3.1 Streik
- 4.3.2 Unternehmerseite
- 4.4 Veränderungen des alltäglichen Arbeitsverhaltens
- 4.5 Veränderung der betrieblichen Personalpolitik und der Erwerbsorientierung der Arbeiter
- 4.5.1 Ausbildungspolitik
- 4.5.2 Sozialpolitik
- 4.6 Institutionalisierung von Arbeitszeitregelung
- 4.7 Das industrielle Zeitarrangement: Fazit
- 5. Schlussbemerkung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Normalarbeitstages in Deutschland von 1850 bis 1918 zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Veränderungen in der Arbeitszeit und deren Einfluss auf das Zeitempfinden der Arbeiter. Sie untersucht die verschiedenen Phasen der Einführung des Normalarbeitstages und die damit verbundenen gesellschaftlichen Prozesse.
- Die Entstehung des Normalarbeitstages im Kontext der Industrialisierung
- Die Entwicklung des Zeitempfindens im Wandel von der organischen Zeitstruktur zur reflektierten Zeit
- Die Rolle von Streik und Unternehmerpolitik bei der Arbeitszeitverkürzung
- Die Institutionalisierung von Arbeitszeitregelungen
- Die Auswirkungen des Normalarbeitstages auf die Erwerbsorientierung der Arbeiter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und der Vorstellung der Studie von Christoph Deutschmann, die als Grundlage für die Arbeit dient. Anschließend wird die organische Zeitstruktur der Arbeit vor dem Beginn der Industrialisierung erläutert. Das Kapitel 3 behandelt das frühindustrielle Zeitarrangement von ca. 1850 bis 1891, wobei die Veränderung der Betriebszeiten, das alltägliche Arbeitszeitverhalten und die Entwicklung der Frauenarbeit im Vordergrund stehen. Das Kapitel 4 setzt sich mit dem industriellen Zeitarrangement von 1891 bis 1918 auseinander und analysiert die Entwicklung der Arbeitszeit und Arbeitsintensität, die verschiedenen Bewegungen zur Arbeitszeitverkürzung, sowie die Veränderungen in der betrieblichen Personalpolitik und der Erwerbsorientierung der Arbeiter.
Schlüsselwörter
Normalarbeitstag, Arbeitszeit, Industrialisierung, Zeitempfinden, frühindustrielles Zeitarrangement, industrielles Zeitarrangement, Streik, Unternehmerpolitik, Erwerbsorientierung, Betriebszeit, Freizeit, Frauenarbeit, Institutionalisierung, Arbeitszeitverkürzung, Christoph Deutschmann.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Normalarbeitstag“ in Deutschland?
Heute bezeichnet dies eine Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Werktag, eine Regelung, die historisch erst 1918 gesetzlich festgeschrieben wurde.
Wann begann die Entwicklung hin zum Normalarbeitstag?
Der Prozess begann mit der Industrialisierung um 1850, als Arbeitszeiten zunächst massiv gesteigert wurden, bevor Regulierungen griffen.
Was war der „blaue Montag“?
Im frühindustriellen Zeitarrangement war es üblich, dass Arbeiter montags der Arbeit fernblieben, was Ausdruck einer noch nicht vollständig disziplinierten Zeitstruktur war.
Wie veränderte sich die Wahrnehmung von Zeit?
Zeit wandelte sich von einer „organischen“ Struktur hin zu einer reflektierbaren, komprimierten Zeit, die strikt in Arbeitszeit und Freizeit getrennt wurde.
Welche Rolle spielten Streiks bei der Arbeitszeitverkürzung?
Streiks waren eine der zwei wesentlichen Bewegungen zur Arbeitszeitverkürzung, neben einer veränderten Personalpolitik auf Unternehmerseite.
Welche Studie dient als Grundlage für diese Arbeit?
Die Arbeit orientiert sich maßgeblich an der 1985 veröffentlichten Studie von Christoph Deutschmann zur Entwicklung des Normalarbeitstages.
- Citar trabajo
- Alexandra Strathmann (Autor), Mirja Krüger (Autor), 2004, Der Weg zum Normalarbeitstag, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25801