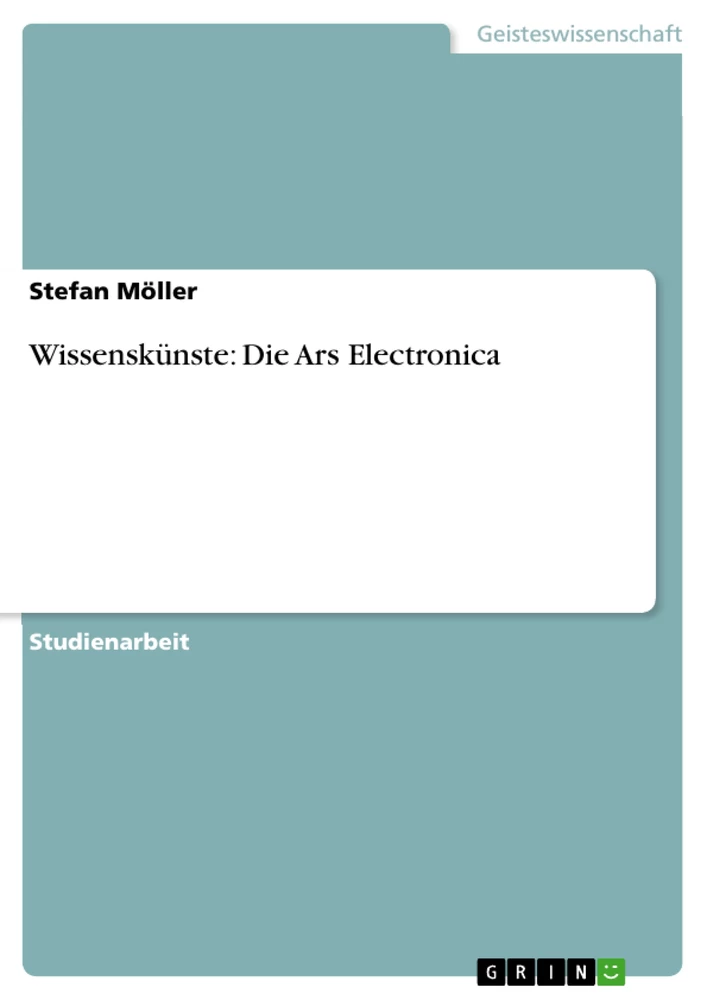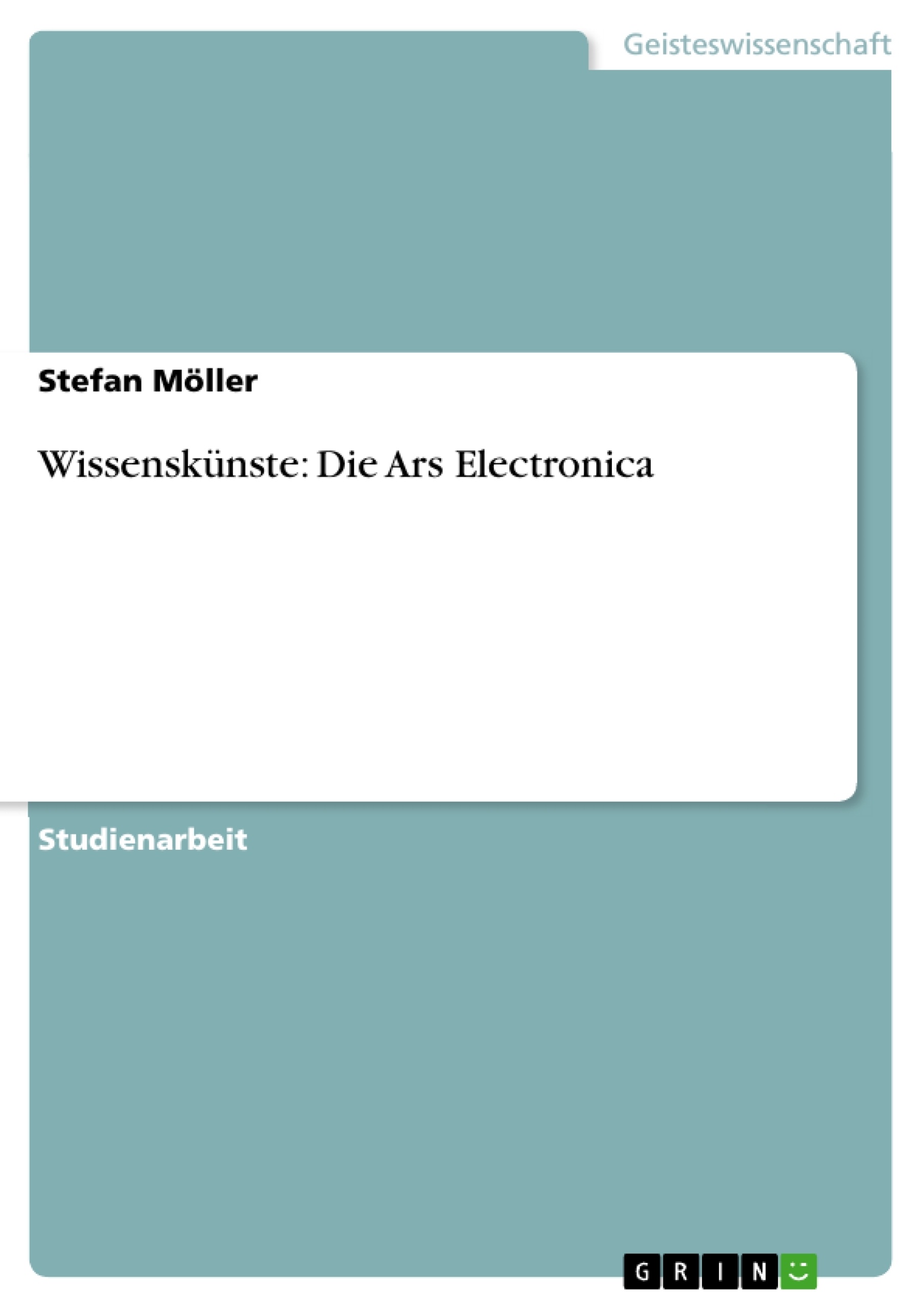Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst
„Warum eigentlich sind die Hunde noch immer nicht blau mit roten Flecken? Und warum eigentlich leuchten die Hasen noch immer nicht wie Irrlichter in den nächtlichen Gefilden? [...] Warum eigentlich betreiben wir Viehzucht noch immer mit wirtschaftlichen Absichten und noch immer nicht mit künstlerischen? Flussers Aufsatz aus dem Jahr 1988 beginnt mit dieser (provokanten) Fragestellung. Als Kontext der Fragestellung steht die Tatsache, dass einerseits die tierische Produktion in der westlichen Welt größer als der Verbrauch ist, andererseits die Techniken, die es ermöglichen können, künstliche Tierarten herzustellen. Durch die technisch und kulturell bedingte Veränderung der uns umgebenden Natur hat der Mensch künstliche Lebensumwelten geschaffen. Perspektivisch sieht Flusser den Menschen in einem „Disneyland, in welchem dank Automatisation arbeitslos gewordene Menschenmassen aufeinander stoßen.“ Der künftige Disney wird, u.a. Molekularbiologe sein.
Tierische Organismen scheiden Farbstoffe aus, die eine wichtige Lebensfunktion haben, sie dienen dem Überleben des Individuums in Form von Tarnfarbe oder dem Überleben einer Art in Form von Lockfärbung. Die Genetik kann in diesen Prozess schöpferisch eingreifen. Für Flusser wandelt sich das Ausscheiden von Farbstoffen bei tierischen Organismen zu einer wichtigen, ästhetischen, Funktion für das Überleben des Menschen. „Das Disneyland wird von bunten Tieren wimmeln, damit die Menschen darin nicht vor Langeweile sterben.“ Zu einem relativ frühen Zeitpunkt gibt dieser Aufsatz Einblick in die Perspektiven, Möglichkeiten und auch Gefahren, die der Umgang mit den technischen Möglichkeiten der Genetik und der Biotechnologie bietet. Neben der Gentechnik sind auch die Forschungen zu künstlicher Intelligenz vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Beide werden das Leben in der (nicht allzu fernen) Zukunft nachhaltig beeinflussen. Die Ars Electronica hat, vor allem seit Beginn der 90er Jahre, diese Themen als Schwerpunkte der Ausstellungen und Symposien gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft
- Die Veränderung des Bildes vom Menschen
- Künstliches Leben
- Begriff Lebewesen
- Künstliches Lebewesen
- Das Gen als kulturelles Ikon
- Projekt „Green“
- Transgene Kunst - Eduardo Kac
- SymbioticA – Forschungslabor für Kunst und Wissenschaft
- Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence)
- Natürliche neuronale Netzwerke
- Intelligenzbegriff
- Geschichte der „Artificial Intelligence“
- Entwicklungslinien
- Voraussetzungen für die Verbindung Al und Kunst
- Kunst und Al
- Poly World
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beleuchtet die Verbindung von Kunst und Wissenschaft im Kontext der Ars Electronica und untersucht insbesondere die Auswirkungen von Gentechnik und künstlicher Intelligenz auf das menschliche Leben.
- Die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft als Kennzeichen der Ars Electronica
- Die Veränderung des menschlichen Bildes durch technologische Entwicklungen
- Die ethischen Implikationen von künstlichem Leben und Gentechnik
- Die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Kunst
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Verbindung von Kunst und Technologie ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft am Beispiel der Ars Electronica und beleuchtet die Entwicklung dieses Phänomens. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Veränderung des menschlichen Bildes im Kontext von Gentechnik und künstlicher Intelligenz. Das dritte Kapitel widmet sich dem Thema „Künstliches Leben“ und analysiert die historischen Versuche, künstliches Leben zu erschaffen, sowie die aktuellen Entwicklungen in der Biotechnologie.
Schlüsselwörter
Ars Electronica, Wissenskünste, Kunst und Wissenschaft, Gentechnik, Biotechnologie, Künstliches Leben, Künstliche Intelligenz, Transgene Kunst, SymbioticA, Al, Poly World.
Häufig gestellte Fragen
Wie verschmelzen Kunst und Wissenschaft bei der Ars Electronica?
Die Ars Electronica nutzt Ausstellungen und Symposien, um technologische Entwicklungen wie Gentechnik und KI künstlerisch zu reflektieren und deren gesellschaftliche Auswirkungen zu thematisieren.
Was versteht man unter transgener Kunst?
Transgene Kunst, wie sie etwa Eduardo Kac vertritt, nutzt gentechnische Verfahren, um neue Lebensformen als künstlerisches Ausdrucksmittel zu schaffen.
Welche ethischen Fragen wirft künstliches Leben auf?
Die Arbeit diskutiert die Gefahren und Perspektiven im Umgang mit Biotechnologie und die Frage, wie sich unser Bild vom Menschen durch diese Techniken verändert.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Kunst?
KI wird als Werkzeug und Thema untersucht, wobei neuronale Netzwerke und die Geschichte der Artificial Intelligence die Grundlage für neue künstlerische Ausdrucksformen bilden.
Was ist das Projekt "Green"?
Es ist ein Beispiel für die Verbindung von Biotechnologie und Kunst, das im Kontext von künstlichen Lebenswelten und deren ästhetischer Funktion betrachtet wird.
- Quote paper
- Stefan Möller (Author), 2004, Wissenskünste: Die Ars Electronica, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25802