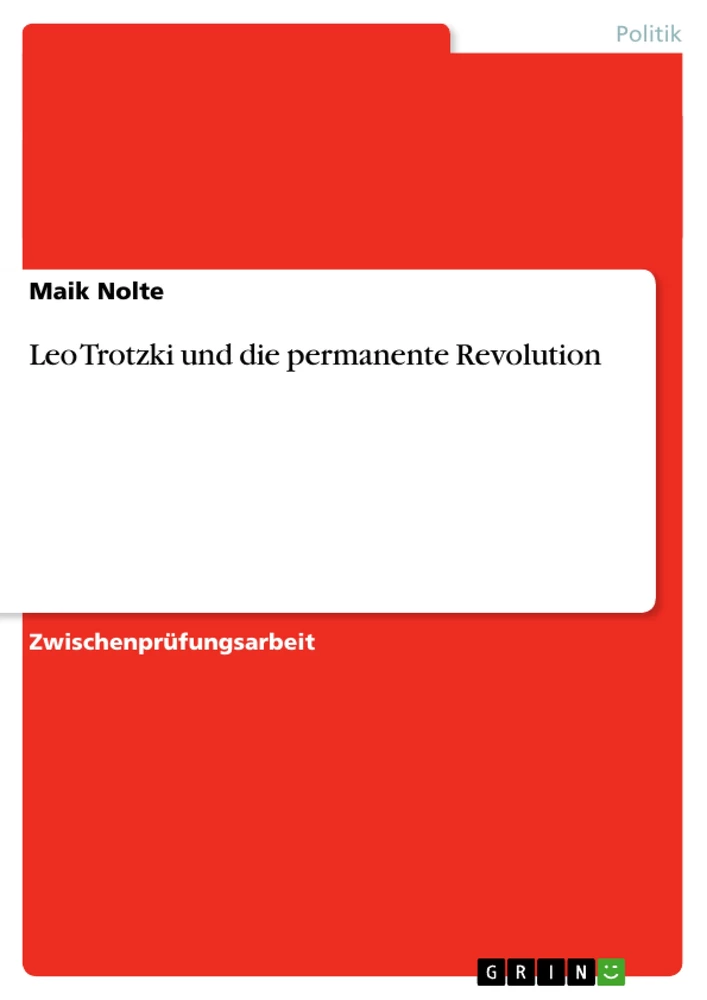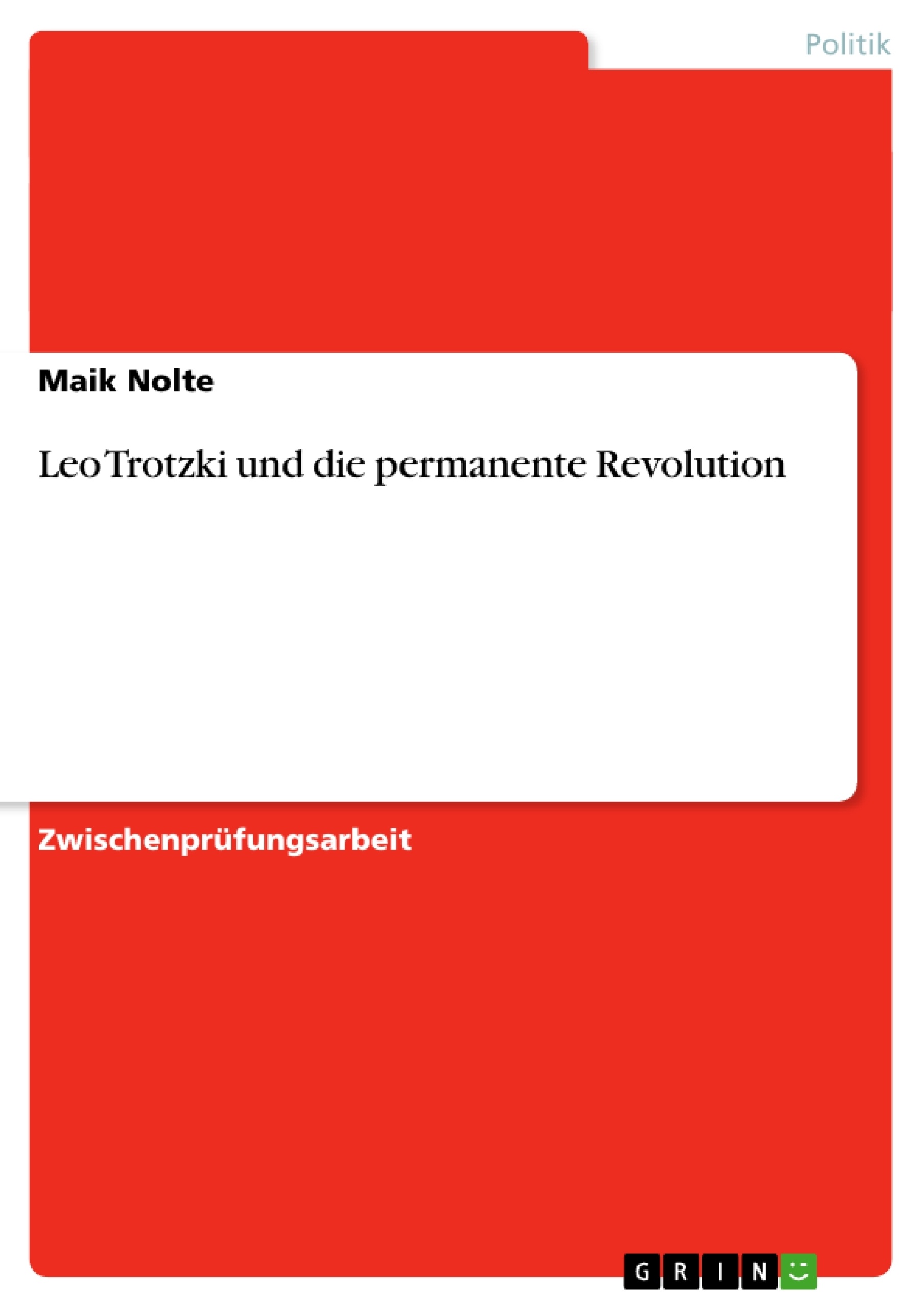In der vorliegenden Arbeit soll das Leben und das Werk Leo Trotzkis, des neben Lenin wichtigsten Mannes während der Oktoberrevolution in Rußland 1917, dargestellt werden. Den Schwerpunkt bildet hierbei seine Theorie der „permanenten Revolution“, die erheblichen Einfluß auf die bolschewistische Politik ausübte und seine Stellungnahme zur bolschewistischen Regierungs-form nach Lenins Tod 1924, welche später den Anlaß zu seiner Verfolgung gab. Da dieses Thema sehr speziell ist, werden Grundkenntnisse des Marxismus -Leninismus vorausgesetzt. Nach der Einleitung befaßt sich das zweite Kapitel mit der Herkunft Trotzkis und seinem politischen Werdegang. Weiterhin wird die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Rußland gegen Ende des 19. Jahrhunderts kurz umrissen. Im dritten Kapitel wird die Theorie der „permanenten Revolution“ und ihre Unterschiede zum ursprünglichen Marxismus vorgestellt. Diese Theorie bildet auch den Hintergrund der Ereignisse während der Revolutionen von 1917 bis zum Tode Lenins 1924 (Kapitel Vier). Das fünfte Kapitel behandelt die Zeit nach Lenins Tod, die Aus-einandersetzungen Trotzkis mit Stalin und anderen führenden Bolschewiki, seine Ausweisung aus der Sowjetunion und die Zeit bis zu seinem gewaltsamen Tod 1940. Das letzte Kapitel bildet der Versuch einer Bilanzierung von Trotzkis politischem Wirken und stellt Thesen für sein Scheitern auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Quellenlage
- Herkunft und Werdegang Trotzkis
- Die „permanente Revolution“
- Entwicklung der Theorie
- Die „permanente Revolution“ und der Marxismus
- Die Revolution von 1905
- Trotzki und Lenin
- Das Revolutionsjahr 1917
- Der Zusammenbruch des Zarenreiches im Frühjahr
- Die Zeit der Doppelherrschaft: März bis November 1917
- Die Oktoberrevolution
- Zusammenfassung: Die „permanente Oktoberrevolution“?
- Konsolidierung und Bürokratisierung der Revolution
- Vom „Roten Oktober bis zu Lenins Tod
- Die wirtschaftliche Katastrophe Rußlands
- Der Aufstieg Stalins
- Die Sowjetbürokratie
- Lenins Nachfolge
- Die Entmachtung Trotzkis
- Die Entscheidung des Machtkampfes
- Die chinesische Revolution und das Ende Trotzkis
- Fazit: Trotzki und der „Trotzkismus“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk Leo Trotzkis, einem der wichtigsten Akteure der russischen Revolution von 1917. Besonderes Augenmerk liegt auf Trotzkis Theorie der „permanenten Revolution“, deren Einfluss auf die bolschewistische Politik und seine Positionierung zur Regierungsform nach Lenins Tod 1924, die letztendlich zu seiner Verfolgung führte.
- Die „permanente Revolution“ und ihre Abgrenzung zum Marxismus
- Trotzkis Rolle in der russischen Revolution von 1917
- Der Machtkampf zwischen Trotzki und Stalin nach Lenins Tod
- Die politische und wirtschaftliche Situation in Russland im späten 19. Jahrhundert
- Die Folgen von Trotzkis Verfolgung und sein Tod
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Fokus der Arbeit dar, während das zweite Kapitel sich mit Trotzkis Herkunft und politischem Werdegang befasst. Kapitel Drei beleuchtet die Theorie der „permanenten Revolution“ und ihre Unterschiede zum traditionellen Marxismus. Kapitel Vier behandelt die Ereignisse der russischen Revolution von 1917 bis zum Tod Lenins im Jahre 1924, wobei die „permanente Revolution“ als Hintergrund für diese Ereignisse dient. Kapitel Fünf beschreibt die Zeit nach Lenins Tod, die Auseinandersetzungen Trotzkis mit Stalin und die Folgen seiner Ausweisung aus der Sowjetunion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Themen wie die „permanente Revolution“, den Marxismus-Leninismus, die russische Revolution von 1917, den Machtkampf innerhalb der Bolschewiki, Trotzkis Verfolgung und die Sowjetbürokratie. Wichtige Schlüsselbegriffe sind außerdem Trotzkismus, Stalismus, Geschichte der russischen Revolution, politische und wirtschaftliche Situation Russlands, und die Rolle der Intellektuellen in der Revolution.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Leo Trotzkis Theorie der „permanenten Revolution“?
Trotzki argumentierte, dass in rückständigen Ländern wie Russland die bürgerliche Revolution direkt in eine sozialistische Revolution übergehen müsse und diese nur durch eine weltweite Ausbreitung (Weltrevolution) dauerhaft bestehen könne.
Wie unterschied sich Trotzki von Lenin?
Während sie 1917 eng zusammenarbeiteten, gab es früher Differenzen über die Parteiorganisation. Trotzki betonte stärker den internationalen Charakter der Revolution, während Lenin pragmatischer auf die Festigung der Macht in Russland fokussiert war.
Was war Trotzkis Rolle in der Oktoberrevolution 1917?
Trotzki war neben Lenin der wichtigste Akteur. Er organisierte als Vorsitzender des Petrograder Sowjets den bewaffneten Aufstand und später als Volkskommissar die Rote Armee im Bürgerkrieg.
Warum kam es zum Machtkampf mit Stalin?
Nach Lenins Tod 1924 gab es ideologische und persönliche Differenzen. Stalin propagierte den „Sozialismus in einem Land“, während Trotzki an der permanenten Weltrevolution festhielt und die zunehmende Bürokratisierung kritisierte.
Was geschah nach Trotzkis Entmachtung?
Er wurde aus der KPdSU ausgeschlossen, 1929 aus der Sowjetunion ausgewiesen und lebte im Exil, bis er 1940 in Mexiko von einem Agenten Stalins ermordet wurde.
Was versteht man unter „Trotzkismus“?
Unter Trotzkismus versteht man die politische Strömung, die sich auf Trotzkis Theorien stützt, insbesondere die Ablehnung des Stalinismus und das Festhalten an der permanenten Revolution und der Rätedemokratie.
- Quote paper
- Maik Nolte (Author), 1999, Leo Trotzki und die permanente Revolution, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25916