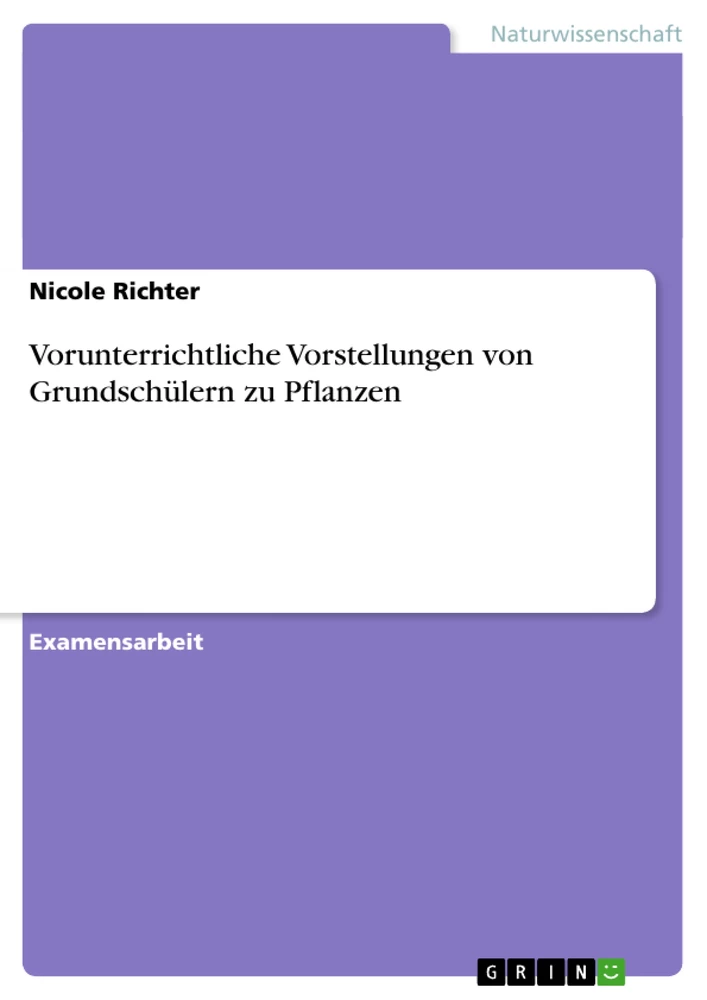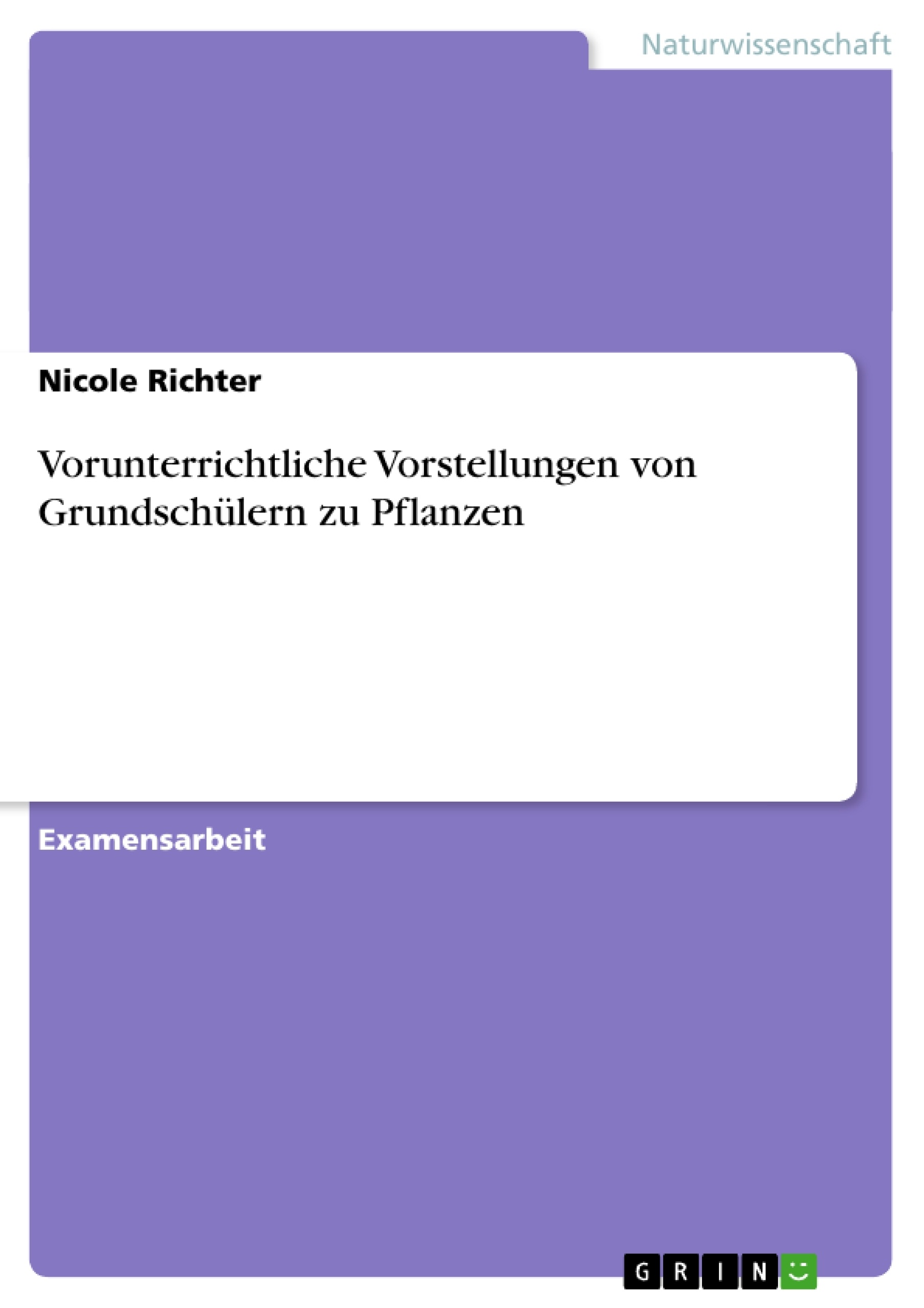Schüler sind im täglichen Leben vielen Eindrücken ausgesetzt. So entwickeln sie „Vorunterrichtliche Vorstellungen“ zu Begriffen, Phänomenen, Situationen, Ereignissen, Dingen, Themen etc. Sie kommen mit diesen Vorstellungen auch in die Schule. Das kann zum einen den Wissenserwerb im Unterricht fördern oder zum anderen behindern, wenn z.B. diese Vorstellungen tief verankert sind und sich wissenschaftlichen Theorien gegenüber als resistent erweisen. Sie beeinflussen folglich den Unterricht und sind daher bei der Planung und Durchführung von Unterricht zu beachten.
Seit ca. Ende der 70er Jahre veröffentlichen H. Pfund und R. Duit in ihrer Bibliographie „Students' and Teachers' Conceptions and Science Education“ internationale Publikationen zu „Vorunterrichtlichen Vorstellungen“ von Schülern mit dem Ziel, diese im Unterricht zu berücksichtigen. Dabei galten die meisten Untersuchungen in den naturwissenschaftlichen Fächern bisher Themen des Physikunterrichts, wenig hingegen Themen des Biologieunterrichts. Bis heute zählt die Bibliographie ca. 6000 Einträge (http://www.ipn-uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html , (gelesen am 12.10.2003)). Im Vergleich: 1991 waren es ca. 2500 Titel (Duit 1992, 48).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den „Vorunterrichtlichen Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen“ und soll hiermit einen weiteren Beitrag für die Biologiedidaktik leisten. Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Der erste Teil (Kapitel 1, 2, 3) umfasst die Einleitung mit Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit sowie die Darstellung des Begriffes „Vorunterrichtliche Vorstellungen“. Der zweite Teil (Kapitel 4, 5) widmet sich der Sachanalyse zum Thema Pflanzen, in der anhand von Fachliteratur die Bereiche Systematik, Lebensräume, Aufbau der Gefäßpflanzen, Funktionen der Pflanzenorgane der Gefäßpflanzen, Ernährung der Pflanzen (Fotosynthese) und Fortpflanzung der Pflanzen besprochen werden. Die Sachanalyse soll verdeutlichen, unter welchem biologischen Aspekt die Untersuchung betrachtet wird und dazu dienen, bei der Auswertung der Vorstellungen der Schüler einen möglichen Bezug zu der Wissenschaft herzustellen. Daran anschließend folgt die Erhebung der „Vorunterrichtlichen Vorstellungen von Grundschülern“ mit einem einleitenden Forschungsstand zum Thema sowie der Vorstellung des „Modells der Didaktischen Rekonstruktion“ (nach Gropengießer 1997), das zum Teil als Modellgrundlage für die Erhebung dient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- Zum Begriff „Vorunterrichtliche Vorstellungen“
- Sachanalyse
- Systematik der Pflanzen
- Pflanzen in ihren Lebensräumen
- Aufbau der Gefäßpflanzen (Kormophyten)
- Funktionen der Grundorgane der Gefäßpflanzen
- Ernährung der Pflanzen
- Fortpflanzung der Pflanzen
- „Vorunterrichtliche Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen“
- Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion
- Methode zur Erfassung der „Vorunterrichtlichen Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen“
- Wahl und Begründung der Methode
- Auswahl der Schüler
- Durchführung der Interviews
- Interviewleitfaden
- Kriterien der Auswertung der Interviews
- Interview 1: Jörg
- Transkript Interview 1: Jörg (siehe Anhang)
- Redigierte Aussagen Interview 1: Jörg
- Explikation Interview 1: Jörg
- Einzelstrukturierung: Konzepte zu Pflanzen Interview 1: Jörg
- Interview 2: Ralf
- Transkript Interview 2: Ralf (siehe Anhang)
- Redigierte Aussagen Interview 2: Ralf
- Explikation Interview 2: Ralf
- Einzelstrukturierung: Konzepte zu Pflanzen Interview 2: Ralf
- Interview 3: Sonja
- Transkript Interview 3: Sonja (siehe Anhang)
- Redigierte Aussagen Interview 3: Sonja
- Explikation Interview 3: Sonja
- Einzelstrukturierung: Konzepte zu Pflanzen Interview 3: Sonja
- Auswertung der Untersuchung
- Zusammenstellung der Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
- Leitlinien für die Schulpraxis
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Vorunterrichtlichen Vorstellungen von Grundschülern zum Thema Pflanzen. Ziel der Arbeit ist es, die individuellen Konzepte und Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen zu erforschen, zu analysieren und in eine aussagekräftige Form zu bringen.
- Identifizierung der Pflanzen, die den Grundschülern bekannt sind
- Analyse der Vorstellungen über die Lebensräume von Pflanzen
- Untersuchung der Konzepte zum Aufbau und den Funktionen der Pflanzenorgane
- Erforschung der Vorstellungen zur Ernährung und Fortpflanzung von Pflanzen
- Entwicklung von Leitlinien für die Schulpraxis basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit vor und führt in die Thematik der Vorunterrichtlichen Vorstellungen ein.
- Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit: In diesem Kapitel wird die allgemeine Fragestellung der Arbeit spezifiziert und die einzelnen Teilfragen erläutert. Das Ziel der Untersuchung ist die Erforschung und Analyse der Vorunterrichtlichen Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen.
- Zum Begriff „Vorunterrichtliche Vorstellungen“: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Vorunterrichtliche Vorstellungen“ und erläutert dessen Bedeutung im Kontext des wissenschaftlichen Lernprozesses.
- Sachanalyse: In diesem Kapitel werden verschiedene Bereiche der Botanik behandelt, die für die Untersuchung relevant sind. Dazu gehören die Systematik der Pflanzen, Pflanzen in ihren Lebensräumen, Aufbau der Gefäßpflanzen, Funktionen der Pflanzenorgane, Ernährung und Fortpflanzung der Pflanzen.
- „Vorunterrichtliche Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen“: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Erhebung der Vorunterrichtlichen Vorstellungen von Grundschülern. Es wird das „Modell der Didaktischen Rekonstruktion“ vorgestellt, das als Modellgrundlage für die Erhebung dient. Die Methode zur Erhebung der Vorstellungen, die Auswahl der Schüler sowie die Durchführung der Interviews werden erläutert. Die einzelnen Interviews mit den Schülern Jörg, Ralf und Sonja werden detailliert dargestellt und analysiert.
- Auswertung der Untersuchung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und diskutiert. Es werden Leitlinien für die Schulpraxis formuliert, die auf den Erkenntnissen der Untersuchung basieren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Vorunterrichtliche Vorstellungen, Grundschüler, Pflanzen, Botanik, Didaktische Rekonstruktion, Interview, Einzelstrukturierung, Konzepte, Schulpraxis.
- Arbeit zitieren
- Nicole Richter (Autor:in), 2003, Vorunterrichtliche Vorstellungen von Grundschülern zu Pflanzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26002