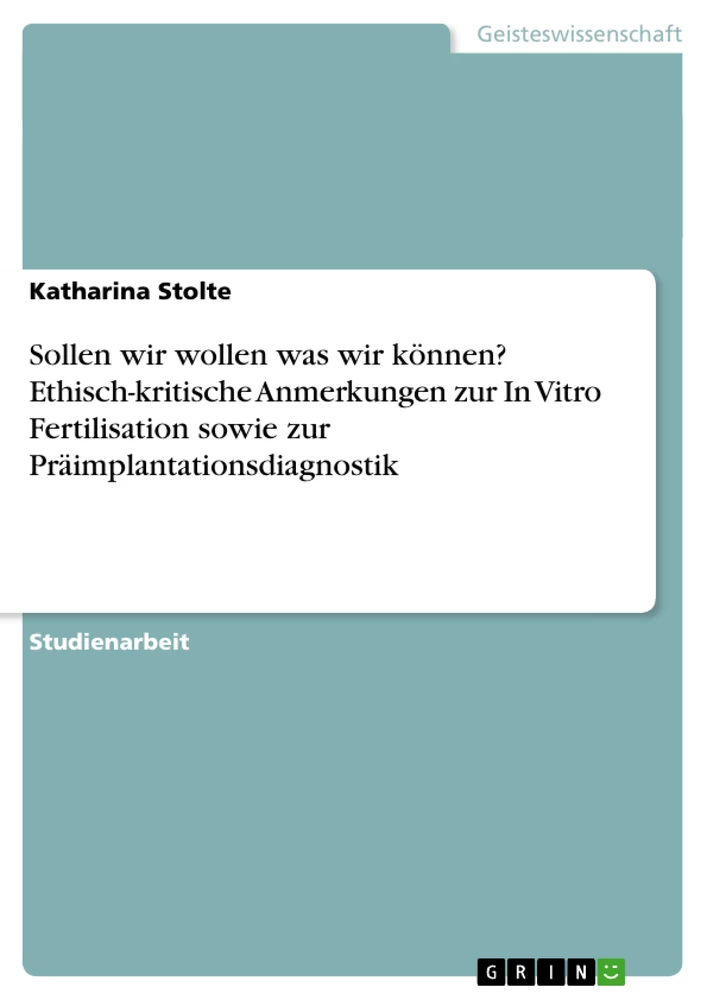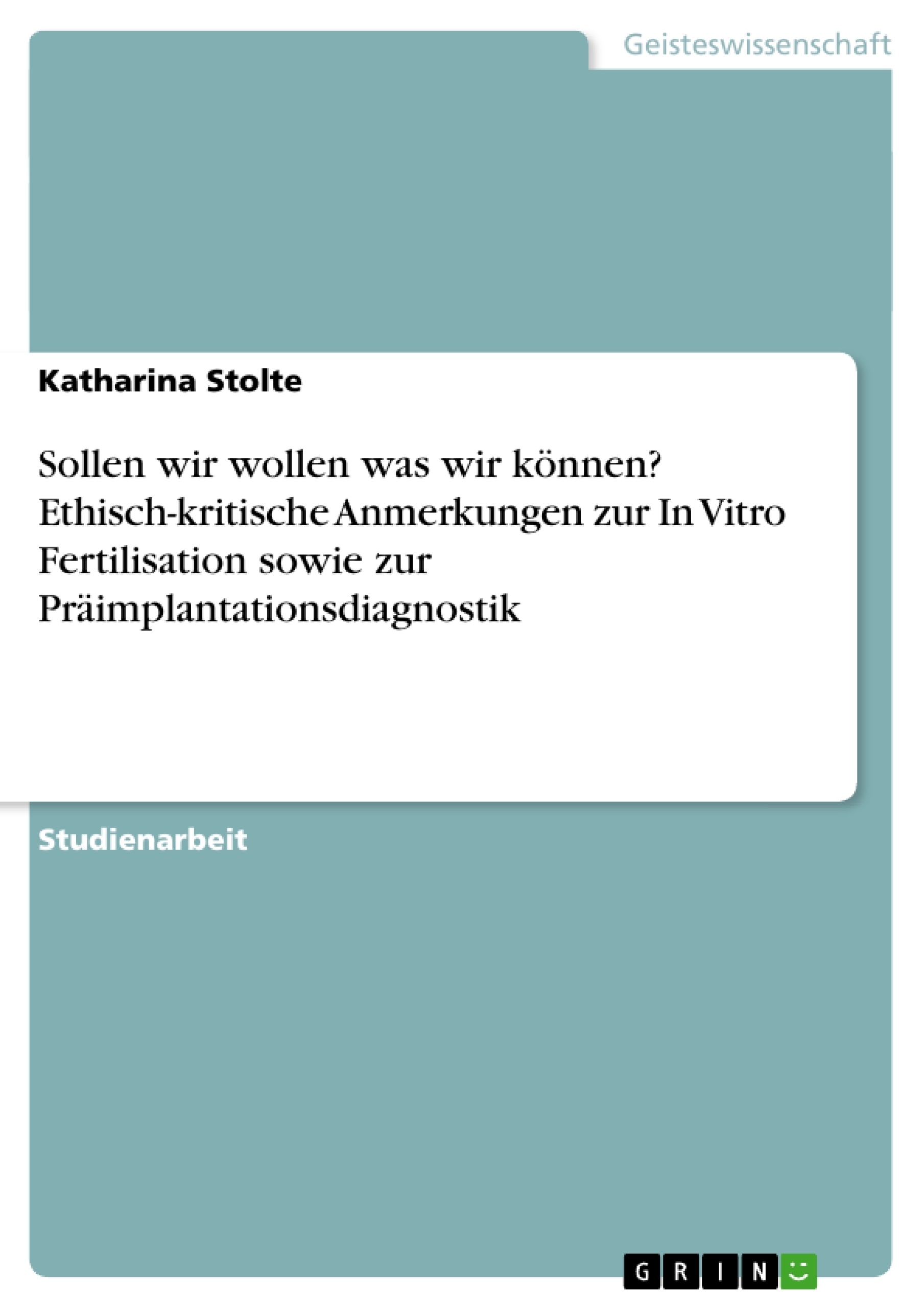Die Meldung war eher klein, lediglich am Rande der Zeitungsseite untergebracht:
ein britisches, weißes Ehepaar hatte nach erfolgreicher künstlicher
Befruchtung schwarze Zwillinge bekommen. Keine Laune der Natur, keine
Mulatten im Stammbaum sondern ein fataler Fehler im Labor war hier
passiert. Gleichzeitig nämlich hatte sich ein schwarzes Ehepaar künstlich
befruchten lassen – ohne Erfolg allerdings. Dachten sie. Denn was das weiße
Ehepaar nun hat, sind genaugenommen die Kinder des schwarzen Ehepaars,
zumindest genetisch gesehen. Die befruchteten Eizellen waren im Labor
vertauscht und der falschen Mutter eingepflanzt worden. Das schwarze Ehepaar
möchte jetzt seine Kinder haben, die das weiße Ehepaar jedoch nicht
hergeben will, da sie sich als die Eltern der Zwillinge betrachten. Dieser Fall
wird die englische Justiz – in dem Bemühen, hier ein salomonisches Urteil zu
finden – voraus sichtlich einige Jahre beschäftigen. Was solange aus den
Kindern werden soll, ist unklar. Sie werden höchstwahrscheinlich bei ihren
weißen Eltern bleiben. Ob man sie dort in ein paar Jahren jedoch wegholen
und dem anderen Elternpaar geben kann, ist moralisch mehr als fragwürdig.
Neben all den Heilungsversprechen, die uns aufgrund der immer neuen
Möglichkeiten in der Fortpflanzungsmedizin gemacht werden, ist dies eines
der Probleme, die uns eben diese Möglichkeiten bescheren werden. Wir Menschen
wagen uns hier in ein vollkommen neues, moralisch schwer faßbares
Gebiet vor. Das muß per se nichts Schlimmes sein. In unserer Geschichte gab
es immer wieder Neues, das uns bedrohlich erschien, wie beispielsweise die
Dampfmaschine, die ersten Eisenbahnen, Dynamit usw., woran wir uns aber
letzten Endes immer gewöhnt haben und das meiste davon auch nicht mehr
missen möchten. Die Möglichkeiten, die sich durch die Gentechnik jedoch
eröffnen, könnten durch das extrakorporale Vorhandensein von Embryonen
und damit der Verfügbarkeit menschlichen Lebens unser Verständnis von
Menschsein, Elternschaft und Gesellschaft im allgemeinen in einem Ausmaß
verändern, das wir bisher gar nicht abschätzen können. Durch In-Vitro-
Fertilisation, Präimplantationsdiagnostik, verbrauchende Embryonenforschung und Stammzellenzucht wird auch der Mensch verstärkt Teil eines
verbrauchs - und leistungsorientierten Denkens das in dieser Form nicht
wünschenswert sein kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- TECHNIK UND VERFAHREN
- In-vitro - Fertilisation
- Präimplantationsdiagnostik
- VOM KÖNNEN UND WOLLEN
- In-Vitro- Fertilisation einmal näher betrachtet
- Gibt es ein Recht auf Kinder?
- Ist Kinderlosigkeit eine Krankheit?
- Reproduktionsmedizin und ärztliche Ethik
- Folgen für die Partnerschaft und die Kinder
- Kosten und Kostenträger
- Präimplantationsdiagnostik einmal näher betrachtet
- Dichtung und Wahrheit: was kann die PID?
- Gibt es ein Recht auf ein gesundes Kind?
- Zur Notwendigkeit der Präimplantationsdiagnostik
- Die Frage nach der Verantwortung
- Verantwortungsrhetorik
- Ist die Menschwürde- Diskussion relevant?
- In-Vitro- Fertilisation einmal näher betrachtet
- SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den ethisch-moralischen Schwierigkeiten, die sich durch den rasanten Fortschritt in Medizin und Gentechnik ergeben. Im Fokus stehen die In-Vitro-Fertilisation und die Präimplantationsdiagnostik, wobei die Frage im Zentrum steht, ob unser Verständnis von Menschlichkeit, Ethik und Moral dem normativen Druck des Faktischen, der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Standortdebatte untergeordnet werden sollte.
- Die ethischen Herausforderungen der In-Vitro-Fertilisation
- Die Implikationen der Präimplantationsdiagnostik für das Menschenbild
- Die Frage nach der Verantwortung in Bezug auf die Reproduktionsmedizin
- Die Rolle der Menschwürde in der Diskussion über die neuen Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin
- Die Abwägung von individueller Freiheit und gesellschaftlichen Normen im Kontext der Gentechnik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fall eines vertauschten Embryos dar, der die ethischen Dilemmata der Reproduktionsmedizin aufzeigt. Das zweite Kapitel erläutert die Technik und die Verfahren der In-Vitro-Fertilisation und der Präimplantationsdiagnostik. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den ethischen Fragen der In-Vitro-Fertilisation, darunter das Recht auf Kinder, die Definition von Kinderlosigkeit als Krankheit, die ethischen Aspekte der Reproduktionsmedizin und die Auswirkungen auf Partnerschaften und Kinder. Im weiteren Verlauf werden die Chancen und Risiken der Präimplantationsdiagnostik beleuchtet, die Frage nach dem Recht auf ein gesundes Kind und die Notwendigkeit der PID diskutiert. Außerdem wird die Verantwortung und die Rolle der Menschwürde im Kontext der PID beleuchtet.
Schlüsselwörter
In-Vitro-Fertilisation, Präimplantationsdiagnostik, Reproduktionsmedizin, Ethik, Moral, Menschlichkeit, Verantwortung, Menschwürde, Gentechnik, Kinderwunsch, Familienplanung, ethische Implikationen, gesellschaftliche Normen, individueller Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen IVF und PID?
In-Vitro-Fertilisation (IVF) ist die künstliche Befruchtung außerhalb des Körpers, während die Präimplantationsdiagnostik (PID) die genetische Untersuchung des Embryos vor der Einpflanzung bezeichnet.
Welche ethischen Fragen wirft die Reproduktionsmedizin auf?
Zentrale Fragen sind das Recht auf ein Kind, der Schutz der Menschenwürde von Embryonen und die Gefahr einer Selektion nach Leistungsmerkmalen.
Gibt es ein „Recht auf ein gesundes Kind“?
Die Arbeit diskutiert diesen Anspruch kritisch und beleuchtet die moralischen Konsequenzen einer solchen Forderung für die Gesellschaft.
Was ist verbrauchende Embryonenforschung?
Dabei handelt es sich um Forschung an Embryonen, bei der diese zerstört werden, was massive ethische Bedenken hinsichtlich des Status menschlichen Lebens aufwirft.
Wie beeinflusst die Gentechnik unser Verständnis von Elternschaft?
Durch die technischen Möglichkeiten wird Elternschaft zunehmend planbar, was die Verantwortung der Eltern und die Natürlichkeit der Fortpflanzung in Frage stellt.
- Quote paper
- Katharina Stolte (Author), 2002, Sollen wir wollen was wir können? Ethisch-kritische Anmerkungen zur In Vitro Fertilisation sowie zur Präimplantationsdiagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26115