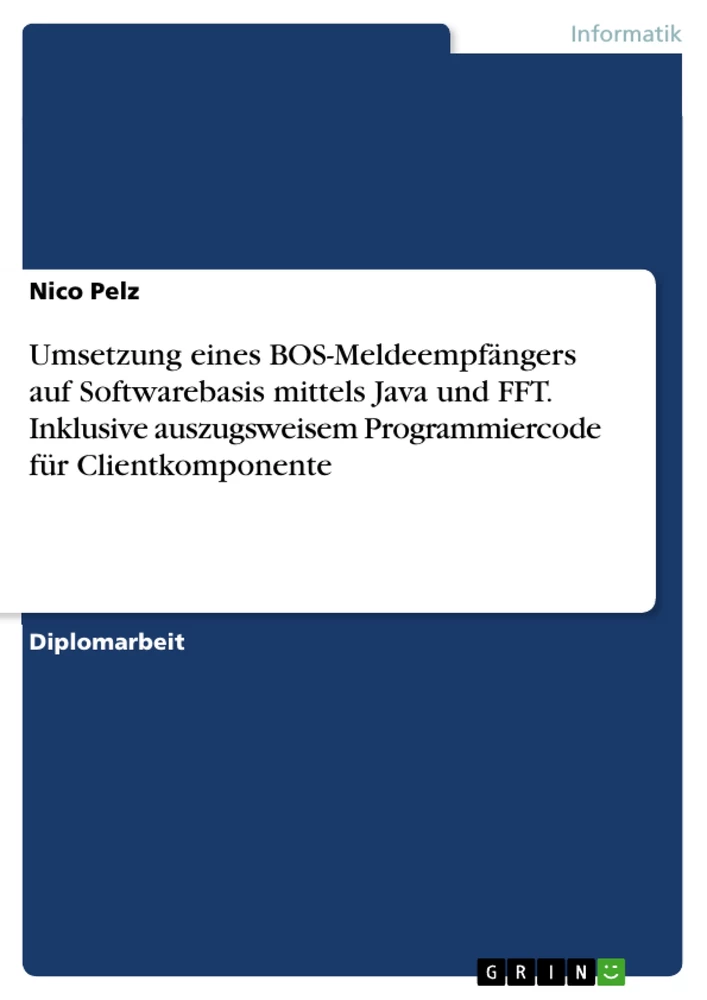Nach einer Beschlussfassung der Bundesregierung im Jahr 2000, sollen die deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Jahr 2006 ein neues Funksystem bekommen. Dieses neue Funksystem soll das derzeitige überholungsbedürftige analoge Funksystem ablösen.
Seit dieser Beschlussfassung sind zahlreiche Ausschüsse ins Leben gerufen worden, um die zukünftigen Anforderungen der BOS bei der Systemauswahl berücksichtigen zu können. In einem Pilotprojekt, im Länderdreieck Aachen, wird derzeit ein Systemstandard der ETSI getestet (TETRA25), welcher den Anforderungen der BOS am meisten gerecht wird. Dabei handelt es sich um ein Funksystem, was mit dem GSM-Funksystem der Mobiltelefonanbieter verglichen werden kann. Die innere Struktur und das Zusammenspiel der deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind weltweit einmalig. Diese Struktur soll auch nach der Einführung des neuen Funksystems erhalten bleiben. Aus diesem Grund muss das neue Funksystem den Anforderungen der polizeilichen Behörden, der Feuerwehr, dem Katastrophenschutz, sowie dem Rettungsdienst gerecht werden. Diese Vorgaben konnten im Aachener Pilotprojekt bis auf einen Punkt eingehalten
werden.
Der ETSI-Standard (TETRA25) berücksichtigt keine Funkalarmierung. Nur durch
eine Änderung des Standards oder durch eine sehr aufwendige und kostspielige Anpassung der Endgeräte könnte dieser fehlende Punkt beseitigt werden. Eine Abänderung des TETRA25 Standards für die deutsche BOS geht zu Lasten der internationalen Interaktion der TETRA 25 Funksysteme und scheidet somit aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Vorgeschichte
- 1.2 Grundgedanke dieser Diplomarbeit
- 2 Die BOS und ihr Funksystem
- 2.1 Definition BOS
- 2.2 Das Funknetz der BOS
- 2.3 Die analoge Alarmierung
- 2.3.1 Notwendigkeit und Anwender
- 2.3.2 Definition und Geschichte
- 2.3.3 5-Ton-Folgeruf
- 2.3.4 Alarmierungsverfahren
- 2.3.5 Anwendung und Praxis.
- 2.3.6 Pro und Kontra analoge Alarmierung.
- 3 Unterstützungsansätze und Spezifikation
- 3.1 Unterstützungsansätze
- 3.2 Spezifikation
- 3.2.1 Grundeigenschaften .
- 3.2.2 Fachkonzept und Funktionsmodell.
- 3.2.3 Organisationskonzept
- 3.2.4 Anwendungsanalyse.
- 4 Analyse des Audiosignals
- 4.1 Grundlagen
- 4.2 A/D-Umsetzung.
- 4.3 Das Abtasttheorem
- 4.4 Analyse der Abtastwerte
- 4.4.1 Zählen der Nulldurchgänge der Niederfrequenz
- 4.4.2 Analyse des Frequenzspektrums
- 4.5 Diskrete Fouriertransformation
- 4.6 Fast-Fouriertransformation
- 4.7 Leckeffekt und Fensterung
- 5 Konstruktion
- 5.1 Modularisierung.
- 5.1.1 Komponenten
- 5.1.2 Serverkomponente
- 5.1.3 Clientkomponente.
- 5.1.4 Hilfskomponente
- 5.2 Prozessorganisation
- 5.2.1 Prozessorganisation Server
- 5.2.2 Prozessorganisation Client
- 5.3 Auswahl Programmiersprache
- 5.4 Datenmanagement
- 5.5 Netzwerkprotokoll
- 6 Programmierung in Java
- 6.1 Klasse BOSLS-Sound Decoder
- 6.2 Klasse BOSLS-Soundsuccession Decoderl
- 6.2.1 Kontrolle der Tonlänge .
- 6.2.2 Zusammenstellung der Ruftonfolge
- 6.3 Klasse BOSLS-Spectrum
- 6.4 Klasse BOSLC-Display
- 6.5 Nicht realisierte Funktionalitäten
- 6.5.1 Threads und gemeinsamer Speicherbereich
- 6.5.2 Clientschwund .
- 6.5.3 Fehlerbehandlung
- 7 Programmbeschreibung
- 7.1 Systemanforderungen
- 7.2 BOSL-Server
- 7.3 BOSL-Client.
- 7.4 Externe Anwendungen
- 8 Schlusswort und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit verfolgt das Ziel, einen Software-basierten BOS-Meldeempfänger zu entwickeln, der die analoge Alarmierung durch ein digitales System ersetzt. Der Fokus liegt auf der Erfassung und Analyse von Audiosignalen, die im BOS-Funksystem verwendet werden, um die Ruftonfolgen zu decodieren und in eine verständliche Form zu überführen.
- Analyse von Audiosignalen im BOS-Funksystem
- Entwicklung eines Software-basierten Meldeempfängers
- Anwendungen der Fast-Fourier-Transformation (FFT) zur Signalverarbeitung
- Programmierung mit Java für die Implementierung des Systems
- Integration und Interaktion des Systems mit bestehenden BOS-Anwendungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Vorgeschichte und den Grundgedanken der Diplomarbeit vor, die sich mit der Umsetzung eines Software-basierten BOS-Meldeempfängers beschäftigt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) und ihr Funksystem, einschließlich der analogen Alarmierung, ihrer Notwendigkeit, Definition und Geschichte, des 5-Ton-Folgerufs, der Alarmierungsverfahren und der Anwendung in der Praxis.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit Unterstützungsansätzen für den BOS-Meldeempfänger und spezifiziert die Eigenschaften, das Fachkonzept, das Funktionsmodell, das Organisationskonzept und die Anwendungsanalyse des Systems.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Audiosignal-Analyse behandelt, einschließlich A/D-Umsetzung, Abtasttheorem, Analyse der Abtastwerte, Diskrete Fouriertransformation und Fast-Fouriertransformation.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Konstruktion des BOS-Meldeempfängers, einschließlich Modularisierung, Prozessorganisation, Auswahl der Programmiersprache Java, Datenmanagement und dem Netzwerkprotokoll.
Schlüsselwörter
BOS, Meldeempfänger, Software, Audiosignal, FFT, Java, Alarmierung, Funknetz, analoge Alarmierung, digitale Alarmierung, Signalverarbeitung, Programmierung, Datenmanagement, Netzwerkprotokoll.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit?
Die Entwicklung eines softwarebasierten Meldeempfängers für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) unter Nutzung von Java und FFT.
Warum reicht der TETRA25-Standard für deutsche BOS nicht aus?
Der internationale Standard berücksichtigt keine Funkalarmierung, die für die deutsche Struktur (Feuerwehr, Rettungsdienst) jedoch essenziell ist.
Welche Rolle spielt die Fast-Fourier-Transformation (FFT)?
Sie wird zur Analyse des Audiosignals und des Frequenzspektrums eingesetzt, um die Ruftonfolgen (5-Ton-Folgeruf) digital zu decodieren.
Was ist ein 5-Ton-Folgeruf?
Ein analoges Alarmierungsverfahren, bei dem eine spezifische Abfolge von fünf Tönen einen bestimmten Empfänger oder eine Gruppe alarmiert.
Welche Systemkomponenten wurden programmiert?
Das System umfasst eine Serverkomponente zur Signalverarbeitung, eine Clientkomponente zur Anzeige und verschiedene Hilfsklassen in Java.
- Arbeit zitieren
- Nico Pelz (Autor:in), 2004, Umsetzung eines BOS-Meldeempfängers auf Softwarebasis mittels Java und FFT. Inklusive auszugsweisem Programmiercode für Clientkomponente, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26135