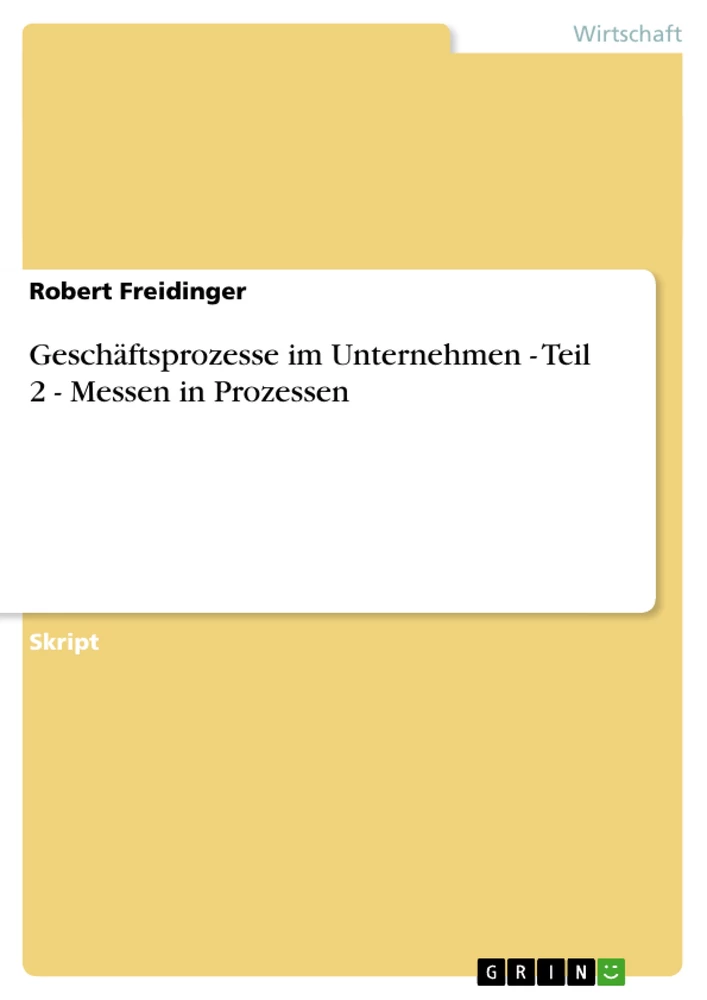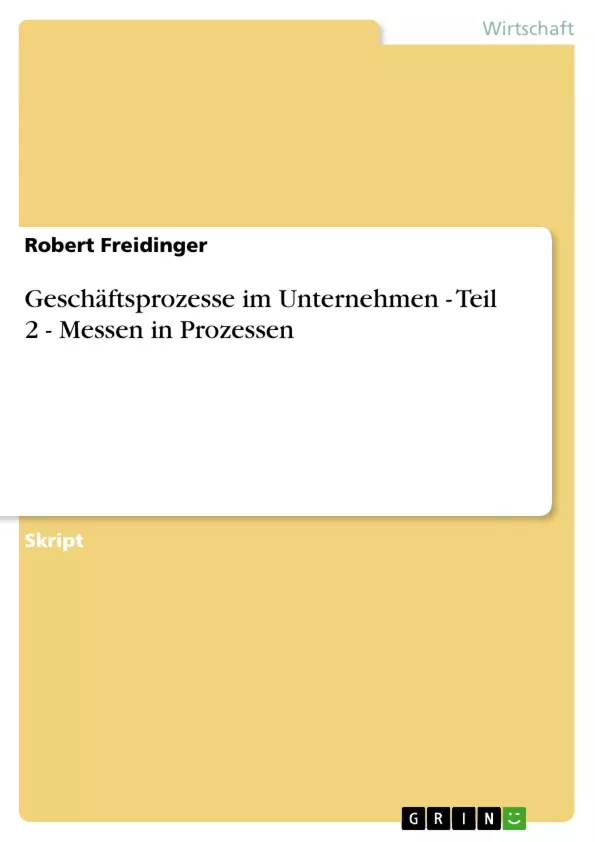Unsere Wirtschaftsunternehmen und Dienstleistungseinrichtungen sind bestens organisiert, haben klare Organisationen und sind leistungsfähig. Auf der anderen Seite prägen Firmenpleiten, Massenentlassungen, Management-Fehlleistungen, laufende Reorganisationen und Umstrukturierungen, Trends wie Re-engineering, Lean Management, Time Based Competition, Supply Chain Orientierung die Nachrichten. Wie passt dies zusammen? Warum gibt es so viele Ansätze, sich auf die Geschäftsprozesse zu konzentrieren und diese zu verbessern? Wie funktionieren eigentlich Prozesse oder Abläufe im Unternehmen? Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinstunternehmen?
Je größer ein Unternehmen, desto stärker ist es in Funktionen gegliedert. Umso schwerer können Prozesse identifiziert und gesteuert werden. Umso schwieriger ist Kundenorientierung durchzusetzen. Da die Leistungserbringung für den Kunden (Geldquelle) im Unternehmen in Prozessen (Abläufen) erfolgt, ist die Betrachtung der eigenen Prozesswelt unerlässlich – unabhängig von der Größe. Für produzierende Unternehmen ist dies bereits relativ geläufig. Dienstleistungsunternehmen haben hier noch stärkeren Nachholbedarf.
Teil 2 fokussiert auf die Messung der Prozessleistung, die Ermittlung der Leistungsfähigkeit durch weitere Methoden, wie Kundenzufriedenheit, Benchmarking, Prozesskostenrechnung, Balanced Score Card, sowie Prozessreifegradermittlung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Messgrößen von Prozessen und Kennzahlensysteme
- Kundenzufriedenheit
- Benchmarking
- Prozesskostenrechnung
- Balanced Score Card als Indikator der Prozessleistung
- Ermittlung der Prozessleistungsfähigkeit und des Prozessreifegrades
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der zweite Teil der Reihe „Geschäftsprozesse im Unternehmen" befasst sich mit der Messung und Bewertung von Prozessen. Das Ziel ist es, den Leser mit verschiedenen Methoden und Kennzahlen vertraut zu machen, die für die Optimierung von Geschäftsprozessen entscheidend sind.
- Messgrößen und Kennzahlen für Prozessperformance
- Kundenzufriedenheit als wichtiger Erfolgsfaktor
- Benchmarking als Methode zum Vergleich von Prozessen
- Prozesskostenrechnung als Instrument zur Kostenzuordnung und -optimierung
- Balanced Score Card als umfassendes Bewertungssystem für Prozesse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der erste Abschnitt führt in die Notwendigkeit der Prozessmessung und -bewertung für die Optimierung der Unternehmensleistung ein. Er definiert den Prozess und erläutert, wie Messgrößen für die Planung und Kontrolle eingesetzt werden können.
- Messgrößen von Prozessen und Kennzahlensysteme: In diesem Kapitel werden die Anforderungen an Prozessmessgrößen vorgestellt, die für die Performance-Bewertung und Steuerung entscheidend sind. Es werden Beispiele für verschiedene Messgrößen und deren Bedeutung für die Praxis erläutert.
- Kundenzufriedenheit: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung der Kundenzufriedenheit als Messgröße für die externe Wirkung von Prozessen. Es werden verschiedene Methoden zur Erhebung der Kundenzufriedenheit vorgestellt und die Rolle des Customer Satisfaction Indices (CSI) erläutert.
- Benchmarking: Der Abschnitt behandelt die Methode des Benchmarking als Instrument zum Vergleich von Prozessen und Leistungen im Unternehmen und mit Wettbewerbern. Er erläutert den Einsatz von Kennzahlen und die Vorteile der vergleichenden Analyse für die Prozessoptimierung.
- Prozesskostenrechnung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Prozesskostenrechnung als Alternative zur traditionellen Kostenrechnung. Es verdeutlicht die Herausforderungen bei der Zuordnung von Gemeinkosten und die Vorteile der Prozesskostenrechnung für ein verbessertes Kostenmanagement.
Schlüsselwörter
Prozessmessung, Kennzahlen, Kundenzufriedenheit, Benchmarking, Prozesskostenrechnung, Performance, Optimierung, Geschäftsprozesse, Wertschöpfung, Prozessperformance, Customer Satisfaction Index (CSI), Key Performance Indicators (KPIs), Prozessreifegrad, Prozessmanagement, Balanced Score Card.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Messen in Geschäftsprozessen so wichtig?
Nur durch Messung lässt sich die Leistungsfähigkeit von Prozessen ermitteln, steuern und im Hinblick auf Kundenorientierung optimieren.
Was ist der Customer Satisfaction Index (CSI)?
Der CSI ist eine Messgröße für die Kundenzufriedenheit und dient als Indikator für die externe Wirkung der Unternehmensprozesse.
Welche Vorteile bietet die Prozesskostenrechnung?
Sie ermöglicht eine genauere Zuordnung von Gemeinkosten zu den tatsächlichen Abläufen und verbessert so das Kostenmanagement im Vergleich zur traditionellen Rechnung.
Wie hilft Benchmarking bei der Prozessoptimierung?
Benchmarking erlaubt den Vergleich der eigenen Prozesse mit denen der besten Wettbewerber, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
Was ist eine Balanced Score Card (BSC)?
Die BSC ist ein umfassendes Kennzahlensystem, das verschiedene Perspektiven (z. B. Finanzen, Kunden, Prozesse) zur Bewertung der Unternehmensleistung nutzt.
- Citar trabajo
- Dr. Robert Freidinger (Autor), 2004, Geschäftsprozesse im Unternehmen - Teil 2 - Messen in Prozessen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26139