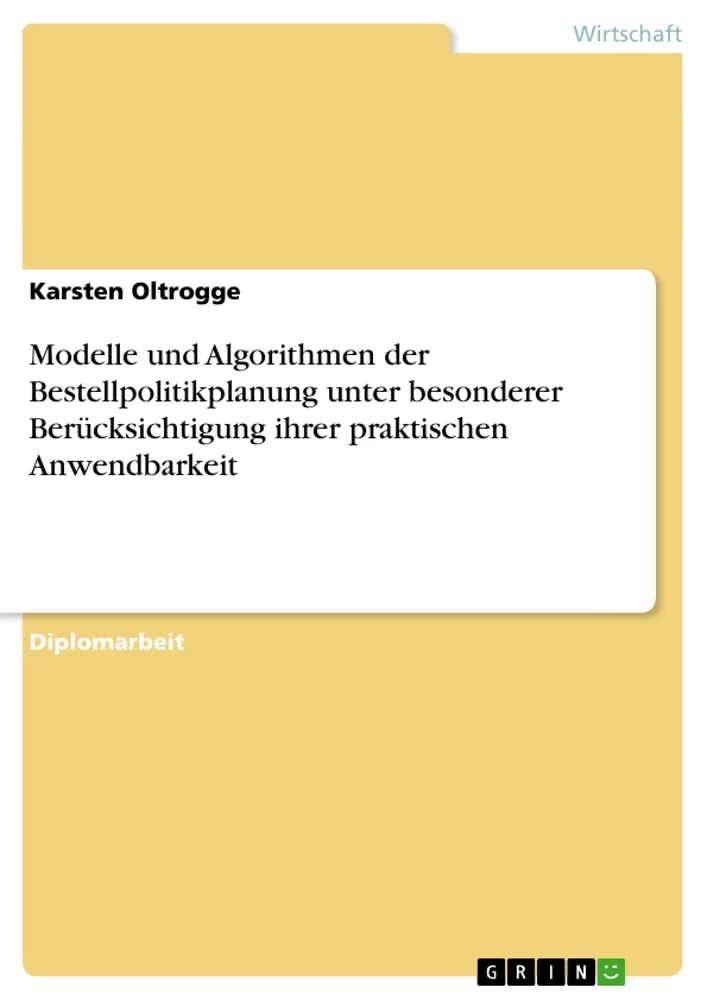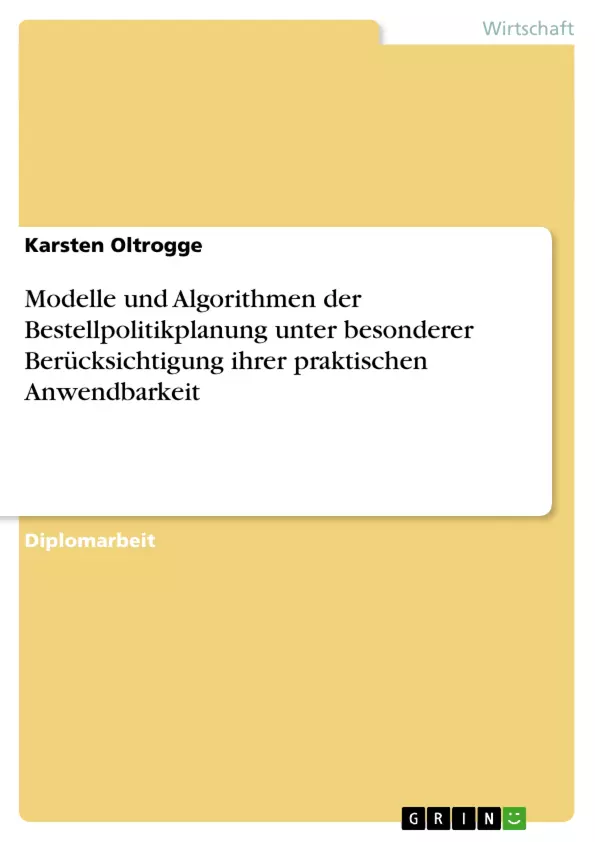Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Leser einen Überblick über die Methoden und Algorithmen der Bestellpolitikplanung unter besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Anwendbarkeit zu vermitteln.
Die Aufgabe ist somit nicht beschränkt auf die Darstellung der unterschiedlichen, von der betriebswirtschaftlichen Theorie entwickelten, Klassen von Bestellalgorithmen, sondern darüber hinaus darauf ausgerichtet, eine Verbindung herzustellen zwischen Bestellalgorithmen auf der einen und praktischem Anwendungsgebiet auf der anderen Seite. Die hier deutlich werdende „Lücke“ zwischen der Theorie und ihrer konkreten praktischen Verknüpfung soll, soweit dies im Rahmen dieser Diplomarbeit überhaupt erreichbar sein kann, möglichst weit geschlossen werden.
Um diesem Ziel gerecht werden zu können, ist neben einer Klassifizierung, Einteilung und Erläuterung der Bestellalgorithmen und –modelle auch eine Einteilung der unterschiedlichen Beschaffungsprinzipien und -formen der unternehmerischen Praxis notwendig.
Ferner ist es im weiten Feld der Materialwirtschaft und der verschiedenen Perspektiven, aus denen auf sie geblickt werden kann, unerlässlich, die Betrachtungsobjekte vorliegender Arbeit möglichst klar abzugrenzen und einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- 1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG
- 2 AUFGABEN, ZIELE UND AUFBAU DER MATERIALWIRTSCHAFT
- 2.1 DEFINITION UND ABGRENZUNG DES BEGRIFFES MATERIAL WIRTSCHAFT
- 2.1.1 Definition des Begriffes Material.
- 2.1.2 Definition des Begriffes Wirtschaft.
- 2.1.3 Klassische Definition der Materialwirtschaft.
- 2.1.4 Neuere Definitionsansätze
- 2.1.4.1 Eine enge Begriffsfassung der Materialwirtschaft.
- 2.1.4.2 Eine erweiterte Begriffsfassung der Materialwirtschaft
- 2.1.4.3 Die integrierte Materialwirtschaft.
- 2.2 DIE ZIELE DER MATERIALWIRTSCHAFT
- 2.2.1 Sicherungs- und Gestaltungsziele.
- 2.3 DER STRUKTURELLE AUFBAU DER MATERIAL WIRTSCHAFT
- 2.3.1 Materialbeschaffung.
- 2.3.1.1 Ziele der Materialbeschaffung.
- 2.3.1.2 Materialanalyse
- 2.3.1.2.1 ABC-Analyse
- 2.3.1.2.2 XYZ-Analyse
- 2.3.1.3 Beschaffungsplanung .
- 2.3.1.4 Beschaffungsprinzipien
- 2.3.1.4.1 Beschaffungsmarktforschung..
- 2.3.1.4.1.1 Vorratsbeschaffung
- 2.3.1.4.1.2 Einzelbeschaffung im Bedarfsfall
- 2.3.1.4.1.3 Fertigungssynchrone bzw. Just-in-Time-Beschaffung .
- 2.3.1.4.2 Beschaffungswege.
- 2.3.1.4.2.1 Direkte Beschaffung.
- 2.3.1.4.2.2 Indirekte Beschaffung.
- 2.3.1.4.3 Beschaffungsmengen und -termine
- 2.3.1.4.3.1 Verbrauchsgesteuerte Disposition.
- 2.3.1.4.3.2 Bedarfsgesteuerte Disposition.
- 2.3.1.5 Beschaffungdurchführung…..\n
- 2.3.1.6 Beschaffungskontrolle.
- 2.3.2 Materialverwaltung..
- 2.3.3 Materialverteilung.
- 2.3.4 Materialentsorgung..
- 2.3.1 Materialbeschaffung.
- 3 INSTITUTIONELLE BESCHAFFUNGSPRINZIPIEN UND –FORMEN.
- 3.1 ABGRENZUNG ZU DEN KLASSISCHEN BESCHAFFUNGSPRINZIPIEN .
- 3.2 GLIEDERUNG DER BESCHAFFUNGSFORMEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG IHRER VERTRAGLICHEN GRUNDLAGE.
- 3.2.1 Beschaffungsformen auf Grundlage von Rahmenverträgen...
- 3.2.1.1 Langfristige Kontraktpolitik.
- 3.2.1.2 Just-in-Time-Beschaffung..
- 3.2.1.2.1 Anwendbarkeit
- 3.2.1.2.2 Stärken und Schwächen.
- 3.2.1.2.3 Anforderungen an Algorithmen.
- 3.2.1.3 (Virtuelle) Einkaufsgemeinschaften.
- 3.2.1.3.1 Definition und Anwendbarkeit
- 3.2.1.3.2 Stärken und Schwächen...
- 3.2.1.3.3 Praxisbeispiele.
- 3.2.1.3.4 Anforderungen an Algorithmen.
- 3.2.1.4 Vendor Managed Inventory (VMI)..
- 3.2.1.4.1 Definition und Anwendbarkeit.
- 3.2.1.4.2 Stärken und Schwächen..
- 3.2.1.4.3 Praxisbeispiel.....
- 3.2.1.4.4 Anforderungen an Algorithmen ....
- 3.2.2 Beschaffungsformen auf Grundlage der Einzelbeschaffung.
- 3.2.2.1 Katalogsysteme
- 3.2.2.1.1 Definition und Anwendbarkeit
- 3.2.2.1.2 Klassifikationssysteme und Katalogformate..
- 3.2.2.1.3 Stärken und Schwächen.
- 3.2.2.1.4 Praxisbeispiel...
- 3.2.2.1.5 Anforderungen an Algorithmen.
- 3.2.2.2 Elektronische Marktplätze.
- 3.2.2.2.1 Definition und Anwendbarkeit.
- 3.2.2.2.2 Stärken und Schwächen
- 3.2.2.2.3 Praxisbeispiele.
- 3.2.2.2.4 Anforderungen an Algorithmen.
- 3.2.2.3 Reverse Auctions......
- 3.2.2.3.1 Definition und Anwendbarkeit..
- 3.2.2.3.2 Stärken und Schwächen..
- 3.2.2.3.3 Praxisbeispiel.......
- 3.2.2.3.4 Anforderungen an Algorithmen...
- 3.2.2.4 Ausschreibungen
- 3.2.2.4.1 Definition und Anwendbarkeit.
- 3.2.2.4.2 Stärken und Schwächen...
- 3.2.2.4.3 Praxisbeispiel...
- 3.2.2.4.4 Anforderungen an Algorithmen...
- 3.2.2.1 Katalogsysteme
- 3.2.1 Beschaffungsformen auf Grundlage von Rahmenverträgen...
- 4 METHODEN UND ALGORITHMEN DER BESTELLMENGENPLANUNG
- 4.1 DIE ALLGEMEINE ENTSCHEIDUNGSSITUATION..
- 4.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE PRAKTISCHEN BESTELLMENGENPROBLEME
- 4.3 DETERMINISTISCHE LAGERHALTUNGS- UND BESTELLMENGENPOLITIKEN
- 4.3.1 Deterministisch-statische Modelle.
- 4.3.1.1 Einstufige Einproduktmodelle..
- 4.3.1.1.1 Das klassische Economic Order Quantity-Modell (EOQ).
- 4.3.1.1.2 Stärken und Schwächen des EOQ-Modells.
- 4.3.1.1.3 Erweiterungen des EOQ-Modells..
- 4.3.1.2 Einstufige Mehrproduktmodelle.
- 4.3.1.2.1 Unkapazitiertes Bestellmengenmodell mit Sammelbestellungen.
- 4.3.1.2.2 Bestellmengenmodell mit Lagerkapazitätsrestriktionen.
- 4.3.1.2.3 Economic Lot Scheduling Problem (ELSP)
- 4.3.1.3 Mehrstufige Mehrproduktmodelle..
- 4.3.1.1 Einstufige Einproduktmodelle..
- 4.3.2 Deterministisch-dynamische Modelle.
- 4.3.2.1 Einstufige Einproduktmodelle.
- 4.3.2.1.1 Das Modell von Wagner-Whitin..
- 4.3.2.1.2 Kritik am Wagner-Whitin-Ansatz
- 4.3.2.1.3 Heuristische Verfahren.
- 4.3.2.1.3.1 Least-Unit-Cost-Verfahren (LUC).
- 4.3.2.1.3.2 Silver-Meal-Verfahren (SMV).
- 4.3.2.1.3.3 Part-Period-Verfahren (PPV).
- 4.3.2.1.3.4 Algorithmen auf Basis der Heuristiken
- 4.3.2.1.4 Überblick über Erweiterungen des Wagner-Whitin-Ansatzes.
- 4.3.2.2 Einstufige Mehrproduktmodelle.
- 4.3.2.2.1 Capacitated Lot-Sizing Problem (CLSP).
- 4.3.2.2.2 Weitere dynamisch-einstufige Mehrproduktmodelle.
- 4.3.2.3 Mehrstufige Mehrproduktmodelle.
- 4.3.2.1 Einstufige Einproduktmodelle.
- 4.4 STOCHASTISCHE LAGERHALTUNGS- UND BESTELLMENGENPOLITIKEN
- 4.4.1 Ursachen der Unsicherheit im Beschaffungswesen.
- 4.4.2 Allgemeine stochastische Lagerhaltungspolitiken
- 4.4.2.1 Nachfragemenge und Wiederbeschaffungszeit...
- 4.4.2.2 Lagerbezogene Leistungskriterien...
- 4.4.2.2.1 Bedeutung des α -Servicegrades..
- 4.4.2.2.2 Bedeutung des B-Servicegrades..
- 4.4.2.2.3 Bedeutung des 7 -Servicegrades....
- 4.4.2.3 (s,q)-Politik.
- 4.4.2.3.1 Erwartungswert und Sicherheitsbestand bei diskreter Wahrscheinlichkeitsverteilung.
- 4.4.2.3.2 Servicegrad und kostenminimaler Bestellpunkt
- 4.4.2.3.3 Kritik an der (s,q)-Politik..
- 4.4.2.4 (r,S)-Politik.
- 4.4.2.4.1 Ermittlung der Zykluslänge und des Sicherheitsbestandes..
- 4.4.2.4.2 Servicegrad-Restriktion.
- 4.4.2.4.3 Kritik an der (r,S)-Politik.
- 4.4.2.5 (s,S)-Politik...
- 4.4.2.5.1 Ermittlung der erwarteten Bestellmenge
- 4.4.2.5.2 B-Servicegrades im (s,S)-Modell.
- 4.4.2.5.3 Die Optimalität der (s,S)-Politik, ein Vergleich..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bestellpolitikplanung in der Materialwirtschaft. Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle und Algorithmen, die für die Planung der Bestellmengen verwendet werden können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Eignung dieser Modelle und Algorithmen für den praktischen Einsatz.
- Definition und Abgrenzung des Begriffes Materialwirtschaft
- Ziele der Materialwirtschaft
- Struktureller Aufbau der Materialwirtschaft
- Institutionelle Beschaffungsprinzipien und -formen
- Methoden und Algorithmen der Bestellmengenplanung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Arbeit stellt das Thema der Bestellpolitikplanung vor und erläutert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Aufgaben, Ziele und Aufbau der Materialwirtschaft - Dieses Kapitel definiert den Begriff der Materialwirtschaft und beleuchtet deren Ziele sowie die strukturellen Komponenten der Materialwirtschaft, wie z.B. Materialbeschaffung, -verwaltung, -verteilung und -entsorgung.
- Kapitel 3: Institutionelle Beschaffungsprinzipien und -formen - Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Beschaffungsformen wie Langfristige Kontraktpolitik, Just-in-Time-Beschaffung, Einkaufsgemeinschaften, Vendor Managed Inventory und Katalogsysteme. Dabei werden Definitionen, Anwendbarkeit, Stärken und Schwächen sowie Anforderungen an Algorithmen vorgestellt.
- Kapitel 4: Methoden und Algorithmen der Bestellmengenplanung - In diesem Kapitel werden deterministische und stochastische Modelle der Bestellmengenplanung besprochen. Es werden klassische Modelle wie EOQ, Wagner-Whitin sowie heuristische Verfahren wie LUC, SMV und PPV vorgestellt. Darüber hinaus werden stochastische Modelle wie (s,q)-Politik, (r,S)-Politik und (s,S)-Politik analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bestellpolitikplanung in der Materialwirtschaft. Die zentralen Themen sind die Analyse und Bewertung verschiedener Modelle und Algorithmen für die Bestellmengenplanung, wobei die praktische Anwendbarkeit dieser Ansätze im Vordergrund steht. Behandelte Schlüsselbegriffe sind Materialwirtschaft, Materialbeschaffung, Beschaffungsprinzipien, Beschaffungsformen, Just-in-Time-Beschaffung, Vendor Managed Inventory, Katalogsysteme, Elektronische Marktplätze, Reverse Auctions, Economic Order Quantity (EOQ), Wagner-Whitin-Modell, heuristische Verfahren, stochastische Lagerhaltungspolitiken, (s,q)-Politik, (r,S)-Politik und (s,S)-Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Bestellpolitikplanung?
Ziel ist es, optimale Bestellmengen und -termine so festzulegen, dass die Materialversorgung gesichert ist und gleichzeitig die Lager- und Bestellkosten minimiert werden.
Was ist das klassische EOQ-Modell?
Das Economic Order Quantity-Modell ermittelt die optimale Bestellmenge unter der Annahme eines konstanten Verbrauchs und statischer Kostenfaktoren.
Was unterscheidet deterministische von stochastischen Modellen?
Deterministische Modelle gehen von bekannten Bedarfen aus. Stochastische Modelle berücksichtigen Unsicherheiten in der Nachfrage und Lieferzeit mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Wie funktioniert das Wagner-Whitin-Verfahren?
Es ist ein dynamischer Algorithmus zur Bestimmung optimaler Bestellmengen bei schwankenden Bedarfen über einen festen Planungszeitraum.
Was ist Vendor Managed Inventory (VMI)?
VMI ist eine Beschaffungsform, bei der der Lieferant selbst die Verantwortung für die Lagerbestände des Kunden übernimmt und die Nachschubplanung steuert.
- 4.3.1 Deterministisch-statische Modelle.
- 2.1 DEFINITION UND ABGRENZUNG DES BEGRIFFES MATERIAL WIRTSCHAFT
- Quote paper
- Karsten Oltrogge (Author), 2003, Modelle und Algorithmen der Bestellpolitikplanung unter besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Anwendbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26197