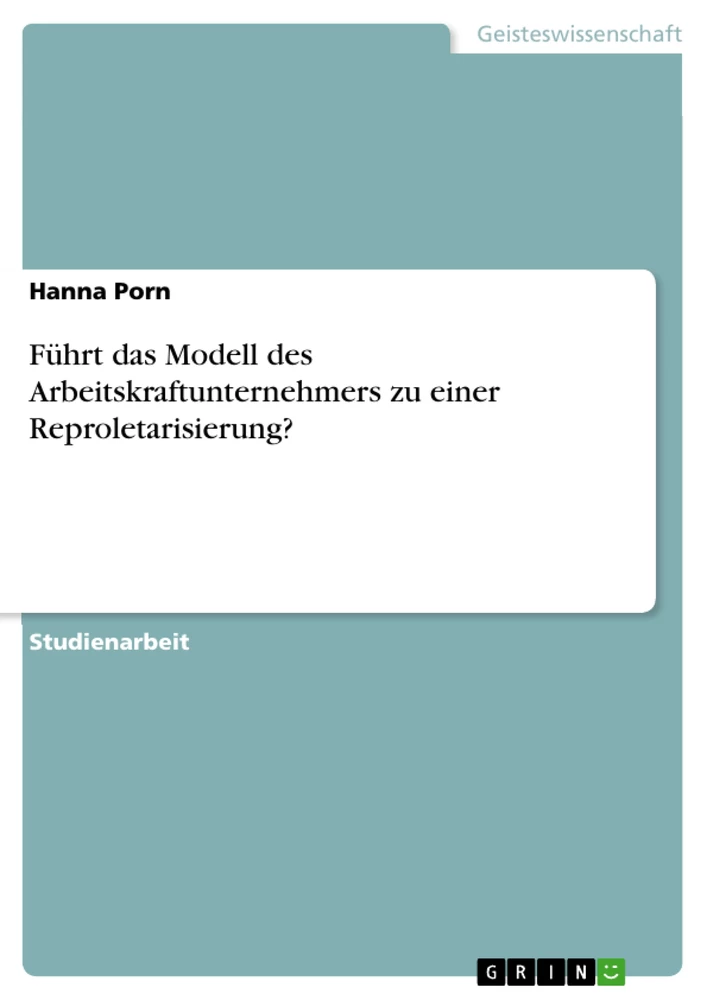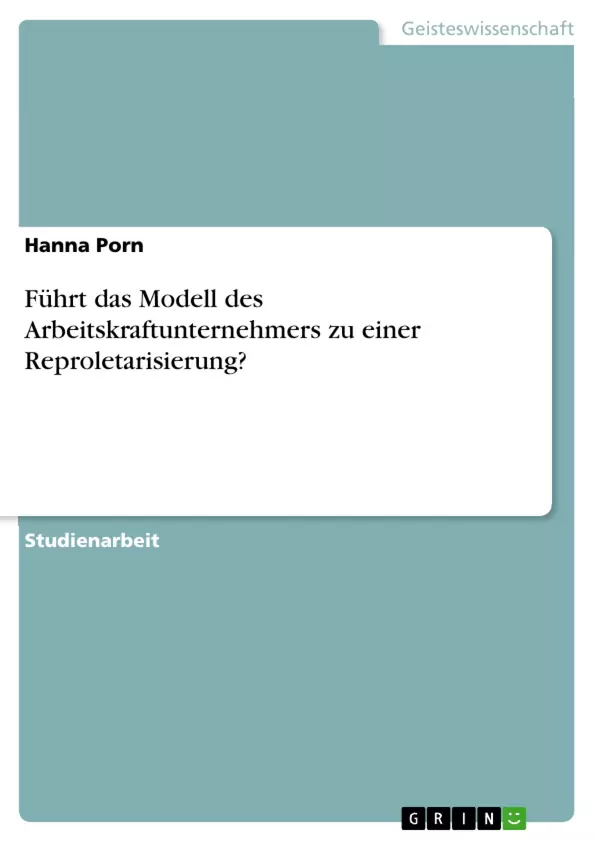Thema dieser Hausarbeit ist der momentane Strukturwandel in der Arbeitswelt. Aufgrund der stark verschärften Wettbewerbsbedingungen sehen sich viele Unternehmen zunehmend dazu gezwungen, die Kosten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Diese betrieblichen Reorganisationsprozesse verlangen einerseits eine Veränderung in der Einstellung des Arbeitnehmers, andererseits in der betrieblichen Organisation. Diese zeichnen sich hauptsächlich in Lockerungen der betrieblichen Strukturvorgaben ab (vgl. Voß 1998, S. 474).
1998 wurde von den Soziologen Hans J. Pongratz und G. Günter Voß ein Konzept entwickelt, das die Zukunft in der Selbstorganisation der Arbeitskraft sieht. Diesen veränderten Typus von Arbeitskraft nannten sie „Arbeitskraftunternehmer“. Im Rahmen dieses Wandels soll der Arbeitnehmer selbstständiger werden und zunehmend als „Unternehmer seiner selbst“ agieren. Ihm werden große Freiräume im Bezug auf die Arbeitsgestaltung eingeräumt (vgl. Voß/Pongratz 1998, S. 133). Durch diese gestiegene Eigenverantwortung wird der Kontrollaufwand reduziert wodurch auch Kosten eingespart werden. Dazu soll der Fokus der Lebensplanung wieder hauptsächlich auf die Erwerbstätigkeit ausgerichtet sein (vgl. ebd., S. 133). Flexibilität wird dabei zu einem wichtigen Kriterium für den beruflichen Erfolg des Einzelnen. In diesem Zusammenhang wird auch von einer Entgrenzung von Arbeit und Leben gesprochen. Damit ist gemeint, dass diese beiden Bereiche nicht mehr voneinander zu trennen sind, sonder miteinander verschmelzen.
Die folgende Bearbeitung des Themas wird hauptsächlich aus der Perspektive des Arbeitnehmers erfolgen, wobei die betriebliche Perspektive nicht außer Acht bleibt. Es handelt es sich um eine Prognose, die aber kaum auf empirischen Untersuchungen basiert. Deshalb kann nur schwer vorausgesagt werden wie weit der Strukturwandel bereits fortgeschritten ist.
Doch stellt das Modell des Arbeitskraftunternehmers wirklich eine fortschrittliche Weiterentwicklung zum verberuflichten Arbeitnehmer dar oder findet vielmehr ein Rückschritt in Richtung Proletarier statt? Dieser Frage wird im Rahmen dieser Hausarbeit nachgegangen und es wird untersucht, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Arbeitskraftmodelle liegen und welche Chancen und Gefahren sich dahinter verbergen.
Im zweiten Abschnitt geht es um die Vorstellung des Konzepts des Arbeitskraftunternehmers nach Voß und Pongratz.
Der dritte Abschnitt handelt von der historischen En
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept des Arbeitskraftunternehmers (nach Voẞ/Pongratz)
- 2.1 Definition
- 2.2 Merkmale des Typus „Arbeitskraftunternehmer“
- 2.2.1 Selbstkontrolle
- 2.2.2 Selbstökonomisierung
- 2.2.3 Selbstrationalisierung
- 3. Darstellung der historischen Entwicklung
- 3.1 Der proletarische Lohnarbeiter
- 3.2 Der verberuflichte Arbeitnehmer
- 3.3 Der Arbeitskraftunternehmer
- 4. Vergleich des Arbeitskraftunternehmers mit dem Proletarier
- 4.1 Gemeinsamkeiten
- 4.2 Unterschiede
- 4.3 Auswertung
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Wandel in der Arbeitswelt und das Konzept des „Arbeitskraftunternehmers“ nach Voß und Pongratz. Sie analysiert, ob dieses Modell eine fortschrittliche Entwicklung darstellt oder eher eine Reproletarisierung bedeutet. Die Arbeit vergleicht den Arbeitskraftunternehmer mit dem traditionellen Proletarier, untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede und bewertet die damit verbundenen Chancen und Risiken.
- Der Strukturwandel der Arbeitswelt und die damit verbundenen Kostenreduzierungs- und Produktivitätssteigerungsmaßnahmen.
- Das Konzept des Arbeitskraftunternehmers und seine zentralen Merkmale (Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung).
- Historische Entwicklung der Arbeitskraft vom proletarischen Lohnarbeiter über den verberuflichten Arbeitnehmer zum Arbeitskraftunternehmer.
- Vergleich zwischen dem Arbeitskraftunternehmer und dem Proletarier hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
- Bewertung des Konzepts des Arbeitskraftunternehmers im Hinblick auf seine gesellschaftliche Relevanz und potenziellen Folgen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Strukturwandels in der Arbeitswelt ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach einer möglichen Reproletarisierung durch das Modell des Arbeitskraftunternehmers. Sie skizziert den Kontext von Kostensenkung und Produktivitätssteigerung in Unternehmen und benennt das Konzept des Arbeitskraftunternehmers als zentralen Gegenstand der Untersuchung. Die Arbeit fokussiert die Perspektive des Arbeitnehmers, erkennt aber die betriebliche Perspektive an. Die Arbeit basiert auf einer prognostischen Analyse, die aufgrund des Mangels an empirischen Daten Limitationen aufweist.
2. Das Konzept des Arbeitskraftunternehmers (nach Voß/Pongratz): Dieses Kapitel präsentiert das Konzept des Arbeitskraftunternehmers, wie es von Voß und Pongratz entwickelt wurde. Es definiert den Arbeitskraftunternehmer als einen Typus von Arbeitskraft, der im Gegensatz zum verberuflichten Arbeitnehmer seine Arbeit selbstständig organisiert und als „Unternehmer seiner selbst“ agiert. Die drei zentralen Merkmale – Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung – werden erläutert. Das Kapitel betont die veränderten Arbeitsbeziehungen und den Übergang von festen Beschäftigungsverhältnissen hin zu temporären Auftragsbeziehungen.
3. Darstellung der historischen Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung von Arbeitskraftmodellen, beginnend mit dem proletarischen Lohnarbeiter, über den verberuflichten Arbeitnehmer bis hin zum Arbeitskraftunternehmer. Es beleuchtet die unterschiedlichen Charakteristika dieser Modelle im Hinblick auf die Arbeitsorganisation, die Kontrolle und das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Wandel wird als Prozess der zunehmenden Selbstorganisation und Eigenverantwortung des Arbeitnehmers dargestellt.
Schlüsselwörter
Arbeitskraftunternehmer, Reproletarisierung, Strukturwandel, Arbeitswelt, Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung, Proletarier, verberuflichter Arbeitnehmer, Kostenreduzierung, Produktivitätssteigerung, flexible Arbeitsverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der Arbeitskraftunternehmer
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Wandel in der Arbeitswelt und das Konzept des „Arbeitskraftunternehmers“ nach Voß und Pongratz. Der Fokus liegt auf der Analyse, ob dieses Modell eine fortschrittliche Entwicklung oder eher eine Reproletarisierung darstellt. Ein zentraler Punkt ist der Vergleich des Arbeitskraftunternehmers mit dem traditionellen Proletarier, unter Berücksichtigung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie Chancen und Risiken.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Strukturwandel der Arbeitswelt, das Konzept des Arbeitskraftunternehmers mit seinen Merkmalen (Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung), die historische Entwicklung der Arbeitskraft (vom proletarischen Lohnarbeiter über den verberuflichten Arbeitnehmer zum Arbeitskraftunternehmer), einen detaillierten Vergleich zwischen Arbeitskraftunternehmer und Proletarier und eine abschließende Bewertung des Konzepts des Arbeitskraftunternehmers hinsichtlich gesellschaftlicher Relevanz und potenzieller Folgen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, das Konzept des Arbeitskraftunternehmers nach Voß/Pongratz, die historische Entwicklung der Arbeitskraft, ein Vergleich des Arbeitskraftunternehmers mit dem Proletarier, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Einführung in den Kontext des Strukturwandels und endend mit einer zusammenfassenden Bewertung.
Welche Methode wird in der Hausarbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer prognostischen Analyse, da empirische Daten fehlen. Sie analysiert das Konzept des Arbeitskraftunternehmers, vergleicht es mit dem traditionellen Proletarier und bewertet die daraus resultierenden Folgen. Die Arbeit fokussiert die Perspektive des Arbeitnehmers, berücksichtigt aber auch die betriebliche Perspektive.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Arbeitskraftunternehmer, Reproletarisierung, Strukturwandel, Arbeitswelt, Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung, Proletarier, verberuflichter Arbeitnehmer, Kostenreduzierung, Produktivitätssteigerung und flexible Arbeitsverhältnisse.
Was sind die zentralen Merkmale des Arbeitskraftunternehmers nach Voß/Pongratz?
Die drei zentralen Merkmale des Arbeitskraftunternehmers nach Voß/Pongratz sind Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung. Diese Merkmale beschreiben die zunehmende Eigenverantwortung und Selbstorganisation des Arbeitnehmers in der modernen Arbeitswelt.
Wie wird der Arbeitskraftunternehmer mit dem traditionellen Proletarier verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht den Arbeitskraftunternehmer und den traditionellen Proletarier hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf Arbeitsorganisation, Kontrolle und das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dieser Vergleich dient der Bewertung der potenziellen Folgen des Wandels in der Arbeitswelt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Das Fazit der Hausarbeit bewertet das Konzept des Arbeitskraftunternehmers im Hinblick auf seine gesellschaftliche Relevanz und potenziellen Folgen. Es wird untersucht, ob das Modell eine fortschrittliche Entwicklung oder eine Form der Reproletarisierung darstellt. Aufgrund des Mangels an empirischen Daten ist die Analyse jedoch als prognostische Betrachtung zu verstehen.
- Quote paper
- Hanna Porn (Author), 2010, Führt das Modell des Arbeitskraftunternehmers zu einer Reproletarisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262108