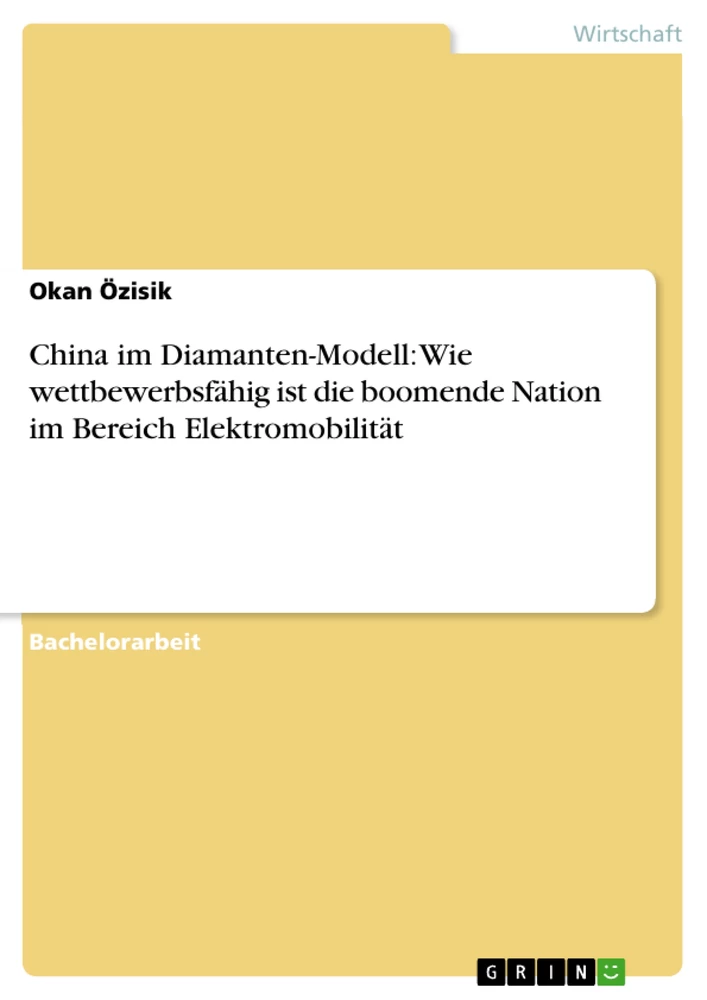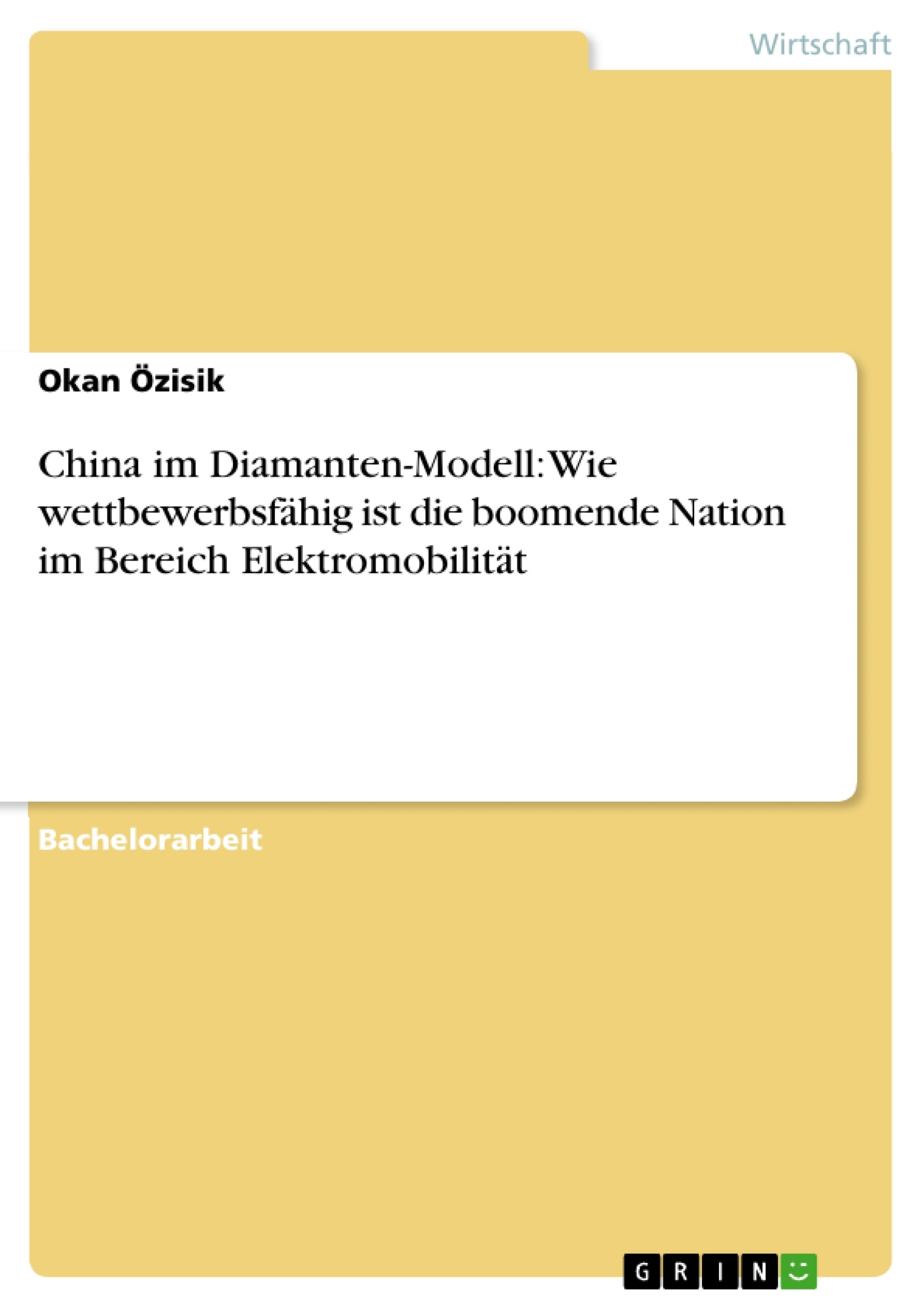Kaum eine Nation wird in der breiten Öffentlichkeit so bestaunend und faszinierend
verfolgt wie die Volksrepublik China. Notwendige ökonomische Reformen führten
die Nation aus der isolierten Planwirtschaft in die globalisierte Marktwirtschaft. Die
Folgen sind seit den 1970er Jahren stetig steigendes Wirtschaftswachstum und
politische Einflussnahme. Zahlreiche europäische und amerikanische Unternehmen
haben ihre Produktionsprozesse sowie Teile ihrer unternehmerischen Aktivitäten
nach China verlagert. Dies führte in den jeweiligen Ländern zum rasanten Anstieg
der Arbeitslosigkeit und, damit einhergehend, der Wegfall von Steuereinnahmen und
Beiträgen in den gesetzlichen Sozialversicherungen sowie Steuerzahlungen in
Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II. Daher ist es notwendig, die Wirtschaftsstruktur
dieser Nation zu kennen und die gewonnenen Erkenntnisse und Vorteile auf
andere Staaten zu übertragen.
Mit 1,3 Mill. Menschen zählt China zu der bevölkerungsreichsten Nation der Erde.
Durch das Wachstum des Pro- Kopf- Einkommens und durch die Generierung hoher
Exportquoten kann das Reich der Mitte zur größten Wirtschaftsmacht aufsteigen. Zur
Erreichung dieses Zieles bedarf es einer wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur, die
sich gegenüber der internationalen Konkurrenz durchsetzt.[...]
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Motivation
1.2 Ziel und Ansatz
2 Porters Diamanten- Modell
2.1 Grundgedanken der nationalen Wettbewerbsvorteile
2.2 Determinanten des Diamanten- Modells
2.2.1 Faktorkonditionen
2.2.2 Inländische Nachfragekonditionen
2.2.3 Verwandte und unterstützende Branchen
2.2.4 Unternehmensstrategie, Struktur und Konkurrenz
2.2.5 Die Rolle des Zufalls
2.2.6 Die Rolle des Staates
2.3 Clusterbildungen
3 Anwendung des Diamanten- Modells auf Chinas Elektromobilität
3.1 Grundlagen der Elektromobilität
3.2 Anwendung des Diamanten auf Chinas Elektromobilität
3.2.1 Faktorkonditionen
3.2.2 Inländische Nachfragekonditionen
3.2.3 Verwandte und unterstützende Branchen
3.2.4 Unternehmensstrategie, Struktur und Konkurrenz
3.2.5 Die Rolle des Zufalls
3.2.6 Die Rolle des Staates
3.2.7 Clusterbildungen
4 Schluss
4.1 Schlussbetrachtung
4.2 Fazit
Literaturverzeichnis
Eigenständigkeitserklärung
Häufig gestellte Fragen
Was ist Porters Diamanten-Modell?
Es ist ein Wirtschaftsmodell, das die Wettbewerbsfähigkeit von Nationen anhand von vier Hauptdeterminanten und zwei Zusatzeinflüssen (Staat und Zufall) analysiert.
Wie wettbewerbsfähig ist China bei der Elektromobilität?
China hat durch staatliche Förderung, große Inlandsnachfrage und den Aufbau von Clustern eine führende Position im Bereich der E-Mobilität erreicht.
Welche Rolle spielt der chinesische Staat in diesem Sektor?
Der Staat agiert als zentraler Lenker durch Subventionen, Quotenregelungen und den Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur.
Was sind Faktorkonditionen im Diamanten-Modell?
Dazu gehören Ressourcen wie Fachkräfte, technisches Know-how und Rohstoffe, die für die Produktion von Elektrofahrzeugen essenziell sind.
Warum ist die Inlandsnachfrage für China so wichtig?
Ein starker Heimatmarkt zwingt Unternehmen zu Innovationen und ermöglicht Skaleneffekte, die den internationalen Export begünstigen.
- Quote paper
- Okan Özisik (Author), 2013, China im Diamanten-Modell: Wie wettbewerbsfähig ist die boomende Nation im Bereich Elektromobilität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262112