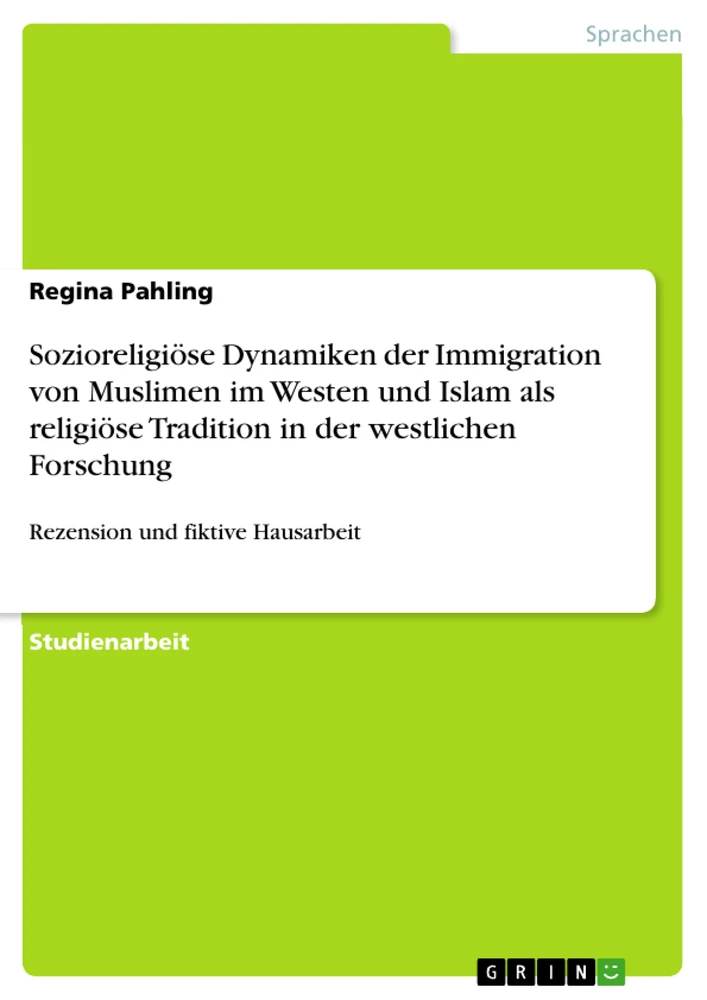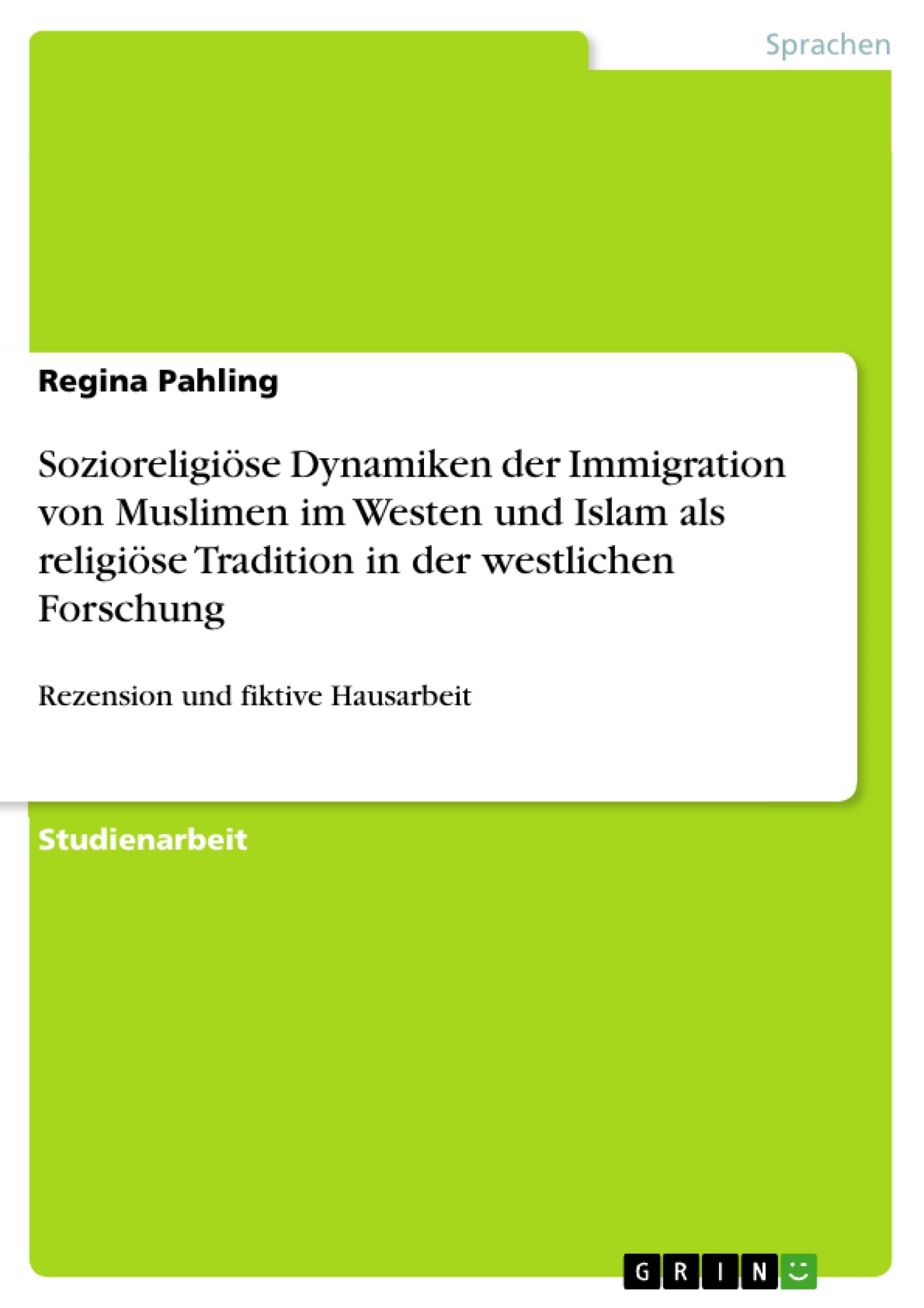In dieser Veröffentlichung wird eine fikive Hausarbeit vorbereitet und der Gang der Vorbereitung (incl. Expose) festgehalten.
Thematisch geht es in der vorliegenden Hausarbeit um die sozioreligiösen Dynamiken der Immigration von Muslimen im Westen und den Islam als religiöse Tradition in der westlichen Forschung. Ausgangspunkt ist ein Artikel von Dr. Jocelyne Cesari: Islam in the West: From Immigration to Global Islam.
Inhaltsverzeichnis
- THEMENWAHL
- REZENSION (CESARI 2009)
- Fragestellung
- Disziplinäre Sichtweise
- Ergebnis
- Argumentationslinie
- Methoden der Autorin
- Beurteilung der Wissenschaftlichkeit
- Kritische Bewertung
- LITERATURRECHERCHE (siehe 6.)
- FIKTIVE HAUSARBEIT
- Thema
- Untersuchungsinteresse / Fragestellung
- Vorgehensweise/Methodik
- Theoretische Verortung
- Definitionen von Schlüsselbegriffen
- Arbeitshypothesen
- Gliederung und Begründung
- DEFINITION DES SCHLÜSSELBEGRIFF
- LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
- Suchstrategie und Fundorte
- Verzeichnis zur Rezension
- Verzeichnis zur fiktiven Hausarbeit
- Verzeichnis zum Schlüsselbegriff
- THEMENWAHL
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den wissenschaftlichen Artikel „Islam in the West: From Immigration to Global Islam“ von Dr. Jocelyne Cesari. Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, die zentrale Fragestellung des Artikels, die disziplinäre Sichtweise der Autorin und die von ihr vorgeschlagenen Methoden zur Erforschung des Themas „Islam im Westen“ zu analysieren. Darüber hinaus soll die wissenschaftliche Qualität des Artikels bewertet und kritisch betrachtet werden.
- Die Bedeutung des Themas „Islam im Westen“ in der heutigen Zeit
- Die Herausforderungen in der Erforschung des Islams als religiöse Tradition
- Die Notwendigkeit eines interdisziplinären Ansatzes zur Analyse von Islam im Westen
- Die Entwicklung neuer Methoden für die Erforschung des Islams im Westen
- Die Kritik an der bisherigen Forschungslandschaft in Bezug auf das Thema „Islam im Westen“
Zusammenfassung der Kapitel
Der Artikel „Islam in the West: From Immigration to Global Islam“ von Dr. Jocelyne Cesari befasst sich mit den sozioreligiösen Dynamiken der muslimischen Immigration im Westen. Die Autorin argumentiert, dass der Islam als religiöse Tradition in der Forschung noch immer eine terra incognita ist und betont den Mangel an Konsens über die Religion als Gegenstand sowie das Fehlen geeigneter Methoden. Sie gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und die Unterschiede in der Islamforschung in Amerika und Europa, wobei sie verschiedene Ansätze beleuchtet und ihre methodischen und inhaltlichen Vorteile bzw. Mängel untersucht. Darüber hinaus unterstreicht die Autorin die Notwendigkeit neuer Methoden und eines interdisziplinären Ansatzes, um die multivalenten Realitäten, denen Muslime im Westen begegnen, adäquat zu erfassen.
Schlüsselwörter
Muslime im Westen, Islamforschung, Interdisziplinäre Ansätze, Methodenentwicklung, Sozioreligiöse Dynamiken, Immigration, Globaler Islam, Terra Incognita, Forschungslandschaft, Kritische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen zu "Islam im Westen"
Worum geht es in Jocelyne Cesaris Artikel?
Der Artikel analysiert den Übergang von der muslimischen Immigration hin zu einem globalen Islam in westlichen Gesellschaften und die damit verbundenen sozioreligiösen Dynamiken.
Warum wird der Islam in der Forschung als "terra incognita" bezeichnet?
Weil es laut Cesari an einem wissenschaftlichen Konsens über die Religion als Forschungsgegenstand und an geeigneten Methoden zur Untersuchung fehlt.
Welche Unterschiede gibt es in der Islamforschung zwischen USA und Europa?
Die Ansätze unterscheiden sich in ihren methodischen Schwerpunkten und den inhaltlichen Fokusgebieten, bedingt durch die unterschiedlichen Migrationsgeschichten.
Warum ist ein interdisziplinärer Ansatz notwendig?
Nur durch die Verbindung verschiedener Fachrichtungen können die multivalenten Realitäten muslimischen Lebens im Westen adäquat erfasst werden.
Was wird an der bisherigen Forschung kritisiert?
Kritisiert wird vor allem der Mangel an geeigneten methodischen Werkzeugen und die oft einseitige Sichtweise auf den Islam als rein religiöse Tradition statt als lebendige soziale Praxis.
- Quote paper
- Regina Pahling (Author), 2011, Sozioreligiöse Dynamiken der Immigration von Muslimen im Westen und Islam als religiöse Tradition in der westlichen Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262147