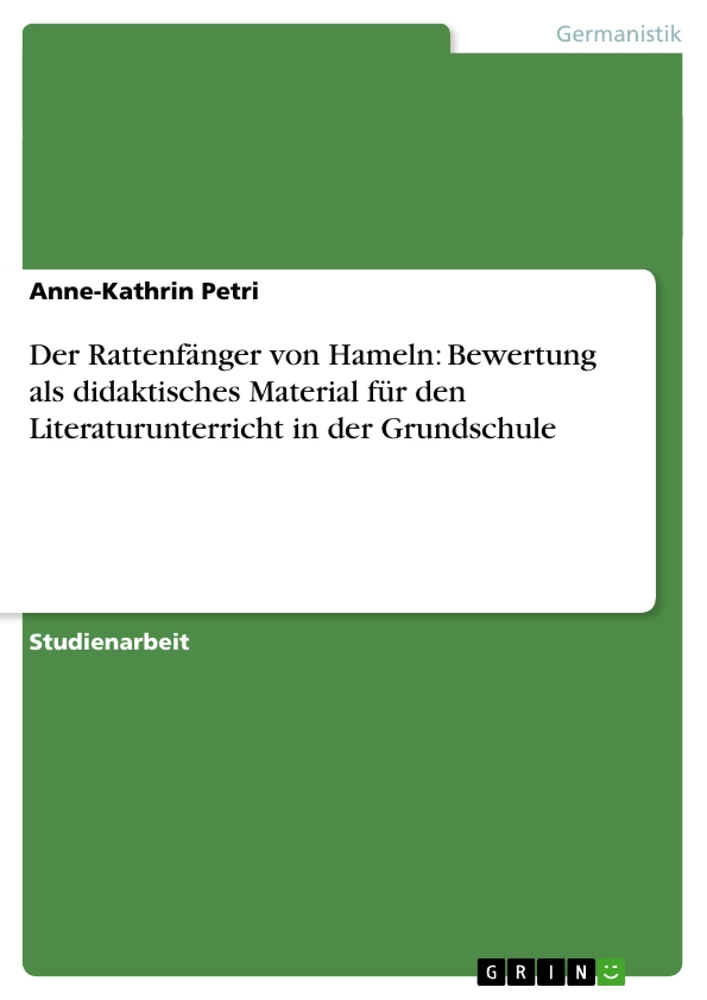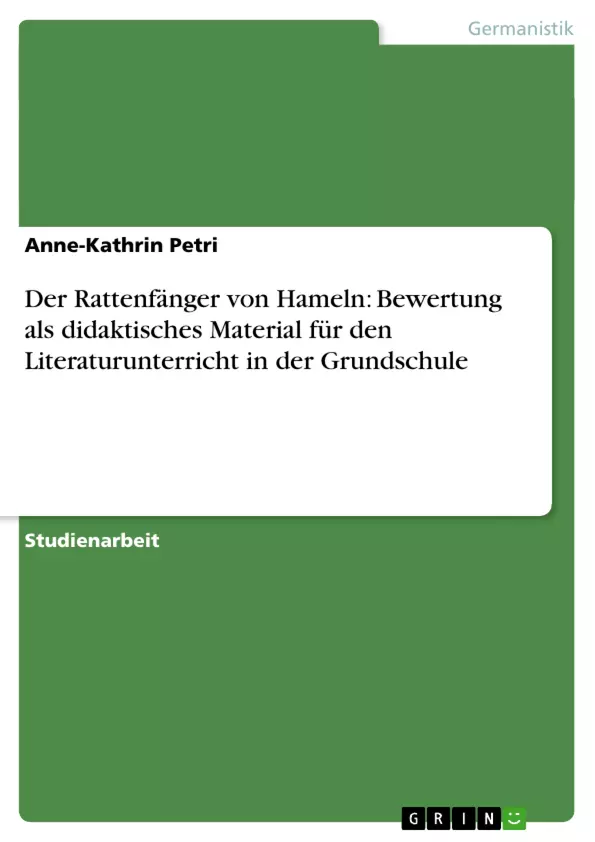Der Literaturunterricht in der Grundschule wird durch zwei grundlegende Ziele dominiert. Zum einen dem „Konzept der Leseförderung“, bei dem es darum geht, die Grundlagen des Lesens zu erlernen, sowie eine stabile Lesehaltung auszubilden. Zum anderen dem „Konzept des literarischen Lernens“, mit dessen Hilfe Fantasie und Vorstellungskraft, sowie literarisches Grundverständnis gefördert werden und die Kinder somit für Literatur begeistert werden sollen.
Ein elementares Ziel des Literaturunterrichtes in der Grundschule stellt also die „Ausbildung einer stabilen Lesemotivation“ (Richter 2007, S. 7) dar. Wie und ob dieser Vorsatz mit Hilfe der frequentiert verwendeten Sage Der Rattenfänger von Hameln, welche 2002 vom Kohl Verlag aufgearbeitet wurde, realisiert wird, soll im Folgenden analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Inhaltlicher Abriss der Sage
3. Analyse des Sinnpotentials
4. Analyse und Bewertung der didaktischen Materialien
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Der Literaturunterricht in der Grundschule wird durch zwei grundlegende Ziele dominiert. Zum einen dem „Konzept der Leseförderung“, bei dem es darum geht, die Grundlagen des Lesens zu erlernen, sowie eine stabile Lesehaltung auszubilden. Zum anderen dem „Konzept des literarischen Lernens“, mit dessen Hilfe Fantasie und Vorstellungskraft, sowie literarisches Grundverständnis gefördert werden und die Kinder somit für Literatur begeistert werden sollen.
Ein elementares Ziel des Literaturunterrichtes in der Grundschule stellt also die „Ausbildung einer stabilen Lesemotivation“ (Richter 2007, S. 7) dar. Wie und ob dieser Vorsatz mit Hilfe der frequentiert verwendeten Sage Der Rattenfänger von Hameln, welche 2002 vom Kohl Verlag aufgearbeitet wurde, realisiert wird, soll im Folgenden analysiert werden.
2. Inhaltlicher Abriss der Sage
Erstmals 1816 im Werk „Deutsche Sagen“ unter dem Originaltitel „Die Kinder zu Hameln“ erschienen, stellt die Sage nach den Kinder- und Hausmärchen eine der frühen Publikationen der Gebrüder Grimm dar.
Das Geschehen trägt sich im Jahr 1284 zu, als ein fremder Mann in die von Ratten und Mäusen geplagte Stadt Hameln kommt. Dieser gibt sich als Rattenfänger aus und die Bürger versprechen ihm sogleich einen Lohn für die Beseitigung der lästigen Tiere. Als er seine Pfeife nimmt und darauf spielt, kommen umgehend sämtliche Ratten und Mäuse aus ihren Verstecken und folgen ihm zur Weser, in der sie schlussendlich ertrinken. Befreit von der Plage bereuen die Bürger Hamelns jedoch den versprochenen Lohn und verwehren jenen dem Rattenfänger, welcher darauf verschwindet. Einige Zeit später kommt er allerdings erneut nach Hameln und spielt auf seiner Pfeife. Nun folgen ihm aber keine unerwünschten Tiere, sondern die Kinder der Stadt. Er bringt sie aus der Stadt zu einem Berge. Nur zwei von ihnen kehren zurück, die restlichen 130 Kinder bleiben verschollen.
3. Analyse des Sinnpotentials
Der Rattenfänger von Hameln ist eine der populärsten deutschen Sagen, welche mittlerweile in über 30 Sprachen übersetzt wurde (vgl. Decker 2010). Der Protagonist symbolisiert hierbei einen zwar „wunderlichen“, aber doch gutmütigen Menschen, welcher gegen ein kleines Zubrot seine Arbeit verrichten will. Als die Bürger der Stadt dann jedoch gesehen haben, wie einfach ihm das möglich war- sie hatten eine weitaus härtere Arbeit seinerseits erwartet- versagten sie ihm aus Geiz seinen Lohn. Dies stellt den Hauptkonflikt der Sage dar, schließlich versprachen jene dem Rattenfänger zu Beginn Geld für seine Arbeit und nur aus zweifelhaften Gründen entbehrten sie ihm dieses. Diese Problematik ist in der heutigen Zeit noch sehr aktuell, das Verhalten vieler Menschen ist auch heutzutage von Geiz geprägt. Schlussendlich ist es nicht von Bedeutung, auf welche Art und Weise jemand sein Werk vollbringt, hauptsache er tut es und das Ergebnis ist zufriedenstellend.
Der Rattenfänger zieht gedemütigt davon, will das Ganze aber nicht auf sich sitzen lassen und Rache an den Hamelnern verüben. So kehrt er zurück und entführt auf dieselbe Art und Weise, wie er die Ratten vertrieb, die Kinder der Stadt.
Diese Sage wird von zwei Hauptakteuren, dem Rattenfänger auf der einen und den Bürgern der Stadt Hamelns auf der anderen Seite, geprägt. Der Rattenfänger wird hierbei als ein gutmütiger Wandersmann dargestellt, welcher gewillt ist, den Bürgern bei der Vertreibung der Tiere zu helfen, dafür gerechterweise aber auch eine Entlohnung verlangt. Dass er sich für die Verweigerung seines Lohnes an den Bürgern mit der Entführung ihrer Kinder rächt, erscheint sehr grausam. Ob dies vollends gerechtfertigt ist, bleibt allerdings fraglich. Möglicherweise wäre es ausreichend, die Ratten wieder zurück in die Stadt zu bringen. Die Einwohner Hamelns verkörpern die von Geiz und Eigensinnigkeit geprägte Gesellschaft. Zunächst sind sie bedürftig und benötigen die Unterstützung des Fremden. In dieser Situation versprechen sie ihm auch die monetäre Entschädigung für seine Arbeit. Aus der Notsituation befreit, sehen die Bürger jedoch keinen Grund mehr, dem Rattenfänger sein Geld zu geben.
Die Symbolik der Sage und der den Kindern zu vermittelnde Inhalt bestehen darin, dass Versprechen eingehalten werden müssen, und nicht aus banalen Gründen gebrochen werden dürfen. Geiz wird hierbei als negative Eigenschaft herausgestellt.
Der Erzählstil wird durch einen allwissenden Erzähler realisiert und ist aufgrund der Verwendung vieler Adjektive als sehr bildhaft, kindgerecht und einprägend zu charakterisieren.
Es wäre sinnvoll unter der Verwendung dieses Textes im Literaturunterricht das Ziel des „literarischen Lernens“ zu verfolgen, auf dessen Basis Vorstellungsvermögen und Feingeist für literarische Werke gefördert werden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum eignet sich der "Rattenfänger von Hameln" für den Unterricht?
Die Sage vermittelt wichtige moralische Werte wie die Einhaltung von Versprechen und zeigt die negativen Folgen von Geiz und Undankbarkeit auf kindgerechte Weise.
Was ist das Ziel des "literarischen Lernens" in der Grundschule?
Es soll die Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder fördern, ein Grundverständnis für literarische Texte wecken und die Begeisterung für Literatur steigern.
Worum geht es im Kern der Sage vom Rattenfänger?
Ein Fremder befreit die Stadt Hameln von einer Rattenplage. Als die Bürger ihm den versprochenen Lohn verweigern, kehrt er zurück und entführt zur Rache die Kinder der Stadt.
Was symbolisiert der Rattenfänger?
Er ist eine ambivalente Figur: Einerseits ein hilfreicher Wandersmann, andererseits ein rachsüchtiger Fremder, der die Konsequenzen von Wortbruch verdeutlicht.
Wie wird die Lesemotivation durch Sagen gefördert?
Durch spannende Handlungen, bildhafte Sprache und klare Konflikte werden Kinder motiviert, sich intensiver mit Texten auseinanderzusetzen und eine stabile Lesehaltung aufzubauen.
- Arbeit zitieren
- Anne-Kathrin Petri (Autor:in), 2013, Der Rattenfänger von Hameln: Bewertung als didaktisches Material für den Literaturunterricht in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262303