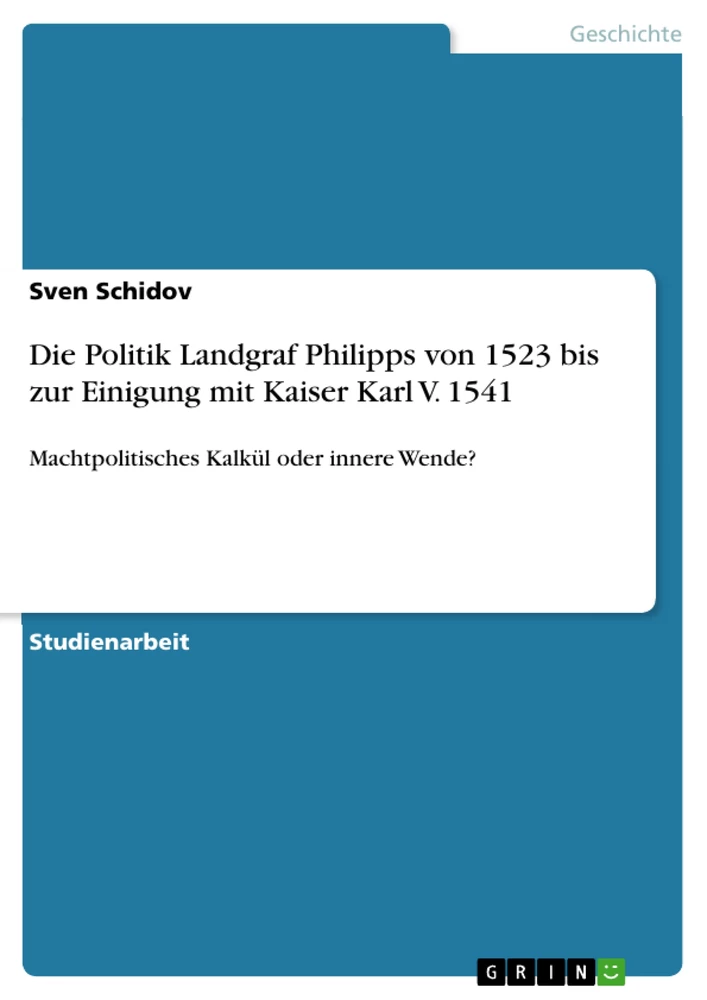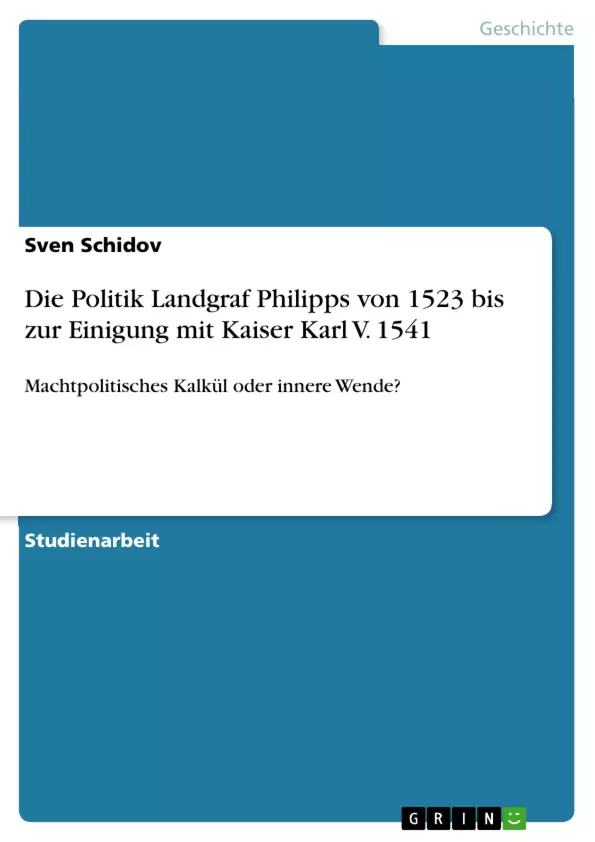Der Reichstag zu Regensburg war für die noch junge Universität Marburg von großer Bedeutung: Am 13. Juni 1541 kam es zu einer geheimen Übereinkunft zwischen Landgraf Philipp und Karl V., die die kaiserliche Privilegierung der landesherrlich gegründeten Universität umfasste. Diese Privilegierung wurde durch die kaiserliche Bestätigungsurkunde vom 16. Juli 1541 affirmiert und erhebt die Universität von einer Territorialhochschule in den Rang der Generalstudien. Damit war ihre Anerkennung über die territorialen Grenzen hinaus gesichert. Im Gegenzug machte Philipp weitreichende Zugeständnisse, [...]. Doch wie kam es zu der Annäherung zwischen Philipp und Karl V.? Ziel dieser Seminararbeit im Rahmen des Hauptseminars „die Universität Marburg im 16. Jahrhundert“ ist es, herauszuarbeiten, welche Motive für Philipp, von dem oftmals das Bild eines rigorosen Antihabsburgers gezeichnet wird, ausschlaggebend waren, sich dem Kaiser anzunähern und Kompromisse einzugehen. In diesem Zusammenhang sind die persönliche Lage Philipps, sowie der territorialpolitische und reichspolitische Kontext von entscheidender Bedeutung und sollen daher im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Schlussendlich soll abgewogen werden, welche Motive für Philipp im Vordergrund standen und die Entwicklung seines Verhältnisses zum Kaiser beschrieben und beurteilt werden. Der Beschreibung des Verhältnisses von machtpolitischen Entscheidungen und religiösen Überzeugungen Philipps wird dabei eine zentrale Rolle zukommen.
Dabei möchte ich mich auf den Zeitraum von 1523 bis zur geheimen Übereinkunft 1541 beziehen. Das Jahr 1523/24 markiert insofern eine entscheidende Wendung der Politik Philipps, als dass Philipp sich ab diesem Zeitpunkt offen gegen das Haus Habsburg stellt und sich der Reformation zuwendet. Da bestimmte Gegebenheiten und Ereignisse die Politik Philipps beeinflussen, orientiert sich die Gliederung der Arbeit chronologisch an diesen, womit versucht werden soll, die verschiedenen Phasen der landgräflichen Politik in ihrem jeweiligen Kontext zu erfassen und zu bewerten. Abschließend möchte ich anhand einer kurzen Analyse der kaiserlichen Bestätigungsurkunde, die als ein Resultat der vorher beschriebenen Entwicklung betrachtet werden kann, aufzeigen, warum der Marburger Universität im Vergleich zu anderen Universitäten ein gewisser Sonderstatus zukommt und worin dieser in der Urkunde zum
Ausdruck kommt. [...]
I NHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Philipps Wendung gegen den Kaiser (1523/1524)
3. Die Krise im reformatorischen Lager (1528)
4. Hessens Führungsrolle im deutschen Protestantismus und seine Bündnispolitik (1526 - 1538)
5. Hessens Verhältnis zu Kursachsen
6. Philipps Doppelehe, ihre Folgen und seine Krankheit
7. Frühere Annäherungsversuche zwischen dem Landgrafen und dem Kaiser
8. Der Reichstag zu Regensburg (1541)
9. Die kaiserliche Bestätigungsurkunde für die Marburger Universität von 1541
10. Fazit und Ausblick
11.Quellen- und Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte der Reichstag zu Regensburg 1541 für die Universität Marburg?
Durch eine geheime Übereinkunft mit Kaiser Karl V. erhielt die Universität die kaiserliche Privilegierung, was sie in den Rang einer Generalstudienstätte erhob.
Warum näherte sich der „Antihabsburger“ Landgraf Philipp dem Kaiser an?
Die Arbeit untersucht Motive wie Philipps persönliche Lage (Doppelehe), seine Krankheit sowie territorialpolitische Notwendigkeiten für diesen Kompromiss.
Was änderte sich in Philipps Politik ab dem Jahr 1523/24?
Dieser Zeitpunkt markiert seine offene Hinwendung zur Reformation und seine Positionierung gegen das Haus Habsburg.
Welche Rolle spielte Philipps Doppelehe für sein Verhältnis zum Kaiser?
Die Doppelehe brachte Philipp in eine rechtlich und politisch prekäre Lage, die ihn zu weitreichenden Zugeständnissen gegenüber Karl V. zwang.
Welchen Sonderstatus erhielt die Universität Marburg durch die Bestätigungsurkunde?
Die Urkunde sicherte die Anerkennung der landesherrlich gegründeten Universität über die territorialen Grenzen hinaus und verlieh ihr kaiserliche Legitimität.
- Quote paper
- Sven Schidov (Author), 2013, Die Politik Landgraf Philipps von 1523 bis zur Einigung mit Kaiser Karl V. 1541, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262316